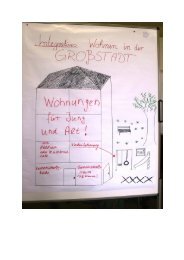SELEA-Abschlussbdericht - Staatliche Schule Gesundheitspflege (W1)
SELEA-Abschlussbdericht - Staatliche Schule Gesundheitspflege (W1)
SELEA-Abschlussbdericht - Staatliche Schule Gesundheitspflege (W1)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
• Auf der Mesoebene: Bereits zu Beginn des Modellversuchs war seitens des Schulmanagements,<br />
die personelle Verzahnung von <strong>SELEA</strong>-Team und Abteilung Altenpflege versäumt<br />
worden, z.B. durch Aufnahme der Abteilungsleiterin in die Projektleitung von <strong>SELEA</strong> oder<br />
durch Sicherstellen der Lehre durch Mitglieder des <strong>SELEA</strong>-Teams in den Modellversuchsklassen.<br />
Auch im Ausbildungsjahrgang 2006 wurden keine Lehrenden des <strong>SELEA</strong>-Teams unterrichtlich<br />
eingeplant. So dass der neue Ausbildungsjahrgang wiederum ohne curriculare und<br />
pflegedidaktische Fördermaßnahmen selbstbestimmter Lernformen startete. Die innerschulischen<br />
Transferversuche im zweiten <strong>SELEA</strong>-Jahr zeigten insgesamt, dass die Unterstützung einer<br />
<strong>SELEA</strong>-übergreifenden, schulweiten Förderung des selbstgesteuerten Lernens seitens der<br />
Schulleitung in vieler Hinsicht hinter den Erwartungen des <strong>SELEA</strong>-Teams zurückblieb. 4 Es<br />
kam daher die Vermutung auf, dass man sich der Tragweite des SKOLA-Programms dort noch<br />
gar nicht bewusst sei. Dafür spricht möglicherweise auch die mangelnde Rezeption der im<br />
Vorfeld von SKOLA durchgeführten Modellversuche, so dass ein Transfer dieser Ergebnisse<br />
(z.B. CULIK) die Lehrerteams der <strong>W1</strong> noch nicht erreicht hat.<br />
• Berufskultur: Zu Beginn des dritten <strong>SELEA</strong>-Jahres zeichnet sich bezüglich des innerschulischen<br />
Transfers nach zwei pädagogischen Tagen eine ambivalente Situation ab: Die Resonanz<br />
im Kollegium schwankt zwischen grundsätzlicher Ablehnung gegenüber jeglichen Veränderungen<br />
und großem Interesse, Aufgeschlossenheit für die Arbeit des <strong>SELEA</strong>-Teams. Interessanterweise<br />
entfaltet der Modellversuch selbst in diesem Zusammenhang eine transferhemmende<br />
Wirkung, insofern er den Neid der nicht-beteiligten Kollegen weckt, die sich den innovativen<br />
Arbeitsanforderungen gleichermaßen gegenüber sehen, ohne in den Genuss einer zeitlichen<br />
Freistellung zu kommen. Als grundsätzlich problematisch wird immer wieder die starke<br />
Belastung der Kollegen angeführt, welche es auch denjenigen, die an den Modellversuchsergebnissen<br />
interessiert seien, stark erschwere, sich näher mit ihnen auseinanderzusetzen. Aufgrund<br />
dieser Situation beantragte die wissenschaftliche Begleitung zu Beginn des zweiten Jahres<br />
eine SKOLA-Ergänzungsstudie mit der Fragestellung, unter welchen Bedingungen die<br />
Lehrenden ein Interesse an schulischen Neuerungen entwickeln und welche Faktoren (Alltagsbelastungen,<br />
Zeitdruck, Berufskultur u.ä.) ihre Innovationsbereitschaft fördern oder hemmen.<br />
Ausgangsmaterial der Studie mit dem Titel: Innovationsbereitschaft unter Praxisdruck wurden<br />
die Ergebnisse einer Forschenden Lernwerkstatt 5 in der Teamqualifizierung vom 18.11.2006<br />
und die Interviews der wissenschaftlichen Begleitung zur Evaluation der SKOLA-Dossiers<br />
Transfer und Personalentwicklung. Weitere Vergleichs-Interviews wurden mit Lehrenden in<br />
Pflegeschulen verschiedener Bundesländer zu Fragen des innerschulischen Transfers didaktischer<br />
Innovationen geführt.<br />
• Berufskultur: Seit Einführung des Lernfeldkonzepts (1996) zählt die fachrichtungsdidaktische<br />
Lernfeldinterpretation zur curricularen Ausgestaltung von Lernsituationen in gemischt besetzten<br />
Teams zu den Aufgaben der Lehrenden in beruflichen <strong>Schule</strong>n. Die durch den Lernfeldansatz<br />
implizierte Aufgabenverschiebung in Richtung didaktischer Mesoebene, konfrontiert die<br />
Lehrenden mit neuen Anforderungen. Dieser radikale Wandel im Anforderungsprofil professionellen<br />
Lehrerhandelns wurde, wie in den Jahren zuvor, wiederholt zum Thema: Es zeigte<br />
sich, dass die im Antrag vorausgesetzten Ausgangsbedingungen für die Verankerung selbstge-<br />
4 Eine prinzipielle Offenheit gegenüber den Initiativen des <strong>SELEA</strong>-Teams (beispielsweise die Durchführung<br />
einer zweitägigen Pädagogischen Jahreskonferenz zum Transfer des Selbstgesteuerten Lernens in alle übrigen<br />
schulischen Abteilungen) sei aus Gründen der Qualitätssteigerung und Imagepflege zwar deutlich<br />
fühlbar, doch sobald es um die verbindliche Übernahme von Verantwortung für die Verstetigung der Maßnahmen<br />
gehe (z.B. für die Durchführung kontinuierlicher Fortbildungsangebote), werde die konkrete Unterstützung<br />
vermisst.<br />
5 Die Forschende Lernwerkstatt mit Prof. Dr. Petra Grell war eine Veranstaltung in der Teamqualifizierung<br />
(MB 5.5, vgl. Anlage 4, S. 72) im Nov. 2006. Sekundär diente diese Veranstaltung ebenfalls der didaktischen<br />
Fortbildung der Lehrenden, denn die Forschende Lernwerkstatt eignet sich hervorragend zur Förderung<br />
des selbstbestimmten forschenden Unterrichts. Um diesen Aspekt zu vertiefen, lud das <strong>SELEA</strong>-Team<br />
Frau Grell zu einem weiteren Fortbildungstermin in die <strong>W1</strong> ein. Die von den Lehrenden freigegebenen Resultate<br />
der Forschenden Lernwerkstatt wurden in der Ergänzungsstudie Innovationsbereitschaft unter Praxisdruck<br />
(MB 6) hinsichtlich der Transferproblematik in der <strong>W1</strong> weiter ausgewertet.<br />
7