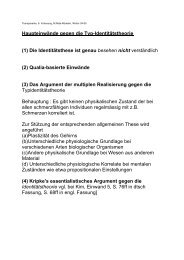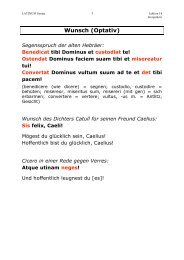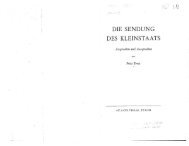NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10 FS 2010, Bern (M. Mayordomo)<br />
apostolischen Verfasserschaft des Evangeliums und der Briefe Zweifel bestehen, ist mit der Loslösung der <strong>Apk</strong><br />
von diesen Schriften die eigentliche Verfasserschaftsfrage weit weniger geklärt, als es noch zu Dionysius’ Zeiten<br />
der Fall war. Es wäre umgekehrt auch möglich, dass die <strong>Apk</strong> vom Apostel Johannes stammt und die übrigen<br />
»johanneischen« Schriften von jemand anderem 30 . Dagegen spricht die Verbindung der zwölf Stämme Israels<br />
mit den zwölf Aposteln im himmlischen Jerusalem (21,13f), die eine deutliche Distanz von der Apostelgruppe<br />
andeutet.<br />
Dass es jedoch auch »johanneische« Hinweise gibt, darf nicht übersehen werden 31 : 1. Die Autorität des Autors<br />
in Ephesus ist für eine andere Person als den Apostel Johannes schwer anzunehmen. 2. Es gibt trotz aller<br />
Stilunterschiede auch einige wörtliche Übereinstimmungen mit dem Evangeliums: Jesus als »Wort Gottes«,<br />
»Lamm Gottes«, »Zeugnis«, »Leben-Tod«, »Hunger«, »Durst«, »Sieg«, »lebendiges Wasser«.<br />
Seit uns Eusebius in einem etwas eigenartigen Diktum ein Zeugnis des Papias weitergegeben<br />
hat, das die Deutung erlaubt, in Ephesus neben dem Apostel Johannes auch einen Presbyter<br />
gleichen Namens zu lokalisieren (HE III 29,2-4), steht für die Verfasserschaft der <strong>Apk</strong> noch<br />
ein zweite Kandidat zur Verfügung 32 .<br />
Die Bedeutung der Verfasserschaftsfrage wird jedoch durch den Umstand relativiert, dass das<br />
Buch selbst seinem Selbstanspruch nach auf Gott über Jesus Christus zurückzugeht (1,1; vgl.<br />
22,16). Der Autor bezeugt die Wahrheit der Visionen (1,2; 22,8) und spricht mit autoritativer<br />
Stimme zu den Gemeinden Kleinasiens (1,4).<br />
1.4.1 Exkurs: Autoriale Präsenz in der <strong>Apk</strong> 33<br />
Die Autornennung in 1,1f erfolgt im Schatten der theologischen Autorisierung der Schrift als<br />
göttliche Offenbarung. Entsprechend ist Gott Subjekt des Satzes. Johannes erscheint nach<br />
Jesus Christus, Gott, seinen Knechten und dem Mittlerengel als »Knecht Gottes« ganz am<br />
Ende des Satzes. Seine Rolle wird in 1,2 knapp als die eines »Zeugen« des Geschauten<br />
bestimmt. Eine weitere Absicherung seines Ethos als Übermittler der göttlichen Offenbarung<br />
fehlt. Ebenso unpersönlich-knapp ist der Briefgruß in 1,4 gestaltet: Absender (»Johannes«),<br />
Empfänger (»den sieben Gemeinden«), Ort (»in Asien«) und »paulinischer« Segenswunsch<br />
(»Gnade und Friede...«). Der Absendername wird nicht ausgeführt. Dieses Fehlen von<br />
Ausführungen zur eigenen Person wird in 1,9 nachgeholt, jedoch in der deutlichen Absicht,<br />
ihn mit den Empfängern auf eine Stufe zu stellen 34 :<br />
»Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse (Ho hadelfòß Humẅn kaì sugkoinwnóß) in der Drangsal,<br />
Königtum und Ausharren in Jesus (hen t¨∆ qlíyei kaì basileíâ kaì Hupomon¨∆ hen h Ijsoü), war auf der<br />
Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen.« 35<br />
and the enthronement of the Christ occur through the Redeemer’s death and exaltation to heaven, which yet<br />
entails kindred suffering for the followers of the Lord. But the modes of expression stand in great contrast: the<br />
evangelist combines synoptic-like sayings of Jesus with a quasi-apocalyptic utterance, while the prophet takes<br />
over and adapts a Jewish oracle, which itself had adapted an Ancient Near Eastern myth, to express the victory<br />
of the Messiah and his people over heathen oppresors and the coming of the divine kingdom.« Das<br />
»Apokalyptische« ist nicht einfach eine mit beliebigen Inhalten verknüpfbare Gattung, sondern eine ganz<br />
charakteristische Denkart im Hinblick auf den Verlauf der Geschichte.<br />
30 Eine solche Möglichkeit erwägen BEASLEY-MURRAY, Rev,33; BARRETT, John, 62.133f; BROWN, John I,<br />
cii.<br />
31 BEASLEY-MURRAY, Rev, 33f.<br />
32 In diese Richtung argumentiert Martin Hengel, Die johanneische Frage: Ein Lösungsversuch. Mit einem<br />
Beitrag zur. Apokalypse von Jörg Frey (WUNT 67), Tübingen: Mohr, 1993.<br />
33 Es handelt sich insg. um die folgenden Stellen: 1,1f.4.9f.12.17; 4,1f; 5,1f.4.6.11.13; 6,1-3.5-9.12;<br />
7,1f.4.9.14; 8,2.13; 9,1.13.16f; 10,1.4f.8-10; 12,10; 13,1f.11; 14,1f.6.13f; 15,1f.5; 16,1.5.7.13; 17,3.6; 18,1.4;<br />
19,1.6.10f.17.19; 20,1.4.11f; 21,1-3; 21,22; 22,8.<br />
34 Das vorangstellte hegẃ dient der Unterscheidung vom hegẃ Gottes in 1,8.<br />
35 Eine interessante Parallele zu dieser sehr flach hierarchischen Selbstbestimmung findet sich in 19,10. Der<br />
Engel, zu dessen Füßen Johannes niederrfällt, fordert ihn auf, Gott anzubeten, denn er selbst sei ja auch sein<br />
Mitknecht und der seiner Brüder, die an dem Zeugnis Jesu festhalten (súndoulóß soú ehimi kaì tẅn hadelfẅn<br />
[Vorlesungsmanuskript, nur für privaten Gebrauch]