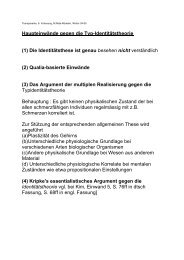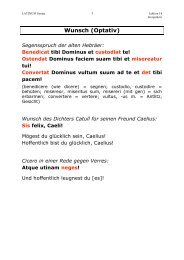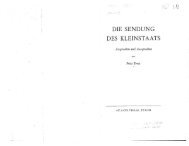NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
NTEX_FS10_Apk_Skript_Juni_03 - Commonweb
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
14 FS 2010, Bern (M. Mayordomo)<br />
c) Irenäus gibt in Adv. haer. V 30,3 (vgl. Eusebius, HE III 18,3; V 30,3) die Regierung<br />
Domitians als Datierung an:<br />
»Wenn es aber notwendig wäre in der jetzigen Zeit seinen Namen zu verkündigen, wäre es durch jenen<br />
gesagt worden, der die Offenbarung sah. Denn er/sie wurde vor nicht langer Zeit geschaut, sondern beinahe<br />
in unserer Generation, gegen Ende der Herrschaft Domitians.« (eig. Über.) [Griech.: e˙ dè ‘edei hanafandòn<br />
hen tẅ nün kairẅ kjrúttesqai to‘unoma ahutou, dih hekeínou ’an herréqj toü kaì t`jn hapokáluyin<br />
Heorakótoß. ohudè gàr prò polloü crónou Hewráqj 45 , hallà scedòn hepì t¨jß Hjmetéraß geneäß, prò`ß<br />
tẅ téĺei t¨jß Dometianoü harc¨jß.]<br />
Die Lektüre der Johannesoffenbarung aus dem Blickwinkel einer systematischen<br />
Verfolgung hat zwar eine lange Tradition, ist aber angesichts des Fehlens nicht-christlicher<br />
Quellen historisch fragwürdig.<br />
Die Weichen für das christliche Konstrukt einer domitianischen Verfolgung wurden von Irenäus gestellt, dem<br />
wir den Hinweis auf eine Entstehung der Schrift während der Regierungszeit Domitians verdanken (s.o.).<br />
Eusebius brachte den Stein ins Rollen, indem er uns – darin vielen antiken Historiographen folgend – einen<br />
Kaiser Domitian präsentiert, der in seiner brutalen und tyrannischen Verfolgung der Christen dem gefürchteten<br />
Nero in Nichts nachstand (Eusebius, HE III 17; 18, 4). Die spätere christliche Historiographie tat den Rest: So<br />
unterstellt Orosius (5. Jh) Domitian habe sich erdreistet »die im ganzen Erdkreis äußerst gefestigte Kirche<br />
Christi durch überallhin zum Zwecke einer grausamsten Verfolgung gesandte Edikte zu erschüttern« 46 . Bis zum<br />
Beginn des 20. Jh.s bildet die domitianische Verfolgung den Horizont für die Deutung der Offb. In der<br />
Aktualität wird eine domitianische Christenverfolgung, wenn überhaupt, nur noch sehr vereinzelt vertreten 47 .<br />
Das Fehlen nicht-christlicher Quellen und die Neubeurteilung der Gestalt Domitians und des<br />
Kaiserkults hat im Wesentlichen zu fünf Positionen geführt 48 :<br />
1. Es gab eine Verfolgung, auch wenn wir dafür nicht mit dem Zeugnis außerbiblischer Quellen rechnen<br />
können.<br />
2. Die Datierung der Offb muss in die Zeit der neronischen Verfolgung gelegt werden.<br />
3. Die Offb ist eher Ausdruck eines Traumas, das eine aktuelle Verfolgung zwar nicht voraussetzt, aber für<br />
die Zukunft befürchtet. Es muss also zwischen der objektiven Krise und der subjektiven Wahrnehmung<br />
unterschieden werden.<br />
4. Es gab keine äußere Krise, weder objektiv noch subjektiv. Christen wurden nicht ausgegrenzt und auch<br />
die Bedeutung des Herrscherkults ist übertrieben worden. Die leitende Motivation ist die Situation innerhalb der<br />
Gemeinde.<br />
5. Es gibt nur eine innere Krise, bei der im Wesentlichen der Autoritätskonflikt zwischen Johannes und<br />
seinem Prophetenzirkel und anderen christlichen Lehrern in den kleinasiatischen Gemeinden ausgehandelt wird.<br />
Nach dem Gesetz des Pendels wird derzeit verstärkt die These vertreten, die Offb sei in<br />
äußerlich ruhigen Zeiten entstanden und verdanke ihre Abfassung nur den<br />
innergemeindlichen Auseinandersetzungen zwischen Johannes und den sog. »Nikolaiten«<br />
(2,6.15).<br />
M.E. wird hier die Situation verharmlost:<br />
1. Die historische Situierung der Offb ist sicherlich allzu stark mit der umstrittenen Figur<br />
Domitians verknüpft worden. Auch wenn wir das stark ins Negative verflachte Domitianbild<br />
wenigstens von der Untat einer Christenverfolgung entlasten können, war seine<br />
Regierungszeit (81-96) keine Zeit der Entspannung und Ruhe, sie wird viel eher als eine Zeit<br />
der Angst in Erinnerung gehalten 49 .<br />
45 Das logische Subjekt von Hewráqj ist umstritten, da es sich auf t`jn hapokáluyin oder auf toü kaì t`jn<br />
hapokáluyin Heorakótoß beziehen kann<br />
46 Historia adv. paganus VII 10,1; übers. A. Lippold, BAW, 1986, II,159f.<br />
47 Vgl. bes. Marta SORDI, The Christians and the Roman Empire (London: Routledge, 1994) 43-54; Paul<br />
KERESZTES, »The Imperial Roman Government and the Christian Church. I. From Nero to the Severi«, ANRW<br />
II/23,1 (1979) 247-315:265-272 (der u.a. auch die Offb als Quelle auswertet!).<br />
48 Vgl. Paul B. DUFF, Who Rides the Beast? Prophetic Rivalry and the Rhetoric of Crisis in the Churches of<br />
the Apocalypse (Oxford University Press 2001) 5-10.<br />
49 Vgl. zum Folgenden Alfred KNEPPE, Metus temporum: Zur Bedeutung von Angst in Politik und<br />
Gesellschaft der römischen Kaiserzeit des 1. und 2. Jhdts. n. Chr. (Stuttgart: Franz Steiner, 1994) 182-186.<br />
[Vorlesungsmanuskript, nur für privaten Gebrauch]