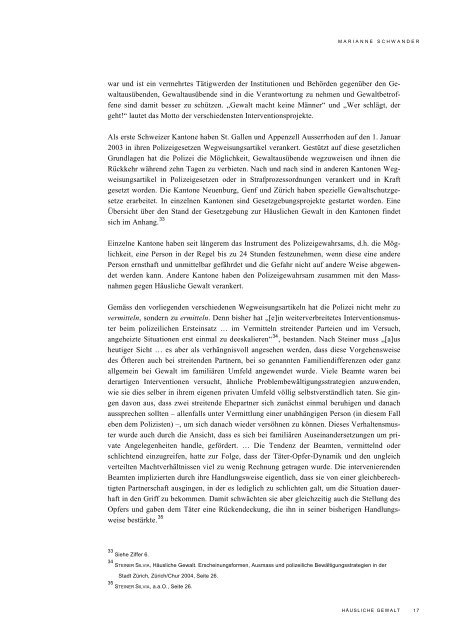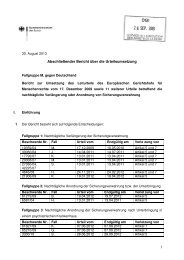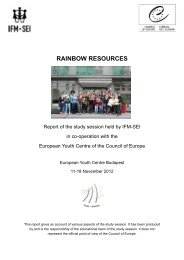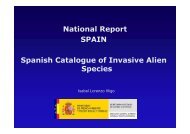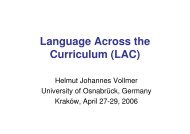Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MARIANNE SCHWANDER<br />
war und ist ein vermehrtes Tätigwerden der Institutionen und Behörden gegenüber den <strong>Gewalt</strong>ausübenden,<br />
<strong>Gewalt</strong>ausübende sind in <strong>die</strong> Verantwortung zu nehmen und <strong>Gewalt</strong>betroffene<br />
sind damit besser zu schützen. „<strong>Gewalt</strong> macht keine Männer“ und „Wer schlägt, der<br />
geht!“ lautet das Motto der verschiedensten Interventionsprojekte.<br />
Als erste Schweizer Kantone haben St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden auf den 1. Januar<br />
2003 in ihren Polizeigesetzen Wegweisungsartikel verankert. Gestützt auf <strong>die</strong>se gesetzlichen<br />
Grundlagen hat <strong>die</strong> Polizei <strong>die</strong> Möglichkeit, <strong>Gewalt</strong>ausübende wegzuweisen und ihnen <strong>die</strong><br />
Rückkehr während zehn Tagen zu verbieten. Nach und nach sind in anderen Kantonen Wegweisungsartikel<br />
in Polizeigesetzen oder in Strafprozessordnungen verankert und in Kraft<br />
gesetzt worden. Die Kantone Neuenburg, Genf und Zürich haben spezielle <strong>Gewalt</strong>schutzgesetze<br />
erarbeitet. In einzelnen Kantonen sind Gesetzgebungsprojekte gestartet worden. Eine<br />
Übersicht über den Stand der Gesetzgebung zur <strong>Häusliche</strong>n <strong>Gewalt</strong> in den Kantonen findet<br />
sich im Anhang. 33<br />
Einzelne Kantone haben seit längerem das Instrument des Polizeigewahrsams, d.h. <strong>die</strong> Möglichkeit,<br />
eine Person in der Regel bis zu 24 Stunden festzunehmen, wenn <strong>die</strong>se eine andere<br />
Person ernsthaft und unmittelbar gefährdet und <strong>die</strong> Gefahr nicht auf andere Weise abgewendet<br />
werden kann. Andere Kantone haben den Polizeigewahrsam zusammen mit den Massnahmen<br />
gegen <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong> verankert.<br />
Gemäss den vorliegenden verschiedenen Wegweisungsartikeln hat <strong>die</strong> Polizei nicht mehr zu<br />
vermitteln, sondern zu ermitteln. Denn bisher hat „[e]in weiterverbreitetes Interventionsmuster<br />
beim polizeilichen Ersteinsatz … im Vermitteln streitender Parteien und im Versuch,<br />
angeheizte Situationen erst einmal zu deeskalieren“ 34 , bestanden. Nach Steiner muss „[a]us<br />
heutiger Sicht … es aber als verhängnisvoll angesehen werden, dass <strong>die</strong>se Vorgehensweise<br />
des Öfteren auch bei streitenden Partnern, bei so genannten Familiendifferenzen oder ganz<br />
allgemein bei <strong>Gewalt</strong> im familiären Umfeld angewendet wurde. Viele Beamte waren bei<br />
derartigen Interventionen versucht, ähnliche Problembewältigungsstrategien anzuwenden,<br />
wie sie <strong>die</strong>s selber in ihrem eigenen privaten Umfeld völlig selbstverständlich taten. Sie gingen<br />
da<strong>von</strong> aus, dass zwei streitende Ehepartner sich zunächst einmal beruhigen und danach<br />
aussprechen sollten – allenfalls unter Vermittlung einer unabhängigen Person (in <strong>die</strong>sem Fall<br />
eben dem Polizisten) –, um sich danach wieder versöhnen zu können. Dieses Verhaltensmuster<br />
wurde auch durch <strong>die</strong> Ansicht, dass es sich bei familiären Auseinandersetzungen um private<br />
Angelegenheiten handle, gefördert. … Die Tendenz der Beamten, vermittelnd oder<br />
schlichtend einzugreifen, hatte zur Folge, dass der Täter-Opfer-Dynamik und den ungleich<br />
verteilten Machtverhältnissen viel zu wenig Rechnung getragen wurde. Die intervenierenden<br />
Beamten implizierten durch ihre Handlungsweise eigentlich, dass sie <strong>von</strong> einer gleichberechtigten<br />
Partnerschaft ausgingen, in der es lediglich zu schlichten galt, um <strong>die</strong> Situation dauerhaft<br />
in den Griff zu bekommen. Damit schwächten sie aber gleichzeitig auch <strong>die</strong> Stellung des<br />
Opfers und gaben dem Täter eine Rückendeckung, <strong>die</strong> ihn in seiner bisherigen Handlungsweise<br />
bestärkte. 35<br />
33 Siehe Ziffer 6.<br />
34 STEINER SILVIA, <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong>. Erscheinungsformen, Ausmass und polizeiliche Bewältigungsstrategien in der<br />
Stadt Zürich, Zürich/Chur 2004, Seite 26.<br />
35 STEINER SILVIA, a.a.O., Seite 26.<br />
HÄUSLICHE GEWALT 17