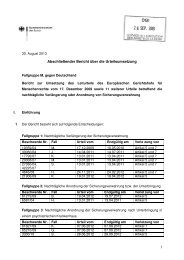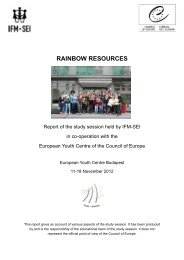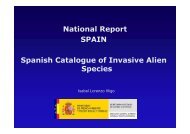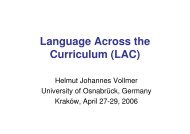Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Häusliche Gewalt - Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MARIANNE SCHWANDER<br />
3 RECHTLICHE KLÄRUNGEN<br />
3.1 BUND UND KANTONE<br />
In den letzten Jahren sind Massnahmen gegen <strong>Häusliche</strong> <strong>Gewalt</strong> in den Kantonen gesetzlich<br />
verankert worden. Auf Bundesebene ist am 1. April 2005 <strong>die</strong> Änderung des Strafgesetzbuches<br />
betreffend Strafverfolgung in der Ehe und in der Partnerschaft (sogenannte Offizialisierung)<br />
in Kraft getreten; zudem haben <strong>die</strong> Eidgenössischen Räte in der Sommersession 2006<br />
<strong>die</strong> Änderung der Bestimmungen zum Schutz der Persönlichkeit gegen <strong>Gewalt</strong>, Drohungen<br />
oder Nachstellungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches verabschiedet. Des Weiteren<br />
wird das Strafprozessrecht vereinheitlicht werden.<br />
In <strong>die</strong>sem Zusammenhang stellt sich <strong>die</strong> Frage, wie das Verhältnis der verschiedenen Gesetzgebungen<br />
respektive der Rechtsordnungen <strong>von</strong> Bund und Kantonen ist.<br />
3.1.1 VORBEMERKUNG<br />
Der Bund und <strong>die</strong> 26 Kantone bilden je vollständig organisierte Rechtsordnungen, sie haben<br />
je eine Verfassung, Gesetze und Verordnungen als geschriebene Rechtsquellen. Die Zuständigkeit<br />
des Bundes ergibt sich aus der Bundesverfassung und zwar aus Artikel 3 BV. Dieser<br />
Artikel 3 BV regelt das System der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen und zwar<br />
dahingehend, dass „[d]ie Kantone … souverän [sind], soweit ihre Souveränität nicht durch<br />
<strong>die</strong> Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, <strong>die</strong> nicht dem Bund übertragen<br />
sind.“ Der Bund darf daher Aufgaben einzig gestützt auf konkrete Einzelermächtigungen in<br />
der Bundesverfassung übernehmen. Für alle anderen Aufgaben bleiben <strong>die</strong> Kantone zuständig.<br />
Artikel 3 BV begründet daher eine subsidiäre Generalkompetenz der Kantone und sorgt<br />
<strong>für</strong> eine lückenlose Kompetenzordnung, weil sämtliche Staatsaufgaben, <strong>die</strong> nicht dem Bund<br />
übertragen sind, den Kantonen zufallen. 53<br />
Im Verhältnis zu den Kantonen ergibt sich folgende Typologie der Kompetenzverteilung 54 :<br />
• Ausschliessliche Kompetenz des Bundes: Der Bund ist ausschliesslich und abschliessend<br />
zum Erlass <strong>von</strong> Rechtssätzen zuständig; <strong>für</strong> kantonale Regelungen bleibt kein<br />
Raum.<br />
• Konkurrierende Kompetenz: Die Kantone bleiben zur Regelung zuständig, bis und soweit<br />
der Bund <strong>von</strong> seiner Kompetenz Gebrauch macht. Der Bund ist auch hier grundsätzlich<br />
zur umfassenden und abschliessenden Regelung befugt. Das Bundesrecht hat<br />
nachträgliche derogatorische Kraft. 55<br />
53 Zur Kompetenzverteilung siehe grundsätzlich TSCHANNEN PIERRE, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft,<br />
Bern 2004, § 19, Rz. 1 ff.; KETTIGER DANIEL, Typologie der schweizerischen Erlasse, in: Forum <strong>für</strong> juristische<br />
Bildung, ius.full Nr. 1/05, Seite 42 f.<br />
54 Siehe SCHWEIZER RAINER J., St. Galler Kommentar zu Artikel 3 BV, Rz. 10 ff.<br />
55 Das bedeute nach TSCHANNEN PIERRE, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2004, § 20, Rz. 28,<br />
zweierlei: „Das kantonale Recht tritt erst mit dem Erlass der eidgenössischen Ausführungsgesetzgebung des Bun-<br />
HÄUSLICHE GEWALT 21