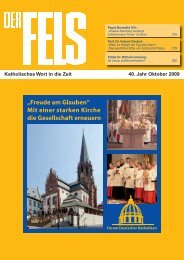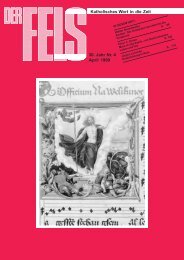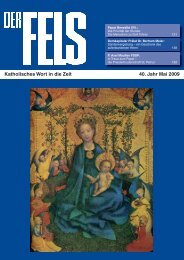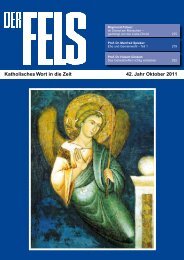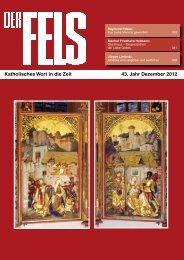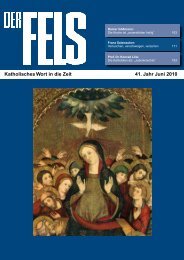Fortsetzung folgt - Der Fels
Fortsetzung folgt - Der Fels
Fortsetzung folgt - Der Fels
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BÜCHER<br />
Ulrich Nersinger: Soldaten des Papstes<br />
- Eine kleine Geschichte der päpstlichen<br />
Garden, Mayer und Comp. Verlag,<br />
Klosterneuburg- W, ÖS 70/ DM 10.-<br />
Bestelladresse für Deutschland: U.<br />
Nersinger, Laurenzberger Weg 5, D-<br />
52249 Eschweiler.<br />
Dem Rombesucher und dem Zuschauer<br />
von Fernsehsendungen zu Großveranstaltungen<br />
auf dem Petersplatz<br />
oder in der Peterskirche sind die farbenfroh<br />
gekleideten Soldaten des Papstes<br />
wohl vertraut. Aber nicht jeder weiß, daß<br />
dazu einmal neben der päpstlichen Gendarmerie,<br />
die Nobelgarde, die Schweizergarde<br />
und die Palatingarde gehörten,<br />
von denen die Palatin- und die Nobelgarde<br />
sowie die Gendarmerie von Papst<br />
Paul VI. 1970 aufgelöst wurden. Kaum<br />
bekannt sind Geschichte, Organisation<br />
und die spezifischen Aufgaben der päpstlichen<br />
Corps. Ulrich Nersinger, Chorherr<br />
des Stiftes Klosterneuburg und Experte<br />
für vatikanische Interna, beschreibt diese<br />
in einer kleinen Schrift mit dem Titel<br />
„Soldaten des Papstes - eine kleine Geschichte<br />
der päpstlichen Garden“.<br />
Hubert Gindert<br />
Roman Morandell: Morgenpsalm<br />
des Lebens - Skizzen und Erinnerungen,<br />
Christiana-Verlag,1996, DM 19,80,<br />
öS 164, sF 18,00.<br />
Das Leben und die Entwicklung des<br />
Künstlers und Priesterdichters Roman<br />
Morandell in einer Abfolge von kurzen<br />
Episoden.<br />
Die Kindheit in Südtirol und die<br />
Schuljahre in Salzburg bilden den<br />
Schwerpunkt der Schilderungen. Morandell<br />
erzählt in einer kraftvoll-eleganten<br />
Sprache. Die Texte sind illustriert mit<br />
feingeritzten Bildern in Schwarzweiß. Es<br />
ist kein nostalgischer Rückblick. Das<br />
ganze Spiel des Lebens mit Freude, Leid<br />
und Düsternis zieht vorbei. Es mündet<br />
mit Dank und Vertrauen in Gott ein mit<br />
einen Lobgesang auf den Herrn bereit für<br />
das Finale des Lebens. Eine lesenswerte<br />
Lektüre!<br />
Hubert Gindert<br />
Stefan Heid, Zölibat in der frühen<br />
Kirche. Die Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht<br />
für Kleriker in Ost<br />
und West; Schöningh-Verlag, Paderborn<br />
1997, 339 Seiten, DM 39,80, ISBN 3-<br />
506-73926-3.<br />
Manchem Leser dürfte das glänzende<br />
Büchlein des Kurienkardinals Alfons M.<br />
Stickler zum Zölibat bekannt sein (<strong>Der</strong><br />
Klerikerzölibat, Kral-Verlag, Abernsberg<br />
1993). Wer es gelesen hat, weiß, daß<br />
in letzter Zeit einige neue Erkenntnisse<br />
über die geschichtlichen Wurzeln des<br />
Zölibats ans Licht kamen. Demnach hat<br />
es eine Art Zölibat eben doch schon von<br />
Anfang an in der Kirche gegeben. Nun<br />
ist im Schöningh-Verlag von dem Kirchenhistoriker<br />
Stefan Heid ein beachtliches<br />
Werk zu diesem Thema vorgelegt<br />
worden. Kurz gesagt, kann Heid die Behauptungen<br />
des Kardinals für die frühe<br />
Kirche vollauf bestätigen. Es gab zwar<br />
neben den unverheirateten auch verheiratete<br />
Kleriker. Aber vieles spricht dafür,<br />
daß alle Kleriker vom Tag ihrer Weihe an<br />
in völliger geschlechtlicher Enthaltsamkeit<br />
leben mußten. Verheiratete Diakone,<br />
Priester und Bischöfe mußten also eine<br />
Josefsehe führen. Die vielen verheirateten<br />
Priester in der frühen Kirche sind<br />
demnach kein Argument gegen den heutigen<br />
Zölibat.<br />
Wenn man das liest, braucht man sich<br />
nicht mehr zu wundern, daß Bücher in<br />
französischer und englischer Sprache,<br />
die vor einer Reihe von Jahren zu ähnlichen<br />
Resultaten geführt haben, in der<br />
deutschen Theologie bisher fast völlig<br />
unbeachtet geblieben sind. Heid kann<br />
hier nur an Stickler anknüpfen (S. 17).<br />
Ein frühkirchlicher „Enthaltsamkeitszölibat“<br />
paßt nicht gut zu der Sprachregelung,<br />
an die man sich gewöhnt hat,<br />
wonach der Zölibat eine recht späte Sache<br />
sei und deshalb im Grunde genommen<br />
jederzeit wieder abgeschafft werden<br />
könne. Jetzt muß man doch eher sagen,<br />
daß der Zölibat wirklich bis ins Neue Testament<br />
selbst hineinreichen dürfte.<br />
Aber damit nicht genug. <strong>Der</strong> in<br />
Zölibatsdiskussionen Gestählte weiß,<br />
daß man sich regelmäßig auf das erste<br />
ökumenische Konzil von Nizäa beruft,<br />
wenn es darum geht, gegen den Zölibat<br />
Front zu machen. Alle Teilnehmer hätten<br />
sich dort gegen eine Enthaltsamkeit für<br />
Kleriker ausgesprochen. Ausgerechnet<br />
von vielen Kirchenhistorikern, die es<br />
doch eigentlich besser wissen müßten,<br />
wird nach wie vor diese Episode, die mit<br />
dem Namen des Bischofs Pafnutius verbunden<br />
ist, für bare Münze genommen.<br />
Bei Heid liest man dagegen gleich eingangs,<br />
daß diese Episode seit nun schon<br />
dreißig Jahren von einem damals noch<br />
Ostberliner Experten ins Reich der Legende<br />
verwiesen wurde (S. 13 - 16).<br />
Nach diesem Einstieg geht dann Heid<br />
in sechs langen Kapiteln, angefangen<br />
von Jesus Christus, die ganze Kirchengeschichte<br />
bis zum 7. Jahrhundert durch.<br />
Hier ist nicht der Ort, auch nur die wichtigsten<br />
Ergebnisse zu referieren.<br />
Allgemein kann man sagen, daß Heid<br />
sorgfältig alle lateinischen und griechischen<br />
Texte der damaligen Bischöfe und<br />
Theologen untersucht (immer in deutscher<br />
Übersetzung). Daraus ergeben sich<br />
dann interessante Einblicke in die Situation<br />
des Zölibats in Nordafrika, Italien,<br />
Frankreich und Spanien und auch im<br />
Osten (Ägypten, Palästina, Türkei). Viele<br />
Texte, die scheinbar gegen einen Zölibat<br />
zu sprechen scheinen, erhalten einen<br />
ganz neuen Sinn.<br />
Besonders wichtig ist dabei der erste<br />
Timotheusbrief. Danach darf keiner Kleriker<br />
werden, der bereits das zweite Mal<br />
verheiratet ist (1. Timotheusbrief 3,2). In<br />
einer minutiösen Analyse zeigt Heid, daß<br />
hier keine Heiratspflicht ausgesprochen<br />
wird (S. 36 - 49). Man ging vielmehr<br />
wohl davon aus, daß ein zweimal Verheirateter<br />
durch seine zweite Heirat bewiesen<br />
habe, daß er nicht enthaltsam leben<br />
könne (sonst hätte er eben nicht wieder<br />
geheiratet). Wenn Timotheus also keinen<br />
weihen soll, der nicht enthaltsam leben<br />
kann, dann heißt das doch, daß der Betroffene<br />
nach seiner Weihe enthaltsam<br />
sein mußte, wie das schon das Neue Testament<br />
bezeugt. Wie kann man noch behaupten,<br />
der Zölibat sei nur eine kirchliche<br />
Regelung ohne jede biblische Rechtfertigung<br />
und könne deshalb jederzeit<br />
fallen?<br />
Interessant ist, daß Heid besonders<br />
auch zölibatskritische Literatur zu Rate<br />
gezogen hat. Gegenmeinungen kommen<br />
jedenfalls oft zu Wort, werden aber in aller<br />
Nüchternheit und Sachlichkeit widerlegt.<br />
Das ist überhaupt ein Vorteil von<br />
Heid, daß er immer wieder deutlich markiert,<br />
wo die gängige Meinung über den<br />
Zölibat aus seiner Sicht nicht stimmen<br />
kann. Die Fülle des geschichtlichen Materials<br />
und der vielfältigen Querverbindungen,<br />
die er zu ziehen versteht und<br />
durch die er immer wieder die Augen für<br />
den Sinn des Ganzen öffnet, hat eine große<br />
Überzeugungskraft.<br />
Wer sich vollständig über den Zölibat<br />
in der frühen Kirche informieren will,<br />
kann am Buch Heid nicht mehr vorbeigehen.<br />
Ich möchte es zur Lektüre empfehlen,<br />
weil es einfach ein schön gestaltetes<br />
Buch ist, das auch Nichtfachleute<br />
mit viel Gewinn lesen können, weil es<br />
eine klare Sprache hat und ohne professorale<br />
Allüren auskommt. Noch dazu erleichtern<br />
es die jeweiligen Kapitelzusammenfassungen,<br />
vielleicht Vergessenes<br />
zu wiederholen oder sich einen<br />
schnellen Überblick zu verschaffen. <strong>Der</strong><br />
Leser mache sich auf einen spannenden<br />
Durchgang durch die frühe Kirche gefaßt!<br />
Prof. Dr. Walter Brandmüller<br />
Jesus Christus - Wort des Vaters,<br />
Theologisch-Historische Kommission<br />
für das Heilige Jahr 2000 (Hrsg.), Verlag<br />
Schnell & Steiner, Regensburg 1997,<br />
187 S., DM 19.80<br />
Jesus Christus ist das Jahresthema<br />
1997 in der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr<br />
2000. In der Weltkirche, in den<br />
Diözesen, Pfarreien und allen Gemeinschaften<br />
der katholischen Kirche soll Jesus<br />
Christus Gestalt gewinnen. Im Vorwort<br />
des o.g. Buches schreibt Kardinal<br />
Roger Etchegaray: „Die Katechese die-<br />
DER FELS 7-8/1997 235