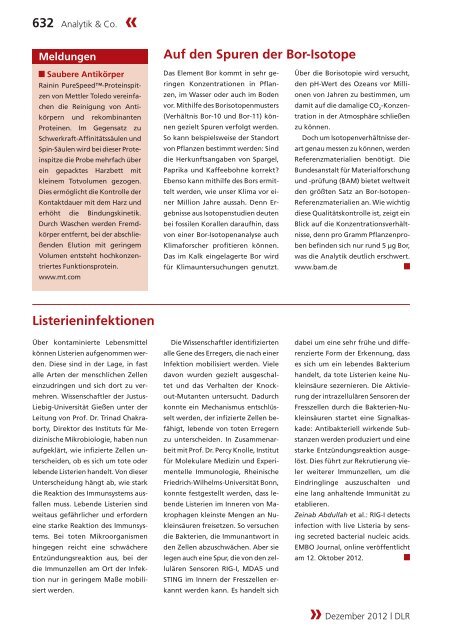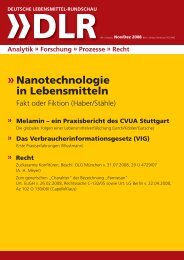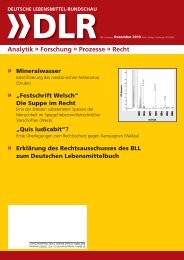Der GMOfinder - DLR Online: Deutsche Lebensmittel Rundschau
Der GMOfinder - DLR Online: Deutsche Lebensmittel Rundschau
Der GMOfinder - DLR Online: Deutsche Lebensmittel Rundschau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
632 Analytik & Co. «<br />
Meldungen<br />
Auf den Spuren der Bor-Isotope<br />
Saubere Antikörper<br />
Rainin PureSpeed-Proteinspitzen<br />
von Mettler Toledo vereinfachen<br />
die Reinigung von Antikörpern<br />
und rekombinanten<br />
Proteinen. Im Gegensatz zu<br />
Schwerkraft-Affinitätssäulen und<br />
Spin-Säulen wird bei dieser Proteinspitze<br />
die Probe mehrfach über<br />
ein gepacktes Harzbett mit<br />
kleinem Totvolumen gezogen.<br />
Dies ermöglicht die Kontrolle der<br />
Kontaktdauer mit dem Harz und<br />
erhöht die Bindungskinetik.<br />
Durch Waschen werden Fremdkörper<br />
entfernt, bei der abschließenden<br />
Elution mit geringem<br />
Volumen entsteht hochkonzentriertes<br />
Funktionsprotein.<br />
www.mt.com<br />
Das Element Bor kommt in sehr geringen<br />
Konzentrationen in Pflanzen,<br />
im Wasser oder auch im Boden<br />
vor. Mithilfe des Borisotopenmusters<br />
(Verhältnis Bor-10 und Bor-11) können<br />
gezielt Spuren verfolgt werden.<br />
So kann beispielsweise der Standort<br />
von Pflanzen bestimmt werden: Sind<br />
die Herkunftsangaben von Spargel,<br />
Paprika und Kaffeebohne korrekt?<br />
Ebenso kann mithilfe des Bors ermittelt<br />
werden, wie unser Klima vor einer<br />
Million Jahre aussah. Denn Ergebnisse<br />
aus Isotopenstudien deuten<br />
bei fossilen Korallen daraufhin, dass<br />
von einer Bor-Isotopenanalyse auch<br />
Klimaforscher profitieren können.<br />
Das im Kalk eingelagerte Bor wird<br />
für Klimauntersuchungen genutzt.<br />
Über die Borisotopie wird versucht,<br />
den pH-Wert des Ozeans vor Millionen<br />
von Jahren zu bestimmen, um<br />
damit auf die damalige CO 2<br />
-Konzentration<br />
in der Atmosphäre schließen<br />
zu können.<br />
Doch um Isotopenverhältnisse derart<br />
genau messen zu können, werden<br />
Referenzmaterialien benötigt. Die<br />
Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM) bietet weltweit<br />
den größten Satz an Bor-Isotopen-<br />
Referenzmaterialien an. Wie wichtig<br />
diese Qualitätskontrolle ist, zeigt ein<br />
Blick auf die Konzentrationsverhältnisse,<br />
denn pro Gramm Pflanzenproben<br />
befinden sich nur rund 5 µg Bor,<br />
was die Analytik deutlich erschwert.<br />
www.bam.de<br />
Listerieninfektionen<br />
Über kontaminierte <strong>Lebensmittel</strong><br />
können Listerien aufgenommen werden.<br />
Diese sind in der Lage, in fast<br />
alle Arten der menschlichen Zellen<br />
einzudringen und sich dort zu vermehren.<br />
Wissenschaftler der Justus-<br />
Liebig-Universität Gießen unter der<br />
Leitung von Prof. Dr. Trinad Chakraborty,<br />
Direktor des Instituts für Medizinische<br />
Mikrobiologie, haben nun<br />
aufgeklärt, wie infizierte Zellen unterscheiden,<br />
ob es sich um tote oder<br />
lebende Listerien handelt. Von dieser<br />
Unterscheidung hängt ab, wie stark<br />
die Reaktion des Immunsystems ausfallen<br />
muss. Lebende Listerien sind<br />
weitaus gefährlicher und erfordern<br />
eine starke Reaktion des Immunsystems.<br />
Bei toten Mikroorganismen<br />
hingegen reicht eine schwächere<br />
Entzündungsreaktion aus, bei der<br />
die Immunzellen am Ort der Infektion<br />
nur in geringem Maße mobilisiert<br />
werden.<br />
Die Wissenschaftler identifizierten<br />
alle Gene des Erregers, die nach einer<br />
Infektion mobilisiert werden. Viele<br />
davon wurden gezielt ausgeschaltet<br />
und das Verhalten der Knockout-Mutanten<br />
untersucht. Dadurch<br />
konnte ein Mechanismus entschlüsselt<br />
werden, der infizierte Zellen befähigt,<br />
lebende von toten Erregern<br />
zu unterscheiden. In Zusammenarbeit<br />
mit Prof. Dr. Percy Knolle, Institut<br />
für Molekulare Medizin und Experimentelle<br />
Immunologie, Rheinische<br />
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,<br />
konnte festgestellt werden, dass lebende<br />
Listerien im Inneren von Makrophagen<br />
kleinste Mengen an Nukleinsäuren<br />
freisetzen. So versuchen<br />
die Bakterien, die Immunantwort in<br />
den Zellen abzuschwächen. Aber sie<br />
legen auch eine Spur, die von den zellulären<br />
Sensoren RIG-I, MDA5 und<br />
STING im Innern der Fresszellen erkannt<br />
werden kann. Es handelt sich<br />
dabei um eine sehr frühe und differenzierte<br />
Form der Erkennung, dass<br />
es sich um ein lebendes Bakterium<br />
handelt, da tote Listerien keine Nukleinsäure<br />
sezernieren. Die Aktivierung<br />
der intrazellulären Sensoren der<br />
Fresszellen durch die Bakterien-Nukleinsäuren<br />
startet eine Signalkaskade:<br />
Antibakteriell wirkende Substanzen<br />
werden produziert und eine<br />
starke Entzündungsreaktion ausgelöst.<br />
Dies führt zur Rekrutierung vieler<br />
weiterer Immunzellen, um die<br />
Eindringlinge auszuschalten und<br />
eine lang anhaltende Immunität zu<br />
etablieren.<br />
Zeinab Abdullah et al.: RIG-I detects<br />
infection with live Listeria by sensing<br />
secreted bacterial nucleic acids.<br />
EMBO Journal, online veröffentlicht<br />
am 12. Oktober 2012.<br />
» Dezember 2012 | <strong>DLR</strong>