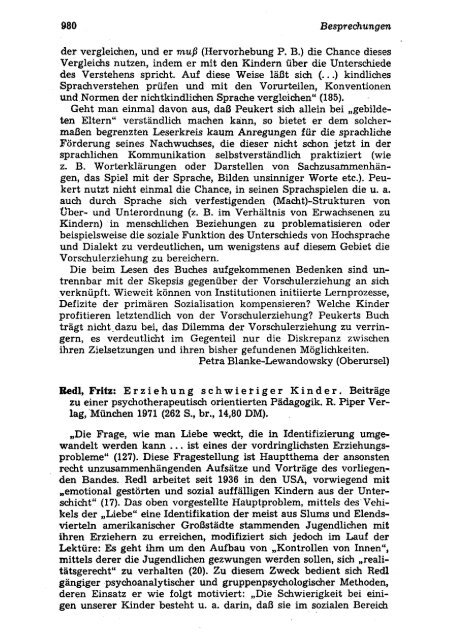Das Argument 88 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 88 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 88 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
980 Besprechungen<br />
der vergleichen, und er muß (Hervorhebung P. B.) die Chance dieses<br />
Vergleichs nutzen, indem er mit den Kindern über die Unterschiede<br />
des Verstehens spricht. Auf diese Weise läßt sich (...) kindliches<br />
Sprachverstehen prüfen und mit den Vorurteilen, Konventionen<br />
lind Normen der nichtkindlichen Sprache vergleichen" (185).<br />
Geht man einmal davon aus, daß Peukert sich allein bei „gebildeten<br />
Eltern" verständlich machen kann, so bietet er dem solchermaßen<br />
begrenzten Leserkreis kaum Anregungen für die sprachliche<br />
Förderung seines Nachwuchses, die dieser nicht schon jetzt in der<br />
sprachlichen Kommunikation selbstverständlich praktiziert (wie<br />
z. B. Worterklärungen oder Darstellen von Sachzusammenhängen,<br />
das Spiel mit der Sprache, Bilden unsinniger Worte etc.). Peukert<br />
nutzt nicht einmal die Chance, in seinen Sprachspielen die u. a.<br />
auch durch Sprache sich verfestigenden (Macht)-Strukturen von<br />
Über- und Unterordnung (z. B. im Verhältnis von Erwachsenen zu<br />
Kindern) in menschlichen Beziehungen zu problematisieren oder<br />
beispielsweise die soziale Funktion des Unterschieds von Hochsprache<br />
und Dialekt zu verdeutlichen, um wenigstens auf diesem Gebiet die<br />
Vorschulerziehung zu bereichern.<br />
Die beim Lesen des Buches aufgekommenen Bedenken sind untrennbar<br />
mit der Skepsis gegenüber der Vorschulerziehung an sich<br />
verknüpft. Wieweit können von <strong>Institut</strong>ionen initiierte Lernprozesse,<br />
Defizite der primären Sozialisation kompensieren? Welche Kinder<br />
profitieren letztendlich von der Vorschulerziehung? Peukerts Buch<br />
trägt nicht, dazu bei, das Dilemma der Vorschulerziehung zu verringern,<br />
es verdeutlicht im Gegenteil nur die Diskrepanz zwischen<br />
ihren Zielsetzungen und ihren bisher gefundenen Möglichkeiten.<br />
Petra Blanke-Lewandowsky (Oberursel)<br />
Redl, Fritz: Erziehung schwieriger Kinder. Beiträge<br />
zu einer psychotherapeutisch orientierten Pädagogik. R. Piper Verlag,<br />
München 1971 (262 S., br., 14,80 DM).<br />
„Die Frage, wie man Liebe weckt, die in Identifizierung umgewandelt<br />
werden kann ... ist eines der vordringlichsten Erziehungsprobleme"<br />
(127). Diese Fragestellung ist Hauptthema der ansonsten<br />
recht unzusammenhängenden Aufsätze und Vorträge des vorliegenden<br />
Bandes. Redl arbeitet seit 1936 in den USA, vorwiegend mit<br />
„emotional gestörten und sozial auffälligen Kindern aus der Unterschicht"<br />
(17). <strong>Das</strong> oben vorgestellte Hauptproblem, mittels des Vehikels<br />
der „Liebe" eine Identifikation der meist aus Slums und Elendsvierteln<br />
amerikanischer Großstädte stammenden Jugendlichen mit<br />
ihren Erziehern zu erreichen, modifiziert sich jedoch im Lauf der<br />
Lektüre: Es geht ihm um den Aufbau von „Kontrollen von Innen",<br />
mittels derer die Jugendlichen gezwungen werden sollen, sich „realitätsgerecht"<br />
zu verhalten (20). Zu diesem Zweck bedient sich Redl<br />
gängiger psychoanalytischer und gruppenpsychologischer Methoden,<br />
deren Einsatz er wie folgt motiviert: „Die Schwierigkeit bei einigen<br />
unserer Kinder besteht u. a. darin, daß sie im sozialen Bereich