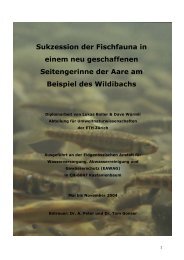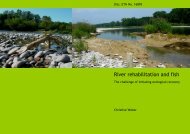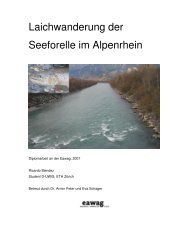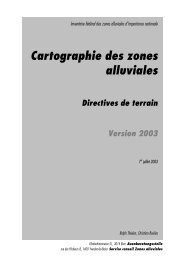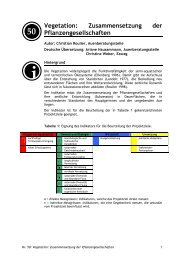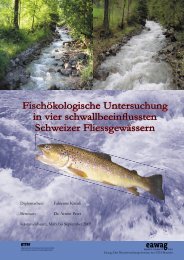Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Untersucht wurden historische und aktuelle<br />
Abflussdaten der Landeshydrologie<br />
(www.bwg.admin.ch ) von Porte de Scex<br />
(1907, 1998-2003), Branson und Sion (jeweils<br />
1998-2003). Zusätzlich zu den Abflussdaten<br />
wurden die Kenngrössen der<br />
Wasserkraftanlagen zusammengestellt. Es<br />
handelt sich dabei um Daten der Dienstelle<br />
für Wasserkraft des Kantons Wallis<br />
(www.vs.ch ).<br />
2.1.2 Rückhaltevolumen der Speicher und<br />
Ausbauwassermengen der Kraftwerke<br />
Der Kraftwerksbau an der <strong>Rhone</strong> begann im<br />
Jahre 1902 mit der Zentrale in Vouvry. Bis<br />
1950 blieb die Wassernutzung zur Elektrizitätsproduktion<br />
bescheiden. Von 1951 bis<br />
1975 wurden die meisten der grossen Speicher<br />
und leistungsstarken<br />
Zentralen realisiert<br />
und in Betrieb genommen.<br />
Nach 1975 erfolgten<br />
noch der Bau und<br />
die Anpassung einiger<br />
weniger Zentralen. Diese<br />
Entwicklung ist exemplarisch<br />
am Beispiel<br />
der kumulierten Speicherkapazität<br />
der Stauseen<br />
dargestellt (Abbildung<br />
9), wobei in drei<br />
Perioden aufgeteilt<br />
werden kann: vor<br />
(1905-1950), während<br />
(1951-1975) und nach<br />
dem stärksten Ausbau<br />
der Speicherkraftwerke<br />
(ab 1976).<br />
2.1.3 Pardékoeffizienten<br />
Abbildung 9: Entwicklung der Speicherkapazität der Stauseen im Wallis. Daten:<br />
Schweizerisches Talsperrenkomittee (www.swissdams.ch).<br />
Das Jahresabflussregime eines Gewässers<br />
kann durch die Pardékoeffizienten (PK) charakterisiert<br />
werden, welche das Verhältnis<br />
der mittleren Monatsabflüsse zum mittleren<br />
Jahresabfluss und damit die Verteilung des<br />
Abflusses innerhalb des Jahres beschreiben.<br />
Die über die drei Perioden gemittelten<br />
Pardékoeffizienten in Porte du Scex zeigen<br />
die deutliche Veränderung<br />
des Jahresabflussregimes<br />
durch den Kraftwerksbau<br />
auf (Abbildung<br />
10). Gemessen<br />
an Pardékoeffizienten<br />
aus<br />
hydrologisch unbeeinflussten<br />
Einzugsgebieten<br />
war<br />
das Abflussregime<br />
der <strong>Rhone</strong> in Porte<br />
du Scex früher vom<br />
Typ "Glacio-nival<br />
(b)" bis "Nivo-glaciaire"<br />
(Weingartner<br />
und Aschwanden,<br />
1992). Heute ist<br />
das Abflussregime<br />
am selben Ort vom<br />
Typ "Nival de transition"<br />
bis "Nivopluvial<br />
préalpin".<br />
Das bedeutet,<br />
dass mehr Wasser im Winter- und weniger<br />
im Sommerhalbjahr abfliesst.<br />
Das in den Winter hinübergeführte Wasser<br />
wird zwischenzeitlich in den Walliser Stauseen<br />
gespeichert, welche gesamthaft ein<br />
Nutzvolumen von 120 Mio. m 3<br />
aufweisen.<br />
Ein Teil der Verschiebung ist aber auch kli-<br />
Abbildung 10: Gemittelte Pardékoeffizienten in Porte du Scex. Blaue Linie:<br />
1905-1950 (vor Ausbau der Kraftwerke). Orange Linie: 1951-1975. Rote Linie:<br />
1976-2003 (nach Ausbau der Kraftwerke).<br />
RHONE-THUR PROJEKT <strong>Synthesebericht</strong> <strong>Schwall</strong>/<strong>Sunk</strong> Seite 19