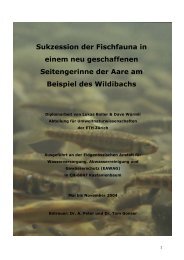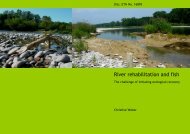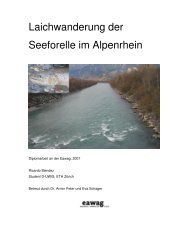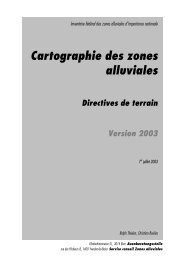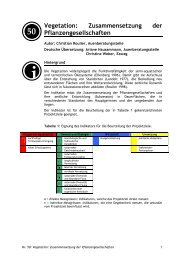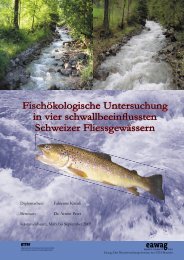Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Synthesebericht Schwall/Sunk - Rhone-Thur Projekt - Eawag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ten Schwebstoffe mitführt (Baumann und<br />
Klaus, 2003). Auf diese Weise nimmt die<br />
Gesamtfracht an Schwebstoffen im Winter<br />
deutlich zu, über das gesamte Jahr betrachtet<br />
wegen des zusätzlichen Rückhaltes in<br />
den Speichern hingegen ab (Portmann et<br />
al., 2004).<br />
Bei der Exfiltration von Grundwasser ins<br />
Gewässer hinein kann sich eine innere Kolmation<br />
nicht entwickeln, und bei klarem Abfluss<br />
wird die Kolmations-Entwicklung verzögert.<br />
Bei infiltrierenden Bedingungen hingegen<br />
gelangen die Feinpartikel in den Lükkenraum<br />
unter der Deckschicht, wo sie ausfiltriert<br />
und abgelagert werden (Banscher,<br />
1975; Schälchli, 2002). Da mit zunehmender<br />
Selbstdichtung die Austauschrate zwischen<br />
Oberflächengewässer und Grundwasser<br />
zurückgeht, stellt die Kolmation der<br />
Gewässersohle auch dort ein Problem dar,<br />
wo Trinkwasser aus Uferfiltrat gewonnen<br />
wird (Gutknecht et al., 1998; Regli et al.,<br />
2004) oder ufernahe Kunstbauten vor einer<br />
Veränderung des Grundwasserspiegels geschützt<br />
werden müssen (Banscher, 1975;<br />
Greco, 2001).<br />
Verschiedene Autoren zeigen auf, dass insbesondere<br />
anthropogen beeinflusste Flüsse<br />
stark zur Kolmation neigen (Bardossy und<br />
Molnar, 2004; Mürle et al., 2003). So kann<br />
der winterliche <strong>Schwall</strong>betrieb die Kolmation<br />
verstärken, indem bei <strong>Schwall</strong> mehr Feinmaterial<br />
(Trübung) in das Substrat eingetragen<br />
und die Sedimentoberfläche bei den höheren<br />
<strong>Schwall</strong>abflüssen mechanisch stärker<br />
beansprucht wird (Vibrationseffekt). Demgegenüber<br />
führt eine über das kritische Mass<br />
hinausgehende Erhöhung der Fliessgeschwindigkeit<br />
zu Erosionserscheinungen<br />
und schliesslich zu einem Aufreissen der<br />
Sohle, wodurch das eingelagerte Feinsediment<br />
wieder ausgespült wird (Dekolmation;<br />
Cunningham et al., 1987; Schälchli, 1993).<br />
Trübung und Kolmation sind in Alpenflüssen<br />
wichtige Steuergrössen für die abiotischen<br />
und biotischen Verhältnisse im Gewässer<br />
(Kapitel 2.5.3 und 2.5.4).<br />
1.2.3 <strong>Schwall</strong> und <strong>Sunk</strong> bei Fliessgewässer-Revitalisierungen<br />
Konzept der Gewässergüte-Isolinien<br />
Das Konzept der Gewässergüte-Isolinien<br />
wurde im Rahmen des <strong>Rhone</strong>-<strong>Thur</strong> <strong>Projekt</strong>es<br />
entwickelt und erstmals an der Veranstaltung<br />
"Atelier des projets Rhône-<strong>Thur</strong> et<br />
3e Correction du Rhône" vom 29./30 November<br />
2004 unter dem Namen "Courbes<br />
d'isosanté" vorgestellt.<br />
Betrachtet man die Wasserqualität eines<br />
Fliessgewässers als gegeben, kann der<br />
Fliessgewässerzustand als Funktion der<br />
Morphologie und des Abflussregimes beschrieben<br />
werden (Abbildung 1). Durch die<br />
Begradigung respektive den Kraftwerksbau<br />
wurden die Fliessgewässer beeinträchtigt.<br />
Dabei muss die morphologische und hydrologische<br />
Beeinträchtigung (Abflussregime)<br />
nicht zwingend simultan erfolgt sein Abbildung<br />
3 oben). Im Morphologie-Abflussregime-Diagramm<br />
können Kurven von gleicher<br />
Gewässerqualität definiert werden (Gewässergüte-Isolinien).<br />
Die zwei Achsen mit 0%<br />
natürlicher Morphologie bzw. 0% natürlichem<br />
Abflussregime stehen für die hypothetischen<br />
Gewässer, die keinerlei ökologische<br />
Qualität aufweisen. Dazwischen sind die<br />
Gewässergüte-Isolinien ungefähr gemäss<br />
Abbildung 3 Mitte gegeben.<br />
Abbildung 2: Oben: unkolmatiertes Ufer der Töss<br />
(Bild aus Schälchli, 2002; Wiedergabe mit Erlaubnis).<br />
Unten: stark kolmatiertes Ufer der <strong>Rhone</strong> bei<br />
Chippis (Bild aus Baumann, 2004).<br />
Ziel von Gewässerrevitalisierungen ist es,<br />
die Qualität des Gewässers zu verbessern,<br />
d.h. von einer Gewässergüte-Isolinie auf eine<br />
Nächsthöhere zu gelangen. Konkret<br />
kann dies mittels dreier möglicher Strategien<br />
erfolgen (Abbildung 3 unten, Pfeile 1 bis 3):<br />
1 Alleinige morphologische Aufwertung;<br />
RHONE-THUR PROJEKT <strong>Synthesebericht</strong> <strong>Schwall</strong>/<strong>Sunk</strong> Seite 7