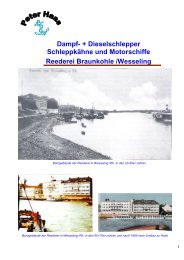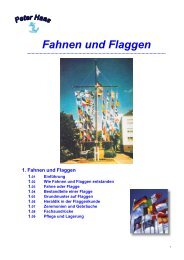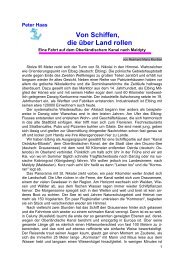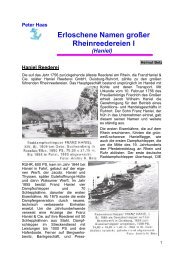Peter Haas Schifffahrtszeichen auf dem Rhein und deren technische ...
Peter Haas Schifffahrtszeichen auf dem Rhein und deren technische ...
Peter Haas Schifffahrtszeichen auf dem Rhein und deren technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Einheitstonnenmantel ist in größeren Stückzahlen aus Polyvinylchlorid (PVC), Aluminium,<br />
Stahlblech <strong>und</strong> glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hergestellt worden. Aufgr<strong>und</strong><br />
des ausgereiften <strong>und</strong> preiswerten Herstellungsverfahrens wird heute nur noch die Tonne<br />
aus Stahlblech gefertigt. Die Reparatur der Tonne stellt keine beson<strong>deren</strong> Anforderungen<br />
an übliche, metallverarbeitende Werkstätten dar.<br />
Wider Erwarten stellt der <strong>auf</strong>tretende Rost an der Tonnenschale bislang keine Einschränkung<br />
der Lebensdauer dar.<br />
Die Verankerungsart variiert je nach den gegebenen Randbedingungen. In <strong>dem</strong> schnell<br />
strömenden Gewässer wird vorwiegend die Gr<strong>und</strong>kettenverankerung angewandt, bei der<br />
leichte 12-15 cm lange Ankerdrähte oder -ketten mit einem schweren Gr<strong>und</strong>kettenvorläufer<br />
kombiniert werden. Die Gr<strong>und</strong>kette wird entweder an schwere Betonankersteine bis 4 t<br />
oder in Fels- oder Geröllsohle einbetonierte oder eingekeilte Felsanker angeschlossen.<br />
Die schwere Gr<strong>und</strong>kette hält die Tonne auch bei wechselnden Wasserständen stromgerecht,<br />
so dass das früher übliche Kürzen oder Verlängern der Ankerkette entfällt <strong>und</strong> die<br />
Tonnen heute auch bei Hochwasser <strong>auf</strong> Position liegen bleiben.<br />
Die Totalverluste durch Vertreibung <strong>und</strong> Kollisionen sind stark abhängig von der jeweiligen<br />
Wasserführung sowie Verkehrsdichte <strong>und</strong> liegen im Jahresdurchschnitt bei r<strong>und</strong> 15% des<br />
Gesamtbestandes.<br />
3.2 B a k e n, S p i e r e n t o n n e n<br />
Gefährliche Punkte <strong>und</strong> Hindernisse werden mit<br />
Baken <strong>und</strong>/oder Spierentonnen bezeichnet; in<br />
Abb. 6 <strong>und</strong> 7 ist u. a. eine Streichlinienbezeichnung<br />
von Buhnen dargestellt. Die Schiffszeichen<br />
sollen hierbei sowohl als Tagessichtzeichen als<br />
auch als Radarziele dienen. Für Ihre Aufgaben als<br />
Tagessichtzeichen werden die Baken<strong>auf</strong>sätze als<br />
Toppzeichen nach Form <strong>und</strong> Farbgebung unterschieden.<br />
Die Mastquerschnitte sind so dimensioniert,<br />
dass sie auch bei HHW allen hierbei <strong>auf</strong>tretenden<br />
Kräften unter Beachtung von Wind- <strong>und</strong><br />
Wasserdruck sowie Treibgut standhalten.<br />
Die Spierentonne (Abb. 8) entsteht wie in Abb. 5<br />
dargestellt, durch Aufsetzen eines Bober<strong>auf</strong>satzes<br />
<strong>auf</strong> die Einheitstonne.<br />
Abb. 6 Bezeichnung von gefährlichen Punkten <strong>und</strong> Hindernissen<br />
im <strong>und</strong> am Fahrwasser für die Fahrt bei Tag<br />
Abb. 7 (links)<br />
Baken zur Bezeichnung von gefährlichen<br />
Punkten <strong>und</strong> Hindernissen am Fahrwasser<br />
Abb. 8 (rechts)<br />
Spierentonne zur Hindernisbezeichnung<br />
7