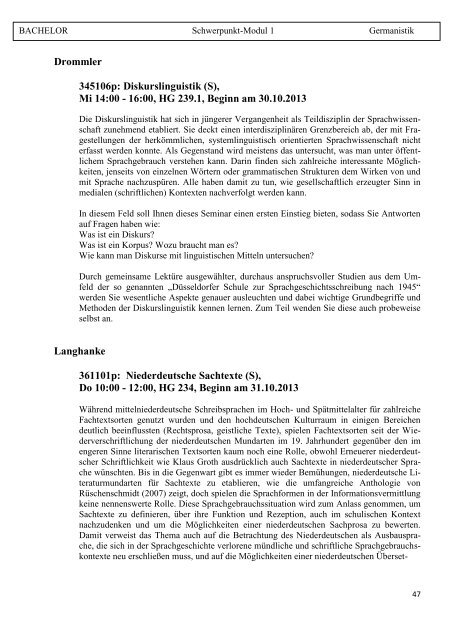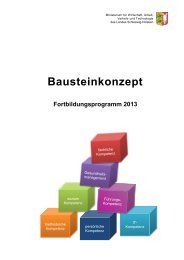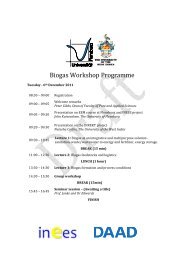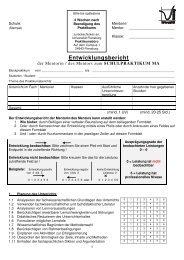Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...
Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...
Grußwort des Sprechers des Seminars für Germanistik - Universität ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BACHELOR Schwerpunkt-Modul 1 <strong>Germanistik</strong><br />
Drommler<br />
345106p: Diskurslinguistik (S),<br />
Mi 14:00 - 16:00, HG 239.1, Beginn am 30.10.2013<br />
Die Diskurslinguistik hat sich in jüngerer Vergangenheit als Teildisziplin der Sprachwissenschaft<br />
zunehmend etabliert. Sie deckt einen interdisziplinären Grenzbereich ab, der mit Fragestellungen<br />
der herkömmlichen, systemlinguistisch orientierten Sprachwissenschaft nicht<br />
erfasst werden konnte. Als Gegenstand wird meistens das untersucht, was man unter öffentlichem<br />
Sprachgebrauch verstehen kann. Darin finden sich zahlreiche interessante Möglichkeiten,<br />
jenseits von einzelnen Wörtern oder grammatischen Strukturen dem Wirken von und<br />
mit Sprache nachzuspüren. Alle haben damit zu tun, wie gesellschaftlich erzeugter Sinn in<br />
medialen (schriftlichen) Kontexten nachverfolgt werden kann.<br />
In diesem Feld soll Ihnen dieses Seminar einen ersten Einstieg bieten, sodass Sie Antworten<br />
auf Fragen haben wie:<br />
Was ist ein Diskurs?<br />
Was ist ein Korpus? Wozu braucht man es?<br />
Wie kann man Diskurse mit linguistischen Mitteln untersuchen?<br />
Durch gemeinsame Lektüre ausgewählter, durchaus anspruchsvoller Studien aus dem Umfeld<br />
der so genannten „Düsseldorfer Schule zur Sprachgeschichtsschreibung nach 1945“<br />
werden Sie wesentliche Aspekte genauer ausleuchten und dabei wichtige Grundbegriffe und<br />
Methoden der Diskurslinguistik kennen lernen. Zum Teil wenden Sie diese auch probeweise<br />
selbst an.<br />
Langhanke<br />
361101p: Niederdeutsche Sachtexte (S),<br />
Do 10:00 - 12:00, HG 234, Beginn am 31.10.2013<br />
Während mittelniederdeutsche Schreibsprachen im Hoch- und Spätmittelalter <strong>für</strong> zahlreiche<br />
Fachtextsorten genutzt wurden und den hochdeutschen Kulturraum in einigen Bereichen<br />
deutlich beeinflussten (Rechtsprosa, geistliche Texte), spielen Fachtextsorten seit der Wiederverschriftlichung<br />
der niederdeutschen Mundarten im 19. Jahrhundert gegenüber den im<br />
engeren Sinne literarischen Textsorten kaum noch eine Rolle, obwohl Erneuerer niederdeutscher<br />
Schriftlichkeit wie Klaus Groth ausdrücklich auch Sachtexte in niederdeutscher Sprache<br />
wünschten. Bis in die Gegenwart gibt es immer wieder Bemühungen, niederdeutsche Literaturmundarten<br />
<strong>für</strong> Sachtexte zu etablieren, wie die umfangreiche Anthologie von<br />
Rüschenschmidt (2007) zeigt, doch spielen die Sprachformen in der Informationsvermittlung<br />
keine nennenswerte Rolle. Diese Sprachgebrauchssituation wird zum Anlass genommen, um<br />
Sachtexte zu definieren, über ihre Funktion und Rezeption, auch im schulischen Kontext<br />
nachzudenken und um die Möglichkeiten einer niederdeutschen Sachprosa zu bewerten.<br />
Damit verweist das Thema auch auf die Betrachtung <strong>des</strong> Niederdeutschen als Ausbausprache,<br />
die sich in der Sprachgeschichte verlorene mündliche und schriftliche Sprachgebrauchskontexte<br />
neu erschließen muss, und auf die Möglichkeiten einer niederdeutschen Überset-<br />
47