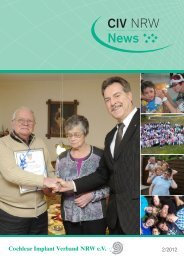CIV NRW - Cochlear Implant Verband Nordrhein-Westfalen e.V.
CIV NRW - Cochlear Implant Verband Nordrhein-Westfalen e.V.
CIV NRW - Cochlear Implant Verband Nordrhein-Westfalen e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aktuelle Infos<br />
väterlicherseits in eine Musikerfamilie hineingeboren.<br />
Schon der Großvater, der ebenfalls Ludwig hieß,<br />
war Hofkapellmeister in Bonn. Beethovens Vater Johann<br />
arbeitete ebenfalls als Musiker. Der junge Ludwig<br />
lernte in frühester Kindheit Klavier, Orgel und<br />
Violine. Und ähnlich wie bei Mozart sorgte auch bei<br />
Beethoven der Vater dafür, dass der talentierte Sohn<br />
schon mit sieben Jahren sein erstes öffentliches Konzert<br />
gab. Mit zwölf Jahren veröffentlichte der junge<br />
Ludwig bereits erste eigene Kompositionen unter<br />
dem Künstlernamen „Louis van Beethoven“. Und er<br />
wurde Mitglied der Bonner Hofkapelle, wo er sehr<br />
schnell zum zweiten Hoforganisten aufstieg.<br />
Mit 16 reiste Beethoven zum Studium nach Wien.<br />
Aufgrund des Todes seiner Mutter Maria Magdalena<br />
musste er diese Reise kurzfristig wieder beenden.<br />
Er kehrte nach Bonn zurück und übernahm die Rolle<br />
des Familienoberhauptes für seine beiden jüngeren<br />
Brüder und den alkoholkranken Vater. Trotz dieser<br />
Belastung konnte sich Beethoven weiterhin auf seine<br />
musikalische Ausbildung konzentrieren. 1789 wurde<br />
er Student an der Bonner Universität.<br />
Leben in Wien: 1792 verließ Beethoven Bonn und<br />
zog nach Wien. Dort sollte er bis an sein Lebensende<br />
bleiben. In Wien fand Beethoven mit seiner<br />
Musik sehr bald Einzug in die höheren Adelskreise,<br />
die ihn auch finanziell unterstützten. Zudem lebte<br />
er vom Unterricht und vom Verkauf der Noten seiner<br />
Werke. Deren Erfolg war in Wien allerdings recht<br />
wechselhaft: Seine einzige Oper „Fidelio“ erntete 1805<br />
noch schlechte Kritiken, neun Jahre später wurde sie<br />
vom Wiener Publikum gefeiert.<br />
Ein großes Problem für Beethoven war seine<br />
Schwerhörigkeit, die bereits im Alter von 27 Jahren<br />
einsetzte und zu seiner völligen Ertaubung mit 48<br />
Jahren führte. Er komponierte aber trotzdem immer<br />
weiter, obwohl er seine Spätwerke, darunter die berühmte<br />
„9. Sinfonie“, selbst nicht mehr hören konnte.<br />
Am 26. März 1827 starb Beethoven im Alter von 56<br />
Jahren nach langer Krankheit an Leberzirrhose.<br />
Wie populär er schon damals war, zeigte sich bei<br />
seiner Beerdigung in Wien, zu der sich rund 20.000<br />
Menschen versammelt haben sollen.<br />
Schwerhörigkeit: Eindringlich beschreibt der Komponist<br />
im Laufe seines Schwerhörigenlebens die<br />
charakteristische soziale Isolation des Schwerhörigen,<br />
die Schwerhörigkeit als Krankheit. „So bald<br />
ich tot bin, …, so bittet allein … in meinem<br />
Namen, dass er meine Krankheit beschreibe,<br />
… damit wenigstens soviel als möglich die<br />
Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt<br />
werde….“ Dies schrieb Ludwig van Beethoven<br />
1802, gerade 32 Jahre alt, in sein Heiligenstädter<br />
Testament.<br />
Beethovens Hörrohre: Erstes erhielt er 1814 von Johann<br />
Melzel, dem Erfinder des Metronoms. (Mit den Mitteln der<br />
modernen Medizin hätte man ihm wahrscheinlich helfen<br />
können.)<br />
Hört man die 1798 zu Beginn seiner Schwerhörigkeit komponierte,<br />
schwer klingende Klaviersonate D-Dur (op. 10) „largo e mesto“, so glaubt<br />
man, etwas von der Ahnung dieses schweren Weges in der Musik wiederzufinden.<br />
1801, im Alter von 31 Jahren, schildert Beethoven seine<br />
Symptome: Schwerhörigkeit mit Hochtonverlust und Sprachverständlichkeitsverlust,<br />
quälende Ohrgeräusche [Tinnitus], Verzerrungen [Recruitment]<br />
und Überempfindlichkeit für Schall [Hyperakusis]. In einem<br />
Brief an seinen Freund Dr. Franz Gerhard Wegeler (1765 bis 1848) vom<br />
29. Juni beschreibt Beethoven die dissonante Kognition von Menschen<br />
und eigener Musik: „Der neidische Dämon hat meiner Gesundheit einen<br />
schlimmen Streich gespielt, nämlich mein Gehör ist seit drei Jahren immer<br />
schwächer geworden [Schwerhörigkeit]. . . . nur meine Ohren, die<br />
sausen und brausen Tag und Nacht fort [Tinnitus]. . . . Ich bringe mein<br />
Leben elend zu. Seit zwei Jahren meide ich alle Gesellschaften, weils mir<br />
nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Hätte ich irgend<br />
ein anderes Fach so gings noch eher, aber in meinem Fach ist es ein<br />
schrecklicher Zustand. . . Die hohen Töne von Instrumenten und Singstimmen<br />
höre ich nicht [Hochtonverlust], wenn ich etwas weit weg bin,<br />
auch die Bläser im Orchester nicht. Manchmal auch hör ich den Redner,<br />
der leise spricht, wohl, aber die Worte nicht [Sprachverständlichkeitsverlust],<br />
und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich [Hyperakusis].“<br />
Beethoven zieht sich aus der Welt der Hörenden zurück. Ein<br />
bestimmender Teil seines Menschseins geht Beethoven unaufhaltsam<br />
verloren. In späten Jahren kommunizierte Beethoven nur über Konversationshefte.<br />
Der kranke Beethoven hatte manchmal Suizidgedanken. Nur<br />
seine Kunst rettete ihn. Der Verlust des Hörens und kühne Kompositionsentwürfe<br />
– eigentlich ein Widerspruch in sich -, und doch waren sie bei<br />
Beethoven vereinbar.<br />
Sein Leichnam wurde zweimal exhumiert, mit Zersägen von Teilen, aber<br />
es wurde keine Erklärung der Schwerhörigkeit gefunden. In der Dissertation<br />
1950 vom Erlenbacher Arzt Forster „Beethovens Krankheiten und<br />
ihre Beurteilungen“ werden viele seiner Krankheiten und Ihrer Folgen beschrieben.<br />
Einen von vielen möglichen Faktoren, die zur Taubheit führten,<br />
sieht Forster in der Typhuskrankheit, von der Teile des Nervensystems in<br />
Mitleidenschaft gezogen wurden.<br />
www.planet-wissen.de // www.deutschesaerzteblatt.de // DER SPIEGEL<br />
Ronald Stein<br />
Ohren erröten |bis über beide Ohren in Arbeit stecken | bis über beide Ohren verliebt sein |bis über beide Ohren verliebt | das Ohrensausen<br />
54 |<strong>CIV</strong> <strong>NRW</strong> News | Ausgabe 2/2013