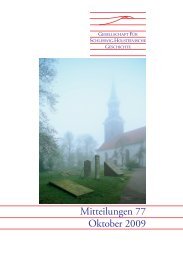Mitteilungen 74 Juni 2008 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Mitteilungen 74 Juni 2008 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Mitteilungen 74 Juni 2008 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
32<br />
ausgerechnet Brandts Grundriss der <strong>Geschichte</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s bis<br />
1981 acht Auflagen erlebte und damit zur erfolgreichsten, wenn auch später<br />
gelegentlich befehdeten Gesamtdarstellung der Landesgeschichte wurde.<br />
Als Scheel 1945 – noch vor Kriegsende – emeritiert wurde, setzte sich<br />
der Sonderweg der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Landesgeschichte fort. Scheels<br />
Nachfolger auf dem Kieler Landesgeschichtslehrstuhl – Alexander Scharff<br />
und Christian Degn – blieben mit ihren Forschungsschwerpunkten dem<br />
18. und 19. Jahrhundert verpflichtet. Erst mit Erich Hoffmann, der lange<br />
Jahre im Schuldienst zugebracht hatte, wurde 1978 e<strong>in</strong> Historiker auf den<br />
landesgeschichtlichen Lehrstuhl berufen, der gleichermaßen als Kenner der<br />
mittelalterlichen und neueren Landesgeschichte wie auch der skand<strong>in</strong>avischen<br />
<strong>Geschichte</strong> ausgewiesen war.<br />
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die deutsche Landesgeschichte<br />
als akademische Diszipl<strong>in</strong> begründet, <strong>in</strong> der zweiten Hälfte dieses<br />
Jahrhunderts hat sie sich mit enormer Kraft entfaltet, jedenfalls <strong>in</strong> Westdeutschland,<br />
während <strong>in</strong> Ostdeutschland – aber das ist e<strong>in</strong> anderes Thema<br />
– mit der Auflösung der Länder 1952 auch die Landesgeschichte mehr und<br />
mehr e<strong>in</strong>geschränkt und als Universitätsfach praktisch beseitigt wurde.<br />
Von der siedlungsgeschichtlich ausgerichteten Leipziger Landesgeschichte<br />
s<strong>in</strong>d ebenso wie von der am Kulturraumkonzept orientierten Bonner Landesgeschichte<br />
starke Impulse ausgegangen, doch erfolgten nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg deutliche thematische Akzentverschiebungen. Die Leipziger<br />
Landesgeschichte wurde durch den Kötzschke-Schüler Walter Schles<strong>in</strong>ger,<br />
der Lehrstühle <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>, Frankfurt und Marburg <strong>in</strong>nehatte, konsequent<br />
<strong>in</strong> den Dienst der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte gestellt, und viele<br />
andere Mittelalterhistoriker wie Karl Bosl, Otto Brunner, Hans Patze<br />
s<strong>in</strong>d ihm dar<strong>in</strong> gefolgt. Schles<strong>in</strong>ger betonte, dass nur räumlich überschaubare<br />
Arbeit, also landesgeschichtliche Forschung, die Verfassungswirklichkeit<br />
erkennen ließe; denn e<strong>in</strong>e so ausgerichtete Verfassungsgeschichte auf<br />
landesgeschichtlicher Grundlage frage nicht nach der Verfassung, die die<br />
Menschen haben, sondern nach der Verfassung, <strong>in</strong> der sie s<strong>in</strong>d. Dass e<strong>in</strong>e so<br />
verstandene mittelalterliche Verfassungsgeschichte auf e<strong>in</strong>e vergleichende<br />
Landesgeschichte h<strong>in</strong>auslief, machten die Tagungen des Konstanzer Arbeitskreises<br />
für mittelalterliche <strong>Geschichte</strong> auf der Reichenau deutlich, die<br />
<strong>in</strong> den 60er und 70er Jahren maßgeblich von Walter Schles<strong>in</strong>ger geprägt<br />
wurden: <strong>in</strong> zumeist europäischer Perspektive wurden – um nur e<strong>in</strong>ige große<br />
Themen zu nennen – der Territorialstaat, die Landgeme<strong>in</strong>de, die Stadt,<br />
die Ostsiedlung, die Burg, die Grundherrschaft, Gilden und Zünfte u.a.m.<br />
betrachtet.<br />
Diese Themenreihe, die sich leicht verlängern ließe, bezeichnet gewissermaßen<br />
die landesgeschichtlichen Bauste<strong>in</strong>e, durch deren Zusammenfügung<br />
sich erst e<strong>in</strong> Bild der allgeme<strong>in</strong>en <strong>Geschichte</strong> ergibt. Wir s<strong>in</strong>d damit bei der