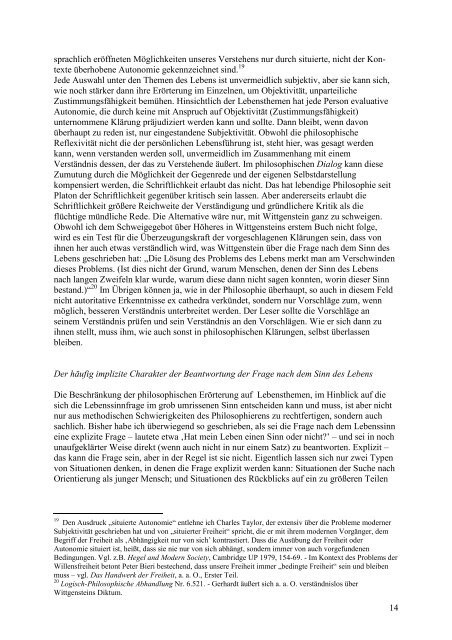Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sprachlich eröffneten Möglichkeiten unseres Verstehens nur durch situierte, nicht der Kontexte<br />
überhobene Autonomie gekennzeichnet sind. 19<br />
Jede Auswahl unter den Themen des <strong>Leben</strong>s ist unvermeidlich subjektiv, aber sie kann sich,<br />
wie noch stärker dann ihre Erörterung im Einzelnen, um Objektivität, unparteiliche<br />
Zustimmungsfähigkeit bemühen. Hinsichtlich der <strong>Leben</strong>sthemen hat jede Person evaluative<br />
Autonomie, die durch keine mit Anspruch auf Objektivität (Zustimmungsfähigkeit)<br />
unternommene Klärung präjudiziert werden kann und sollte. Dann bleibt, wenn davon<br />
überhaupt zu reden ist, nur eingestandene Subjektivität. Obwohl die philosophische<br />
Reflexivität nicht die der persönlichen <strong>Leben</strong>sführung ist, steht hier, was gesagt werden<br />
kann, wenn verstanden werden soll, unvermeidlich im Zusammenhang mit einem<br />
Verständnis dessen, der das zu Verstehende äußert. Im philosophischen Dialog kann diese<br />
Zumutung durch die Möglichkeit der Gegenrede und der eigenen Selbstdarstellung<br />
kompensiert werden, die Schriftlichkeit erlaubt das nicht. <strong>Das</strong> hat lebendige Philosophie seit<br />
Platon der Schriftlichkeit gegenüber kritisch sein lassen. Aber andererseits erlaubt die<br />
Schriftlichkeit größere Reichweite der Verständigung und gründlichere Kritik als die<br />
flüchtige mündliche Rede. Die Alternative wäre nur, mit Wittgenstein ganz zu schweigen.<br />
Obwohl ich dem Schweigegebot über Höheres in Wittgensteins erstem Buch nicht folge,<br />
wird es ein Test für die Überzeugungskraft der vorgeschlagenen Klärungen sein, dass von<br />
ihnen her auch etwas verständlich wird, was Wittgenstein über die Frage nach dem Sinn des<br />
<strong>Leben</strong>s geschrieben hat: „Die Lösung des Problems des <strong>Leben</strong>s merkt man am Verschwinden<br />
dieses Problems. (Ist dies nicht der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des <strong>Leben</strong>s<br />
nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn<br />
bestand.)“ 20 Im Übrigen können ja, wie in der Philosophie überhaupt, so auch in diesem Feld<br />
nicht autoritative Erkenntnisse ex cathedra verkündet, sondern nur Vorschläge zum, wenn<br />
möglich, besseren Verständnis unterbreitet werden. Der Leser sollte die Vorschläge an<br />
seinem Verständnis prüfen und sein Verständnis an den Vorschlägen. Wie er sich dann zu<br />
ihnen stellt, muss ihm, wie auch sonst in philosophischen Klärungen, selbst überlassen<br />
bleiben.<br />
Der häufig implizite Charakter der Beantwortung der Frage nach dem Sinn des <strong>Leben</strong>s<br />
Die Beschränkung der philosophischen Erörterung auf <strong>Leben</strong>sthemen, im Hinblick auf die<br />
sich die <strong>Leben</strong>ssinnfrage im grob umrissenen Sinn entscheiden kann und muss, ist aber nicht<br />
nur aus methodischen Schwierigkeiten des Philosophierens zu rechtfertigen, sondern auch<br />
sachlich. Bisher habe ich überwiegend so geschrieben, als sei die Frage nach dem <strong>Leben</strong>ssinn<br />
eine explizite Frage – lautete etwa ‚Hat mein <strong>Leben</strong> einen Sinn oder nicht’ – und sei in noch<br />
unaufgeklärter Weise direkt (wenn auch nicht in nur einem Satz) zu beantworten. Explizit –<br />
das kann die Frage sein, aber in der Regel ist sie nicht. Eigentlich lassen sich nur zwei Typen<br />
von Situationen denken, in denen die Frage explizit werden kann: Situationen der Suche nach<br />
Orientierung als junger Mensch; und Situationen des Rückblicks auf ein zu größeren Teilen<br />
19 Den Ausdruck „situierte Autonomie“ entlehne ich Charles Taylor, der extensiv über die Probleme moderner<br />
Subjektivität geschrieben hat und von „situierter Freiheit“ spricht, die er mit ihrem modernen Vorgänger, dem<br />
Begriff der Freiheit als ‚Abhängigkeit nur von sich’ kontrastiert. <strong>Das</strong>s die Ausübung der Freiheit oder<br />
Autonomie situiert ist, heißt, dass sie nie nur von sich abhängt, sondern immer von auch vorgefundenen<br />
Bedingungen. Vgl. z.B. Hegel and Modern Society, Cambridge UP 1979, 154-69. - Im Kontext des Problems der<br />
Willensfreiheit betont Peter Bieri bestechend, dass unsere Freiheit immer „bedingte Freiheit“ sein und bleiben<br />
muss – vgl. <strong>Das</strong> Handwerk der Freiheit, a. a. O., Erster Teil.<br />
20 Logisch-Philosophische Abhandlung Nr. 6.521. - Gerhardt äußert sich a. a. O. verständnislos über<br />
Wittgensteins Diktum.<br />
14