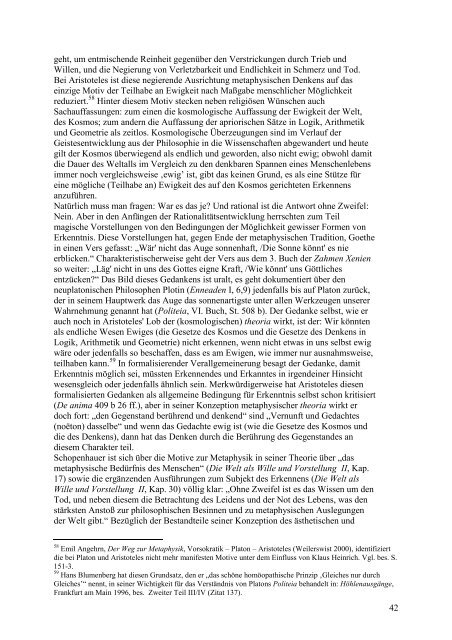Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
geht, um entmischende Reinheit gegenüber den Verstrickungen durch Trieb und<br />
Willen, und die Negierung von Verletzbarkeit und Endlichkeit in Schmerz und Tod.<br />
Bei Aristoteles ist diese negierende Ausrichtung metaphysischen Denkens auf das<br />
einzige Motiv der Teilhabe an Ewigkeit nach Maßgabe menschlicher Möglichkeit<br />
reduziert. 58 Hinter diesem Motiv stecken neben religiösen Wünschen auch<br />
Sachauffassungen: zum einen die kosmologische Auffassung der Ewigkeit der Welt,<br />
des Kosmos; zum andern die Auffassung der apriorischen Sätze in Logik, Arithmetik<br />
und Geometrie als zeitlos. Kosmologische Überzeugungen sind im Verlauf der<br />
Geistesentwicklung aus der Philosophie in die Wissenschaften abgewandert und heute<br />
gilt der Kosmos überwiegend als endlich und geworden, also nicht ewig; obwohl damit<br />
die Dauer des Weltalls im Vergleich zu den denkbaren Spannen eines Menschenlebens<br />
immer noch vergleichsweise ‚ewig’ ist, gibt das keinen Grund, es als eine Stütze für<br />
eine mögliche (Teilhabe an) Ewigkeit des auf den Kosmos gerichteten Erkennens<br />
anzuführen.<br />
Natürlich muss man fragen: War es das je Und rational ist die Antwort ohne Zweifel:<br />
Nein. Aber in den Anfängen der Rationalitätsentwicklung herrschten zum Teil<br />
magische Vorstellungen von den Bedingungen der Möglichkeit gewisser Formen von<br />
Erkenntnis. Diese Vorstellungen hat, gegen Ende der metaphysischen Tradition, Goethe<br />
in einen Vers gefasst: „Wär' nicht das Auge sonnenhaft, /Die Sonne könnt' es nie<br />
erblicken.“ Charakteristischerweise geht der Vers aus dem 3. Buch der Zahmen Xenien<br />
so weiter: „Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft, /Wie könnt' uns Göttliches<br />
entzücken“ <strong>Das</strong> Bild dieses Gedankens ist uralt, es geht dokumentiert über den<br />
neuplatonischen Philosophen Plotin (Enneaden I, 6,9) jedenfalls bis auf Platon zurück,<br />
der in seinem Hauptwerk das Auge das sonnenartigste unter allen Werkzeugen unserer<br />
Wahrnehmung genannt hat (Politeia, VI. Buch, St. 508 b). Der Gedanke selbst, wie er<br />
auch noch in Aristoteles' Lob der (kosmologischen) theoria wirkt, ist der: Wir könnten<br />
als endliche Wesen Ewiges (die Gesetze des Kosmos und die Gesetze des Denkens in<br />
Logik, Arithmetik und Geometrie) nicht erkennen, wenn nicht etwas in uns selbst ewig<br />
wäre oder jedenfalls so beschaffen, dass es am Ewigen, wie immer nur ausnahmsweise,<br />
teilhaben kann. 59 In formalisierender Verallgemeinerung besagt der Gedanke, damit<br />
Erkenntnis möglich sei, müssten Erkennendes und Erkanntes in irgendeiner Hinsicht<br />
wesensgleich oder jedenfalls ähnlich sein. Merkwürdigerweise hat Aristoteles diesen<br />
formalisierten Gedanken als allgemeine Bedingung für Erkenntnis selbst schon kritisiert<br />
(De anima 409 b 26 ff.), aber in seiner Konzeption metaphysischer theoria wirkt er<br />
doch fort: „den Gegenstand berührend und denkend“ sind „Vernunft und Gedachtes<br />
(noëton) dasselbe“ und wenn das Gedachte ewig ist (wie die Gesetze des Kosmos und<br />
die des Denkens), dann hat das Denken durch die Berührung des Gegenstandes an<br />
diesem Charakter teil.<br />
Schopenhauer ist sich über die Motive zur Metaphysik in seiner Theorie über „das<br />
metaphysische Bedürfnis des Menschen“ (Die Welt als Wille und Vorstellung II, Kap.<br />
17) sowie die ergänzenden Ausführungen zum Subjekt des Erkennens (Die Welt als<br />
Wille und Vorstellung II, Kap. 30) völlig klar: „Ohne Zweifel ist es das Wissen um den<br />
Tod, und neben diesem die Betrachtung des Leidens und der Not des <strong>Leben</strong>s, was den<br />
stärksten Anstoß zur philosophischen Besinnen und zu metaphysischen Auslegungen<br />
der Welt gibt.“ Bezüglich der Bestandteile seiner Konzeption des ästhetischen und<br />
58 Emil Angehrn, Der Weg zur Metaphysik, Vorsokratik – Platon – Aristoteles (Weilerswist 2000), identifiziert<br />
die bei Platon und Aristoteles nicht mehr manifesten Motive unter dem Einfluss von Klaus Heinrich. Vgl. bes. S.<br />
151-3.<br />
59 Hans Blumenberg hat diesen Grundsatz, den er „das schöne homöopathische Prinzip ‚Gleiches nur durch<br />
Gleiches’“ nennt, in seiner Wichtigkeit für das Verständnis von Platons Politeia behandelt in: Höhlenausgänge,<br />
Frankfurt am Main 1996, bes. Zweiter Teil III/IV (Zitat 137).<br />
42