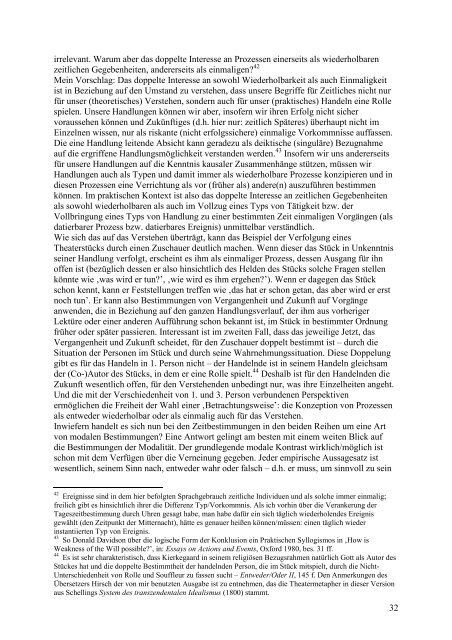Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
irrelevant. Warum aber das doppelte Interesse an Prozessen einerseits als wiederholbaren<br />
zeitlichen Gegebenheiten, andererseits als einmaligen 42<br />
Mein Vorschlag: <strong>Das</strong> doppelte Interesse an sowohl Wiederholbarkeit als auch Einmaligkeit<br />
ist in Beziehung auf den Umstand zu verstehen, dass unsere Begriffe für Zeitliches nicht nur<br />
für unser (theoretisches) Verstehen, sondern auch für unser (praktisches) Handeln eine Rolle<br />
spielen. Unsere Handlungen können wir aber, insofern wir ihren Erfolg nicht sicher<br />
voraussehen können und Zukünftiges (d.h. hier nur: zeitlich Späteres) überhaupt nicht im<br />
Einzelnen wissen, nur als riskante (nicht erfolgssichere) einmalige Vorkommnisse auffassen.<br />
Die eine Handlung leitende Absicht kann geradezu als deiktische (singuläre) Bezugnahme<br />
auf die ergriffene Handlungsmöglichkeit verstanden werden. 43 Insofern wir uns andererseits<br />
für unsere Handlungen auf die Kenntnis kausaler Zusammenhänge stützen, müssen wir<br />
Handlungen auch als Typen und damit immer als wiederholbare Prozesse konzipieren und in<br />
diesen Prozessen eine Verrichtung als vor (früher als) andere(n) auszuführen bestimmen<br />
können. Im praktischen Kontext ist also das doppelte Interesse an zeitlichen Gegebenheiten<br />
als sowohl wiederholbaren als auch im Vollzug eines Typs von Tätigkeit bzw. der<br />
Vollbringung eines Typs von Handlung zu einer bestimmten Zeit einmaligen Vorgängen (als<br />
datierbarer Prozess bzw. datierbares Ereignis) unmittelbar verständlich.<br />
Wie sich das auf das Verstehen überträgt, kann das Beispiel der Verfolgung eines<br />
Theaterstücks durch einen Zuschauer deutlich machen. Wenn dieser das Stück in Unkenntnis<br />
seiner Handlung verfolgt, erscheint es ihm als einmaliger Prozess, dessen Ausgang für ihn<br />
offen ist (bezüglich dessen er also hinsichtlich des Helden des Stücks solche Fragen stellen<br />
könnte wie ‚was wird er tun’, ‚wie wird es ihm ergehen’). Wenn er dagegen das Stück<br />
schon kennt, kann er Feststellungen treffen wie ‚das hat er schon getan, das aber wird er erst<br />
noch tun’. Er kann also Bestimmungen von Vergangenheit und Zukunft auf Vorgänge<br />
anwenden, die in Beziehung auf den ganzen Handlungsverlauf, der ihm aus vorheriger<br />
Lektüre oder einer anderen Aufführung schon bekannt ist, im Stück in bestimmter Ordnung<br />
früher oder später passieren. Interessant ist im zweiten Fall, dass das jeweilige Jetzt, das<br />
Vergangenheit und Zukunft scheidet, für den Zuschauer doppelt bestimmt ist – durch die<br />
Situation der Personen im Stück und durch seine Wahrnehmungssituation. Diese Doppelung<br />
gibt es für das Handeln in 1. Person nicht – der Handelnde ist in seinem Handeln gleichsam<br />
der (Co-)Autor des Stücks, in dem er eine Rolle spielt. 44 Deshalb ist für den Handelnden die<br />
Zukunft wesentlich offen, für den Verstehenden unbedingt nur, was ihre Einzelheiten angeht.<br />
Und die mit der Verschiedenheit von 1. und 3. Person verbundenen Perspektiven<br />
ermöglichen die Freiheit der Wahl einer ‚Betrachtungsweise’: die Konzeption von Prozessen<br />
als entweder wiederholbar oder als einmalig auch für das Verstehen.<br />
Inwiefern handelt es sich nun bei den Zeitbestimmungen in den beiden Reihen um eine Art<br />
von modalen Bestimmungen Eine Antwort gelingt am besten mit einem weiten Blick auf<br />
die Bestimmungen der Modalität. Der grundlegende modale Kontrast wirklich/möglich ist<br />
schon mit dem Verfügen über die Verneinung gegeben. Jeder empirische Aussagesatz ist<br />
wesentlich, seinem Sinn nach, entweder wahr oder falsch – d.h. er muss, um sinnvoll zu sein<br />
42 Ereignisse sind in dem hier befolgten Sprachgebrauch zeitliche Individuen und als solche immer einmalig;<br />
freilich gibt es hinsichtlich ihrer die Differenz Typ/Vorkommnis. Als ich vorhin über die Verankerung der<br />
Tageszeitbestimmung durch Uhren gesagt habe, man habe dafür ein sich täglich wiederholendes Ereignis<br />
gewählt (den Zeitpunkt der Mitternacht), hätte es genauer heißen können/müssen: einen täglich wieder<br />
instantiierten Typ von Ereignis.<br />
43 So Donald Davidson über die logische Form der Konklusion ein Praktischen Syllogismos in ‚How is<br />
Weakness of the Will possible’, in: Essays on Actions and Events, Oxford 1980, bes. 31 ff.<br />
44 Es ist sehr charakteristisch, dass Kierkegaard in seinem religiösen Bezugsrahmen natürlich Gott als Autor des<br />
Stückes hat und die doppelte Bestimmtheit der handelnden Person, die im Stück mitspielt, durch die Nicht-<br />
Unterschiedenheit von Rolle und Souffleur zu fassen sucht – Entweder/Oder II, 145 f. Den Anmerkungen des<br />
Übersetzers Hirsch der von mir benutzten Ausgabe ist zu entnehmen, das die Theatermetapher in dieser Version<br />
aus Schellings System des transzendentalen Idealismus (1800) stammt.<br />
32