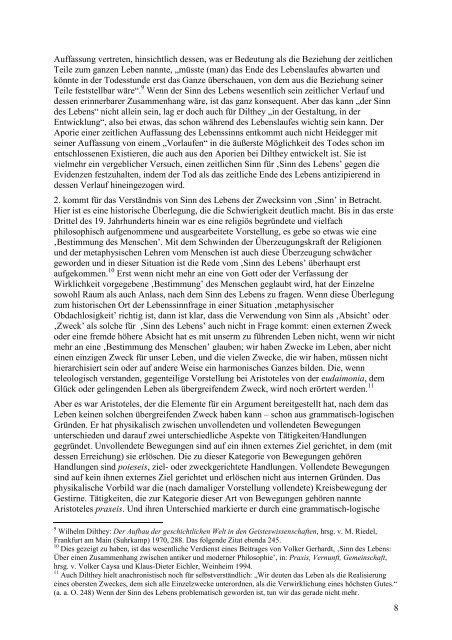Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Auffassung vertreten, hinsichtlich dessen, was er Bedeutung als die Beziehung der zeitlichen<br />
Teile zum ganzen <strong>Leben</strong> nannte, „müsste (man) das Ende des <strong>Leben</strong>slaufes abwarten und<br />
könnte in der Todesstunde erst das Ganze überschauen, von dem aus die Beziehung seiner<br />
Teile feststellbar wäre“. 9 Wenn der Sinn des <strong>Leben</strong>s wesentlich sein zeitlicher Verlauf und<br />
dessen erinnerbarer Zusammenhang wäre, ist das ganz konsequent. Aber das kann „der Sinn<br />
des <strong>Leben</strong>s“ nicht allein sein, lag er doch auch für Dilthey „in der Gestaltung, in der<br />
Entwicklung“, also bei etwas, das schon während des <strong>Leben</strong>slaufes wichtig sein kann. Der<br />
Aporie einer zeitlichen Auffassung des <strong>Leben</strong>ssinns entkommt auch nicht Heidegger mit<br />
seiner Auffassung von einem „Vorlaufen“ in die äußerste Möglichkeit des Todes schon im<br />
entschlossenen Existieren, die auch aus den Aporien bei Dilthey entwickelt ist. Sie ist<br />
vielmehr ein vergeblicher Versuch, einen zeitlichen Sinn für ‚Sinn des <strong>Leben</strong>s’ gegen die<br />
Evidenzen festzuhalten, indem der Tod als das zeitliche Ende des <strong>Leben</strong>s antizipierend in<br />
dessen Verlauf hineingezogen wird.<br />
2. kommt für das Verständnis von Sinn des <strong>Leben</strong>s der Zwecksinn von ‚Sinn’ in Betracht.<br />
Hier ist es eine historische Überlegung, die die Schwierigkeit deutlich macht. Bis in das erste<br />
Drittel des 19. Jahrhunderts hinein war es eine religiös begründete und vielfach<br />
philosophisch aufgenommene und ausgearbeitete Vorstellung, es gebe so etwas wie eine<br />
‚Bestimmung des Menschen’. Mit dem Schwinden der Überzeugungskraft der Religionen<br />
und der metaphysischen Lehren vom Menschen ist auch diese Überzeugung schwächer<br />
geworden und in dieser Situation ist die Rede vom ‚Sinn des <strong>Leben</strong>s’ überhaupt erst<br />
aufgekommen. 10 Erst wenn nicht mehr an eine von Gott oder der Verfassung der<br />
Wirklichkeit vorgegebene ‚Bestimmung’ des Menschen geglaubt wird, hat der Einzelne<br />
sowohl Raum als auch Anlass, nach dem Sinn des <strong>Leben</strong>s zu fragen. Wenn diese Überlegung<br />
zum historischen Ort der <strong>Leben</strong>ssinnfrage in einer Situation ‚metaphysischer<br />
Obdachlosigkeit’ richtig ist, dann ist klar, dass die Verwendung von Sinn als ‚Absicht’ oder<br />
‚Zweck’ als solche für ‚Sinn des <strong>Leben</strong>s’ auch nicht in Frage kommt: einen externen Zweck<br />
oder eine fremde höhere Absicht hat es mit unserm zu führenden <strong>Leben</strong> nicht, wenn wir nicht<br />
mehr an eine ‚Bestimmung des Menschen’ glauben; wir haben Zwecke im <strong>Leben</strong>, aber nicht<br />
einen einzigen Zweck für unser <strong>Leben</strong>, und die vielen Zwecke, die wir haben, müssen nicht<br />
hierarchisiert sein oder auf andere Weise ein harmonisches Ganzes bilden. Die, wenn<br />
teleologisch verstanden, gegenteilige Vorstellung bei Aristoteles von der eudaimonia, dem<br />
Glück oder gelingenden <strong>Leben</strong> als übergreifendem Zweck, wird noch erörtert werden. 11<br />
Aber es war Aristoteles, der die Elemente für ein Argument bereitgestellt hat, nach dem das<br />
<strong>Leben</strong> keinen solchen übergreifenden Zweck haben kann – schon aus grammatisch-logischen<br />
Gründen. Er hat physikalisch zwischen unvollendeten und vollendeten Bewegungen<br />
unterschieden und darauf zwei unterschiedliche Aspekte von Tätigkeiten/Handlungen<br />
gegründet. Unvollendete Bewegungen sind auf ein ihnen externes Ziel gerichtet, in dem (mit<br />
dessen Erreichung) sie erlöschen. Die zu dieser Kategorie von Bewegungen gehören<br />
Handlungen sind poieseis, ziel- oder zweckgerichtete Handlungen. Vollendete Bewegungen<br />
sind auf kein ihnen externes Ziel gerichtet und erlöschen nicht aus internen Gründen. <strong>Das</strong><br />
physikalische Vorbild war die (nach damaliger Vorstellung vollendete) Kreisbewegung der<br />
Gestirne. Tätigkeiten, die zur Kategorie dieser Art von Bewegungen gehören nannte<br />
Aristoteles praxeis. Und ihren Unterschied markierte er durch eine grammatisch-logische<br />
9 Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, hrsg. v. M. Riedel,<br />
Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1970, 288. <strong>Das</strong> folgende Zitat ebenda 245.<br />
10 Dies gezeigt zu haben, ist das wesentliche Verdienst eines Beitrages von Volker Gerhardt, ‚Sinn des <strong>Leben</strong>s:<br />
Über einen Zusammenhang zwischen antiker und moderner Philosophie’, in: Praxis, Vernunft, Gemeinschaft,<br />
hrsg. v. Volker Caysa und Klaus-Dieter Eichler, Weinheim 1994.<br />
11 Auch Dilthey hielt anachronistisch noch für selbstverständlich: „Wir deuten das <strong>Leben</strong> als die Realisierung<br />
eines obersten Zweckes, dem sich alle Einzelzwecke unterordnen, als die Verwirklichung eines höchsten Gutes.“<br />
(a. a. O. 248) Wenn der Sinn des <strong>Leben</strong>s problematisch geworden ist, tun wir das gerade nicht mehr.<br />
8