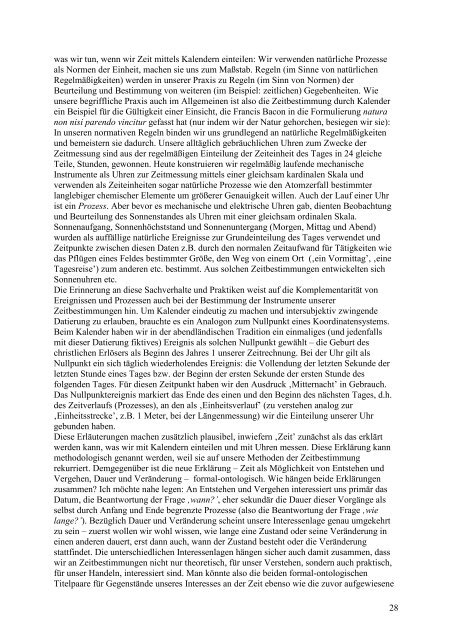Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
was wir tun, wenn wir Zeit mittels Kalendern einteilen: Wir verwenden natürliche Prozesse<br />
als Normen der Einheit, machen sie uns zum Maßstab. Regeln (im Sinne von natürlichen<br />
Regelmäßigkeiten) werden in unserer Praxis zu Regeln (im Sinn von Normen) der<br />
Beurteilung und Bestimmung von weiteren (im Beispiel: zeitlichen) Gegebenheiten. Wie<br />
unsere begriffliche Praxis auch im Allgemeinen ist also die Zeitbestimmung durch Kalender<br />
ein Beispiel für die Gültigkeit einer Einsicht, die Francis Bacon in die Formulierung natura<br />
non nisi parendo vincitur gefasst hat (nur indem wir der Natur gehorchen, besiegen wir sie):<br />
In unseren normativen Regeln binden wir uns grundlegend an natürliche Regelmäßigkeiten<br />
und bemeistern sie dadurch. Unsere alltäglich gebräuchlichen Uhren zum Zwecke der<br />
Zeitmessung sind aus der regelmäßigen Einteilung der Zeiteinheit des Tages in 24 gleiche<br />
Teile, Stunden, gewonnen. Heute konstruieren wir regelmäßig laufende mechanische<br />
Instrumente als Uhren zur Zeitmessung mittels einer gleichsam kardinalen Skala und<br />
verwenden als Zeiteinheiten sogar natürliche Prozesse wie den Atomzerfall bestimmter<br />
langlebiger chemischer Elemente um größerer Genauigkeit willen. Auch der Lauf einer Uhr<br />
ist ein Prozess. Aber bevor es mechanische und elektrische Uhren gab, dienten Beobachtung<br />
und Beurteilung des Sonnenstandes als Uhren mit einer gleichsam ordinalen Skala.<br />
Sonnenaufgang, Sonnenhöchststand und Sonnenuntergang (Morgen, Mittag und Abend)<br />
wurden als auffällige natürliche Ereignisse zur Grundeinteilung des Tages verwendet und<br />
Zeitpunkte zwischen diesen Daten z.B. durch den normalen Zeitaufwand für Tätigkeiten wie<br />
das Pflügen eines Feldes bestimmter Größe, den Weg von einem Ort (‚ein Vormittag’, ‚eine<br />
Tagesreise’) zum anderen etc. bestimmt. Aus solchen Zeitbestimmungen entwickelten sich<br />
Sonnenuhren etc.<br />
Die Erinnerung an diese Sachverhalte und Praktiken weist auf die Komplementarität von<br />
Ereignissen und Prozessen auch bei der Bestimmung der Instrumente unserer<br />
Zeitbestimmungen hin. Um Kalender eindeutig zu machen und intersubjektiv zwingende<br />
Datierung zu erlauben, brauchte es ein Analogon zum Nullpunkt eines Koordinatensystems.<br />
Beim Kalender haben wir in der abendländischen Tradition ein einmaliges (und jedenfalls<br />
mit dieser Datierung fiktives) Ereignis als solchen Nullpunkt gewählt – die Geburt des<br />
christlichen Erlösers als Beginn des Jahres 1 unserer Zeitrechnung. Bei der Uhr gilt als<br />
Nullpunkt ein sich täglich wiederholendes Ereignis: die Vollendung der letzten Sekunde der<br />
letzten Stunde eines Tages bzw. der Beginn der ersten Sekunde der ersten Stunde des<br />
folgenden Tages. Für diesen Zeitpunkt haben wir den Ausdruck ‚Mitternacht’ in Gebrauch.<br />
<strong>Das</strong> Nullpunktereignis markiert das Ende des einen und den Beginn des nächsten Tages, d.h.<br />
des Zeitverlaufs (Prozesses), an den als ‚Einheitsverlauf’ (zu verstehen analog zur<br />
‚Einheitsstrecke’, z.B. 1 Meter, bei der Längenmessung) wir die Einteilung unserer Uhr<br />
gebunden haben.<br />
Diese Erläuterungen machen zusätzlich plausibel, inwiefern ‚Zeit’ zunächst als das erklärt<br />
werden kann, was wir mit Kalendern einteilen und mit Uhren messen. Diese Erklärung kann<br />
methodologisch genannt werden, weil sie auf unsere Methoden der Zeitbestimmung<br />
rekurriert. Demgegenüber ist die neue Erklärung – Zeit als Möglichkeit von Entstehen und<br />
Vergehen, Dauer und Veränderung – formal-ontologisch. Wie hängen beide Erklärungen<br />
zusammen Ich möchte nahe legen: An Entstehen und Vergehen interessiert uns primär das<br />
Datum, die Beantwortung der Frage ‚wann’, eher sekundär die Dauer dieser Vorgänge als<br />
selbst durch Anfang und Ende begrenzte Prozesse (also die Beantwortung der Frage ‚wie<br />
lange’). Bezüglich Dauer und Veränderung scheint unsere Interessenlage genau umgekehrt<br />
zu sein – zuerst wollen wir wohl wissen, wie lange eine Zustand oder seine Veränderung in<br />
einen anderen dauert, erst dann auch, wann der Zustand besteht oder die Veränderung<br />
stattfindet. Die unterschiedlichen Interessenlagen hängen sicher auch damit zusammen, dass<br />
wir an Zeitbestimmungen nicht nur theoretisch, für unser Verstehen, sondern auch praktisch,<br />
für unser Handeln, interessiert sind. Man könnte also die beiden formal-ontologischen<br />
Titelpaare für Gegenstände unseres Interesses an der Zeit ebenso wie die zuvor aufgewiesene<br />
28