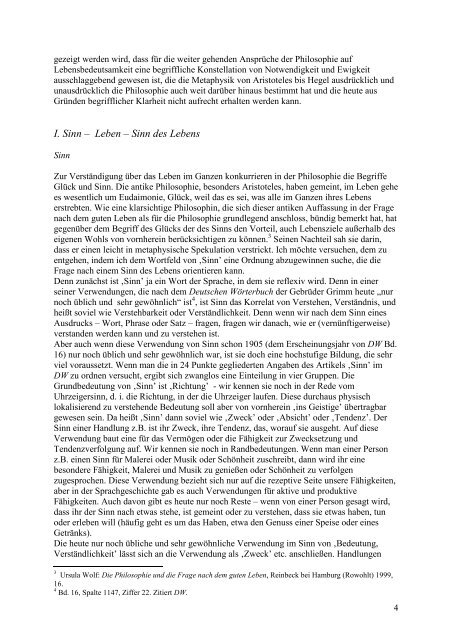Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gezeigt werden wird, dass für die weiter gehenden Ansprüche der Philosophie auf<br />
<strong>Leben</strong>sbedeutsamkeit eine begriffliche Konstellation von Notwendigkeit und Ewigkeit<br />
ausschlaggebend gewesen ist, die die Metaphysik von Aristoteles bis Hegel ausdrücklich und<br />
unausdrücklich die Philosophie auch weit darüber hinaus bestimmt hat und die heute aus<br />
Gründen begrifflicher Klarheit nicht aufrecht erhalten werden kann.<br />
I. Sinn – <strong>Leben</strong> – Sinn des <strong>Leben</strong>s<br />
Sinn<br />
Zur Verständigung über das <strong>Leben</strong> im Ganzen konkurrieren in der Philosophie die Begriffe<br />
Glück und Sinn. Die antike Philosophie, besonders Aristoteles, haben gemeint, im <strong>Leben</strong> gehe<br />
es wesentlich um Eudaimonie, Glück, weil das es sei, was alle im Ganzen ihres <strong>Leben</strong>s<br />
erstrebten. Wie eine klarsichtige Philosophin, die sich dieser antiken Auffassung in der Frage<br />
nach dem guten <strong>Leben</strong> als für die Philosophie grundlegend anschloss, bündig bemerkt hat, hat<br />
gegenüber dem Begriff des Glücks der des Sinns den Vorteil, auch <strong>Leben</strong>sziele außerhalb des<br />
eigenen Wohls von vornherein berücksichtigen zu können. 3 Seinen Nachteil sah sie darin,<br />
dass er einen leicht in metaphysische Spekulation verstrickt. Ich möchte versuchen, dem zu<br />
entgehen, indem ich dem Wortfeld von ‚Sinn’ eine Ordnung abzugewinnen suche, die die<br />
Frage nach einem Sinn des <strong>Leben</strong>s orientieren kann.<br />
Denn zunächst ist ‚Sinn’ ja ein Wort der Sprache, in dem sie reflexiv wird. Denn in einer<br />
seiner Verwendungen, die nach dem Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm heute „nur<br />
noch üblich und sehr gewöhnlich“ ist 4 , ist Sinn das Korrelat von Verstehen, Verständnis, und<br />
heißt soviel wie Verstehbarkeit oder Verständlichkeit. Denn wenn wir nach dem Sinn eines<br />
Ausdrucks – Wort, Phrase oder Satz – fragen, fragen wir danach, wie er (vernünftigerweise)<br />
verstanden werden kann und zu verstehen ist.<br />
Aber auch wenn diese Verwendung von Sinn schon 1905 (dem Erscheinungsjahr von DW Bd.<br />
16) nur noch üblich und sehr gewöhnlich war, ist sie doch eine hochstufige Bildung, die sehr<br />
viel voraussetzt. Wenn man die in 24 Punkte gegliederten Angaben des Artikels ‚Sinn’ im<br />
DW zu ordnen versucht, ergibt sich zwanglos eine Einteilung in vier Gruppen. Die<br />
Grundbedeutung von ‚Sinn’ ist ‚Richtung’ - wir kennen sie noch in der Rede vom<br />
Uhrzeigersinn, d. i. die Richtung, in der die Uhrzeiger laufen. Diese durchaus physisch<br />
lokalisierend zu verstehende Bedeutung soll aber von vornherein ‚ins Geistige’ übertragbar<br />
gewesen sein. Da heißt ‚Sinn’ dann soviel wie ‚Zweck’ oder ‚Absicht’ oder ‚Tendenz’. Der<br />
Sinn einer Handlung z.B. ist ihr Zweck, ihre Tendenz, das, worauf sie ausgeht. Auf diese<br />
Verwendung baut eine für das Vermögen oder die Fähigkeit zur Zwecksetzung und<br />
Tendenzverfolgung auf. Wir kennen sie noch in Randbedeutungen. Wenn man einer Person<br />
z.B. einen Sinn für Malerei oder Musik oder Schönheit zuschreibt, dann wird ihr eine<br />
besondere Fähigkeit, Malerei und Musik zu genießen oder Schönheit zu verfolgen<br />
zugesprochen. Diese Verwendung bezieht sich nur auf die rezeptive Seite unsere Fähigkeiten,<br />
aber in der Sprachgeschichte gab es auch Verwendungen für aktive und produktive<br />
Fähigkeiten. Auch davon gibt es heute nur noch Reste – wenn von einer Person gesagt wird,<br />
dass ihr der Sinn nach etwas stehe, ist gemeint oder zu verstehen, dass sie etwas haben, tun<br />
oder erleben will (häufig geht es um das Haben, etwa den Genuss einer Speise oder eines<br />
Getränks).<br />
Die heute nur noch übliche und sehr gewöhnliche Verwendung im Sinn von ‚Bedeutung,<br />
Verständlichkeit’ lässt sich an die Verwendung als ‚Zweck’ etc. anschließen. Handlungen<br />
3 Ursula Wolf: Die Philosophie und die Frage nach dem guten <strong>Leben</strong>, Reinbeck bei Hamburg (Rowohlt) 1999,<br />
16.<br />
4 Bd. 16, Spalte 1147, Ziffer 22. Zitiert DW.<br />
4