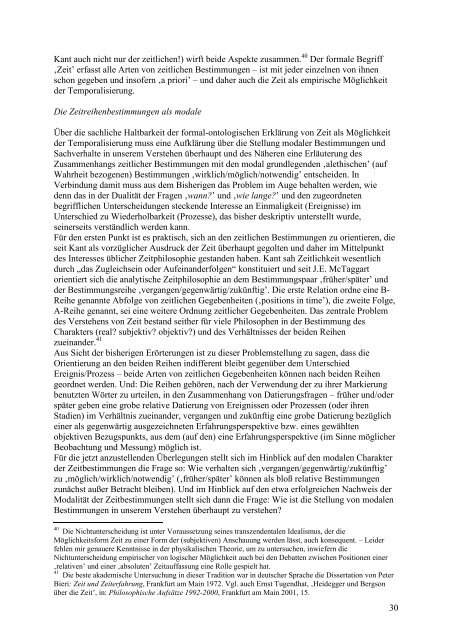Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
Das Verstandene Leben - Ernst Michael Lange
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kant auch nicht nur der zeitlichen!) wirft beide Aspekte zusammen. 40 Der formale Begriff<br />
‚Zeit’ erfasst alle Arten von zeitlichen Bestimmungen – ist mit jeder einzelnen von ihnen<br />
schon gegeben und insofern ‚a priori’ – und daher auch die Zeit als empirische Möglichkeit<br />
der Temporalisierung.<br />
Die Zeitreihenbestimmungen als modale<br />
Über die sachliche Haltbarkeit der formal-ontologischen Erklärung von Zeit als Möglichkeit<br />
der Temporalisierung muss eine Aufklärung über die Stellung modaler Bestimmungen und<br />
Sachverhalte in unserem Verstehen überhaupt und des Näheren eine Erläuterung des<br />
Zusammenhangs zeitlicher Bestimmungen mit den modal grundlegenden ‚alethischen’ (auf<br />
Wahrheit bezogenen) Bestimmungen ‚wirklich/möglich/notwendig’ entscheiden. In<br />
Verbindung damit muss aus dem Bisherigen das Problem im Auge behalten werden, wie<br />
denn das in der Dualität der Fragen ‚wann’ und ‚wie lange’ und den zugeordneten<br />
begrifflichen Unterscheidungen steckende Interesse an Einmaligkeit (Ereignisse) im<br />
Unterschied zu Wiederholbarkeit (Prozesse), das bisher deskriptiv unterstellt wurde,<br />
seinerseits verständlich werden kann.<br />
Für den ersten Punkt ist es praktisch, sich an den zeitlichen Bestimmungen zu orientieren, die<br />
seit Kant als vorzüglicher Ausdruck der Zeit überhaupt gegolten und daher im Mittelpunkt<br />
des Interesses üblicher Zeitphilosophie gestanden haben. Kant sah Zeitlichkeit wesentlich<br />
durch „das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen“ konstituiert und seit J.E. McTaggart<br />
orientiert sich die analytische Zeitphilosophie an dem Bestimmungspaar ‚früher/später’ und<br />
der Bestimmungsreihe ‚vergangen/gegenwärtig/zukünftig’. Die erste Relation ordne eine B-<br />
Reihe genannte Abfolge von zeitlichen Gegebenheiten (‚positions in time’), die zweite Folge,<br />
A-Reihe genannt, sei eine weitere Ordnung zeitlicher Gegebenheiten. <strong>Das</strong> zentrale Problem<br />
des Verstehens von Zeit bestand seither für viele Philosophen in der Bestimmung des<br />
Charakters (real subjektiv objektiv) und des Verhältnisses der beiden Reihen<br />
zueinander. 41<br />
Aus Sicht der bisherigen Erörterungen ist zu dieser Problemstellung zu sagen, dass die<br />
Orientierung an den beiden Reihen indifferent bleibt gegenüber dem Unterschied<br />
Ereignis/Prozess – beide Arten von zeitlichen Gegebenheiten können nach beiden Reihen<br />
geordnet werden. Und: Die Reihen gehören, nach der Verwendung der zu ihrer Markierung<br />
benutzten Wörter zu urteilen, in den Zusammenhang von Datierungsfragen – früher und/oder<br />
später geben eine grobe relative Datierung von Ereignissen oder Prozessen (oder ihren<br />
Stadien) im Verhältnis zueinander, vergangen und zukünftig eine grobe Datierung bezüglich<br />
einer als gegenwärtig ausgezeichneten Erfahrungsperspektive bzw. eines gewählten<br />
objektiven Bezugspunkts, aus dem (auf den) eine Erfahrungsperspektive (im Sinne möglicher<br />
Beobachtung und Messung) möglich ist.<br />
Für die jetzt anzustellenden Überlegungen stellt sich im Hinblick auf den modalen Charakter<br />
der Zeitbestimmungen die Frage so: Wie verhalten sich ‚vergangen/gegenwärtig/zukünftig’<br />
zu ‚möglich/wirklich/notwendig’ (‚früher/später’ können als bloß relative Bestimmungen<br />
zunächst außer Betracht bleiben). Und im Hinblick auf den etwa erfolgreichen Nachweis der<br />
Modalität der Zeitbestimmungen stellt sich dann die Frage: Wie ist die Stellung von modalen<br />
Bestimmungen in unserem Verstehen überhaupt zu verstehen<br />
40 Die Nichtunterscheidung ist unter Voraussetzung seines transzendentalen Idealismus, der die<br />
Möglichkeitsform Zeit zu einer Form der (subjektiven) Anschauung werden lässt, auch konsequent. – Leider<br />
fehlen mir genauere Kenntnisse in der physikalischen Theorie, um zu untersuchen, inwiefern die<br />
Nichtunterscheidung empirischer von logischer Möglichkeit auch bei den Debatten zwischen Positionen einer<br />
‚relativen’ und einer ‚absoluten’ Zeitauffassung eine Rolle gespielt hat.<br />
41 Die beste akademische Untersuchung in dieser Tradition war in deutscher Sprache die Dissertation von Peter<br />
Bieri: Zeit und Zeiterfahrung, Frankfurt am Main 1972. Vgl. auch <strong>Ernst</strong> Tugendhat, ‚Heidegger und Bergson<br />
über die Zeit’, in: Philosophische Aufsätze 1992-2000, Frankfurt am Main 2001, 15.<br />
30