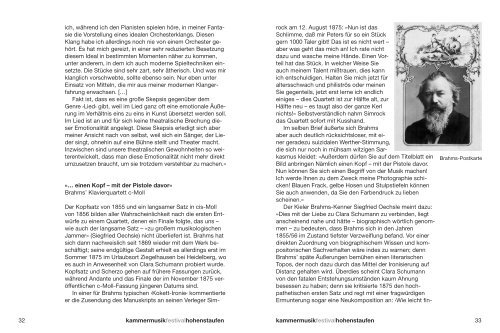7. Kammermusik Festival Hohenstaufen Evangelische Kirche ...
7. Kammermusik Festival Hohenstaufen Evangelische Kirche ...
7. Kammermusik Festival Hohenstaufen Evangelische Kirche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ich, während ich den Pianisten spielen höre, in meiner Fantasie<br />
die Vorstellung eines idealen Orchesterklangs. Diesen<br />
Klang habe ich allerdings noch nie von einem Orchester gehört.<br />
Es hat mich gereizt, in einer sehr reduzierten Besetzung<br />
diesem Ideal in bestimmten Momenten näher zu kommen,<br />
unter anderem, in dem ich auch moderne Spieltechniken einsetzte.<br />
Die Stücke sind sehr zart, sehr ätherisch. Und was mir<br />
klanglich vorschwebte, sollte ebenso sein. Nur eben unter<br />
Einsatz von Mitteln, die mir aus meiner modernen Klangerfahrung<br />
erwachsen. […]<br />
Fakt ist, dass es eine große Skepsis gegenüber dem<br />
Genre ›Lied‹ gibt, weil im Lied ganz oft eine emotionale Äußerung<br />
im Verhältnis eins zu eins in Kunst übersetzt werden soll.<br />
Im Lied ist an und für sich keine theatralische Brechung dieser<br />
Emotionalität angelegt. Diese Skepsis erledigt sich aber<br />
meiner Ansicht nach von selbst, weil sich ein Sänger, der Lieder<br />
singt, ohnehin auf eine Bühne stellt und Theater macht.<br />
Inzwischen sind unsere theatralischen Gewohnheiten so weiterentwickelt,<br />
dass man diese Emotionalität nicht mehr direkt<br />
umzusetzen braucht, um sie trotzdem verstehbar zu machen.«<br />
»… einen Kopf – mit der Pistole davor«<br />
Brahms’ Klavierquartett c-Moll<br />
Der Kopfsatz von 1855 und ein langsamer Satz in cis-Moll<br />
von 1856 bilden aller Wahrscheinlichkeit nach die ersten Entwürfe<br />
zu einem Quartett, denen ein Finale folgte, das uns –<br />
wie auch der langsame Satz – »zu großem musikologischen<br />
Jammer« (Siegfried Oechsle) nicht überliefert ist. Brahms hat<br />
sich dann nachweislich seit 1869 wieder mit dem Werk beschäftigt;<br />
seine endgültige Gestalt erhielt es allerdings erst im<br />
Sommer 1875 im Urlaubsort Ziegelhausen bei Heidelberg, wo<br />
es auch in Anwesenheit von Clara Schumann probiert wurde.<br />
Kopfsatz und Scherzo gehen auf frühere Fassungen zurück,<br />
während Andante und das Finale der im November 1875 veröffentlichen<br />
c-Moll-Fassung jüngeren Datums sind.<br />
In einer für Brahms typischen ›Kokett-Ironie‹ kommentierte<br />
er die Zusendung des Manuskripts an seinen Verleger Sim-<br />
rock am 12. August 1875: »Nun ist das<br />
Schlimme, daß mir Peters für so ein Stück<br />
gern 1000 Taler gibt! Das ist es nicht wert –<br />
aber was geht das mich an! Ich rate nicht<br />
dazu und wasche meine Hände. Einen Vorteil<br />
hat das Stück. In welcher Weise Sie<br />
auch meinem Talent mißtrauen, dies kann<br />
ich entschuldigen. Halten Sie mich jetzt für<br />
altersschwach und philiströs oder meinen<br />
Sie gegenteils, jetzt erst lerne ich endlich<br />
einiges – dies Quartett ist zur Hälfte alt, zur<br />
Hälfte neu – es taugt also der ganze Kerl<br />
nichts!« Selbstverständlich nahm Simrock<br />
das Quartett sofort mit Kusshand.<br />
Im selben Brief äußerte sich Brahms<br />
aber auch deutlich rücksichtsloser, mit einer<br />
geradezu sui zidalen Werther-Stimmung,<br />
die sich nur noch in mühsam witzigen Sarkasmus<br />
kleidet: »Außerdem dürfen Sie auf dem Titelblatt ein<br />
Bild anbringen Nämlich einen Kopf – mit der Pistole davor.<br />
Nun können Sie sich einen Begriff von der Musik machen!<br />
Ich werde Ihnen zu dem Zweck meine Photographie schicken!<br />
Blauen Frack, gelbe Hosen und Stulpstiefeln können<br />
Sie auch anwenden, da Sie den Farbendruck zu lieben<br />
scheinen.«<br />
Der Kieler Brahms-Kenner Siegfried Oechsle meint dazu:<br />
»Dies mit der Liebe zu Clara Schumann zu verbinden, liegt<br />
anscheinend nahe und hätte – biographisch wörtlich genommen<br />
– zu bedeuten, dass Brahms sich in den Jahren<br />
1855/56 im Zustand tiefster Verzweiflung befand. Vor einer<br />
direkten Zuordnung von biographischem Wissen und kompositorischen<br />
Sachverhalten wäre indes zu warnen; denn<br />
Brahms’ späte Äußerungen bemühen einen literarischen<br />
Topos, der noch dazu durch das Mittel der Ironisierung auf<br />
Distanz gehalten wird. Überdies scheint Clara Schumann<br />
von den fatalen Entstehungsumständen kaum Ahnung<br />
besessen zu haben; denn sie kritisierte 1875 den hoch -<br />
pathetischen ersten Satz und regt mit einer fragwürdigen<br />
Ermunterung sogar eine Neukomposition an: ›Wie leicht fin-<br />
Brahms-Postkarte<br />
32<br />
kammermusikfestivalhohenstaufen<br />
kammermusikfestivalhohenstaufen<br />
33