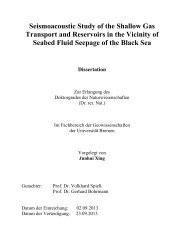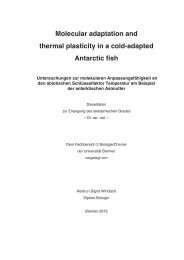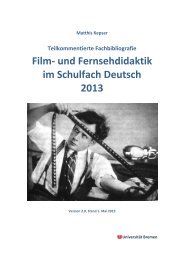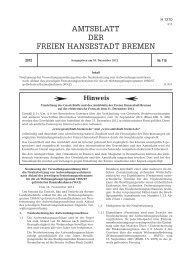de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erkenntnissen solcher Studien aufbauen<strong>de</strong>n Maßnahmen, etwa zur geschlechtssensiblen<br />
Didaktik, 56 zur Integration kommunikativer Kompetenzen in die Softwareentwicklung<br />
57 o<strong>de</strong>r zur interdisziplinären Ausrichtung von Studieninhalten, die dazu tendieren,<br />
die Geschlechterdifferenz und damit verbun<strong>de</strong>ne Stereotype selbst zu re-inszenieren 58 .<br />
Sie bringen damit Differenz als Grundlage <strong>de</strong>r Hierarchisierung erneut hervor. Nur<br />
wenige Projekte und Ansätze in diesem Bereich basieren dagegen tatsächlich auf <strong>de</strong>m<br />
theoretischen Ansatz <strong>de</strong>r Dekonstruktion von Geschlecht. 59<br />
Der dritte Bereich informatikbezogener Geschlechterforschung untersucht die<br />
Chancen, Nutzungsweisen und Wirkungen, die speziell das Internet zeigt. In diesem<br />
Themenfeld dominierten in <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>r computervermittelten Kommunikation<br />
Ansätze, die das neue Medium euphorisch als Befreiungstechnologie und als<br />
„I<strong>de</strong>ntitätswerkstatt“ auffassten. 60 In <strong>de</strong>n 1990er Jahren wur<strong>de</strong> das Internet oft als ein<br />
i<strong>de</strong>aler Raum verstan<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m überkommene Geschlechter- und Subjektkonzeptionen<br />
überwun<strong>de</strong>n, Körper und Geschlechtlichkeit neu konstituiert wer<strong>de</strong>n<br />
könnten und das Konzept <strong>de</strong>s „Doing Gen<strong>de</strong>r“ praktisch erprobbar wer<strong>de</strong>. 61 Diese<br />
Ansätze grün<strong>de</strong>n zwar theoretisch auf einem <strong>de</strong>konstruktivistischen Verständnis von<br />
Geschlecht, jedoch haben sozialwissenschaftliche Studien die formulierten Hoffnungen<br />
empirisch wi<strong>de</strong>rlegt. 62 Auch neuere Untersuchungen lieferten eher ernüchtern<strong>de</strong><br />
Erkenntnisse. Sie dokumentierten die Wie<strong>de</strong>rherstellung geschlechtsstereotyper und<br />
hierarchischer Verhältnisse in <strong>de</strong>r Nutzung <strong>de</strong>s Internet. 63 Eine an<strong>de</strong>re Studie, bei <strong>de</strong>r<br />
technische GestalterInnen befragt wur<strong>de</strong>n, versteht die Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
im Anschluss an Foucault als „Technologien <strong>de</strong>s vernetzten<br />
Selbst“. 64 Auch sie liefert damit Erkenntnisse über Subjektkonstitutionen im Technikentwicklungsprozess,<br />
nicht jedoch über die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte.<br />
Die sozialwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich somit vorwiegend mit <strong>de</strong>r<br />
Nutzung <strong>de</strong>s Internet o<strong>de</strong>r Subjektivierungsweisen und bezieht sich damit auf Aspekte,<br />
die als Gegenstand <strong>informatischer</strong> Gestaltung eine untergeordnete Rolle spielen.<br />
Im Gegensatz zu diesen empirischen Ansätzen griffen Cyberfeministinnen die<br />
frühen Verheißungen <strong>de</strong>s Internet aus <strong>einer</strong> kulturwissenschaftlichen Perspektive auf. 65<br />
Im Rekurs auf Haraway zielten cyberfeministische Interventionen auf eine symbolische<br />
Umschreibung herkömmlicher Geschlechter-Technik-Verhältnisse, die in theoretischen<br />
Texten, künstlerischen Praxen und systemimmanenten Störaktionen Ausdruck fand. 66<br />
Cyberfeministinnen versuchten zwar, Technologie im Sinne eines De-Gen<strong>de</strong>ring zu<br />
verän<strong>de</strong>rn. Dabei konzentrierten sie sich jedoch auf Re-Definitionen von Be<strong>de</strong>utung<br />
und auf Kunstformen, welche die informatikbasierten Technologien sowie <strong>de</strong>ren<br />
56 Vgl. etwa Schwarze et al. 2008.<br />
57 Vgl. etwa Mahn 1997, Schinzel et al 1999.<br />
58 Zu dieser Kritik vgl. genauer Bath 2005a, 2006c.<br />
59 Vgl. etwa Bauer/ Götschel 2006 sowie Wiesner 2007 für solche Beispiele aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Curri-<br />
cularentwicklung und Didaktik.<br />
60 Vgl. Bruckman 1992.<br />
61 Vgl. etwa Bruckman 1993, Reid 1994, Stone 1995.<br />
62 Vgl. etwa Funken 1999, 2000, Herring 2000, Eisenrie<strong>de</strong>r 2003, Lübke 2005, zu diesen technikeuphorischen<br />
Argumenten sowie <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mgegenüber ernüchtern<strong>de</strong>n empirischen Analysen vgl. auch Kapitel<br />
4.2.5.<br />
63 Vgl. etwa Carstensen 2007, Carstensen/ Winker 2005, Schachtner/ Winker 2005.<br />
64 Vgl. Paulitz 2005.<br />
65 VNS Matrix 1991, Wilding o.J., obn o.J. Mit Bezug auf diese Autorinnen verstehe ich Cyberfeminismus<br />
gera<strong>de</strong> nicht als einen weiteren Ansatz, <strong>de</strong>r darauf zielt, mehr Frauen für die Technik zu gewinnen.<br />
66 Obn o.J., Sollfrank 1999, Reiche/ Sick 2002.<br />
20