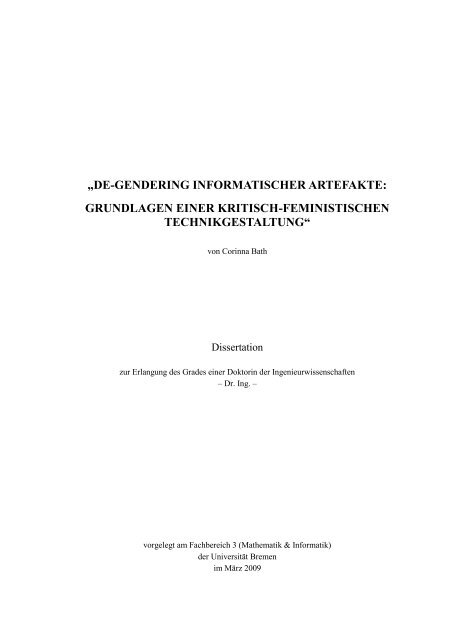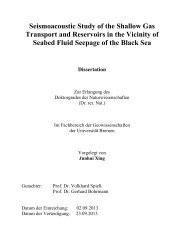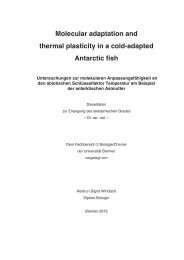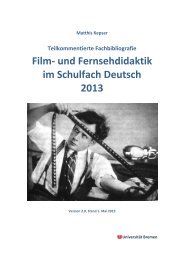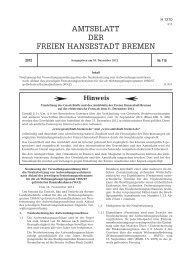de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„DE-GENDERING INFORMATISCHER ARTEFAKTE:<br />
GRUNDLAGEN EINER KRITISCH-FEMINISTISCHEN<br />
TECHNIKGESTALTUNG“<br />
von Corinna Bath<br />
Dissertation<br />
zur Erlangung <strong>de</strong>s Gra<strong>de</strong>s <strong>einer</strong> Doktorin <strong>de</strong>r Ingenieurwissenschaften<br />
– Dr. Ing. –<br />
vorgelegt am Fachbereich 3 (Mathematik & Informatik)<br />
<strong>de</strong>r Universität Bremen<br />
im März 2009
Gutachterinnen:<br />
Prof. Dr. Susanne Maaß<br />
Universität Bremen<br />
Arbeitsgruppe Soziotechnische Systemgestaltung & Gen<strong>de</strong>r<br />
Prof. Dr. Heidi Schelhowe<br />
Universität Bremen<br />
Arbeitsgruppe Digitale Medien in <strong>de</strong>r Bildung<br />
Kolloquium: 11. Mai 2009
INHALT<br />
KAPITEL 1 EINLEITUNG .......................................................................................... 1<br />
KAPITEL 2 GESCHLECHTERFORSCHUNG IN DER INFORMATIK –<br />
EINE BESTANDSAUFNAHME ............................................................................... 11<br />
2.1. Historischer Hintergrund zur Theoriebildung über Technik, Informatik<br />
und Geschlecht .............................................................................................. 11<br />
2.2. Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte:<br />
Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate im aktuellen Diskurs ................................................... 18<br />
KAPITEL 3 THEORETISCHE KONZEPTION DES GENDERING<br />
INFORMATISCHER ARTEFAKTE .......................................................................... 27<br />
3.1. Das Technische ist politisch! .......................................................................... 28<br />
3.2. Verkürzungen: Kritiken an Winners Brückenbeispiel in <strong>de</strong>r<br />
sozialwissenschaftlichen Technikforschung ................................................... 35<br />
3.3. Social Shaping of Technology, Social Construction of Technology und<br />
Akteur-Netzwerk-Theorie: Ansätze sozialwissenschaftlicher Technikforschung<br />
....................................................................................................... 41<br />
3.4. Fa<strong>de</strong>nspiele: Feministische Ansätze, Technowissenschaften und Gesellschaftskritik<br />
.................................................................................................... 55<br />
3.5. „Materiality matters“: Asymmetrie und Verantwortung .................................... 64<br />
3.6. Mensch-Maschine-Rekonfigurationen: Politik und Neuverteilung von<br />
Handlungsfähigkeit ........................................................................................ 68<br />
3.7. Wie kommt Geschlecht in technische Artefakte „hinein“? Gen<strong>de</strong>rskripte<br />
und Konfigurationen von NutzerInnen ............................................................ 78<br />
3.8. Posthumanistische Performativität und Ko-Materialisierung von Technologie<br />
und Geschlecht ................................................................................. 88<br />
3.9. Resümee: Wie lässt sich das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte theoretisch<br />
konzipieren? ....................................................................................... 95<br />
KAPITEL 4 DIE VERGESCHLECHTLICHUNG INFORMATISCHER<br />
ARTEFAKTE: FALLSTUDIEN, DIMENSIONEN UND MECHANISMEN .................. 99<br />
4.0. Von „guten Beispielen“ zu Dimensionen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte ...................................................................................................... 100<br />
4.1. Access <strong>de</strong>nied!? Problem<strong>de</strong>finitionen und Annahmen, die soziale Ausschlüsse<br />
produzieren ................................................................................... 111<br />
4.1.1. Vom impliziten Design „von und für Männer“: Haben Frauen an<strong>de</strong>re<br />
Vorlieben und Fähigkeiten bei <strong>de</strong>r Nutzung? ................................ 113<br />
4.1.2. Gegenbewegungen: Design for „the girl“? ............................................. 117<br />
4.1.3. Von Männern <strong>de</strong>finierte Probleme: Worauf geben technische<br />
Lösungen Antworten? ........................................................................... 121<br />
4.1.4. „I-Methodology“:„Configuring the user as everybody“ o<strong>de</strong>r Design<br />
für <strong>de</strong>n Entwickler? ............................................................................... 125<br />
i
4.2. Digitale Materialisierung strukturell-symbolischer Ungleichheit:<br />
geschlechtlich markierte Arbeitsplätze, Kompetenzen und Körper ............... 131<br />
4.2.1. Die ambivalente Konfigurierung von NutzerInnen als Frauen ................ 134<br />
4.2.2. Festschreibung geschlechtlich kodierter Strukturen in und durch IT:<br />
Von „Shaping women’s work“ zu Machtverhältnissen zwischen <strong>de</strong>n<br />
AkteurInnen .......................................................................................... 138<br />
4.2.3. „Invisible Work “ und <strong>de</strong>r Versuch, „Frauenarbeit“ sichtbar zu<br />
machen ................................................................................................. 142<br />
4.2.4. Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung in <strong>de</strong>r Dienstleistungsgesellschaft:<br />
Callcenter-Arbeit und virtuelle AssistentInnen .... 148<br />
4.2.5. Explizite Repräsentation <strong>de</strong>s Geschlechtskörpers: Avatare, Spielfiguren<br />
und anthropomorphe Softwareagenten ..................................... 155<br />
4.3. Klassifizieren, Abstrahieren und Formalisieren: (Geschlechter-)Politik<br />
und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen ................................................................. 165<br />
4.3.1. Politik <strong>de</strong>s Formalen ............................................................................. 171<br />
4.3.2. Epistemologie und Ontologie <strong>de</strong>s Formalen .......................................... 185<br />
4.3.3. Geschlechtsmarkierte Dualismen: Welchen Preis hat die Integration<br />
<strong>de</strong>s ausgeschlossenen An<strong>de</strong>ren? ......................................................... 197<br />
4.4. Resümee: Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte ............................................................................... 213<br />
KAPITEL 5 ALTERNATIVE TECHNOLOGIEGESTALTUNG: METHODISCHE<br />
KONZEPTE FÜR EIN DE-GENDERING INFORMATISCHER ARTEFAKTE ........ 217<br />
5.1. Zielsetzung alternativer Technologiegestaltung: Was soll das Ergebnis<br />
eines De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses sein?.......................................................... 218<br />
5.2. „Design for everyone“: Berücksichtigen <strong>de</strong>r Diversität von NutzerInnen ....... 220<br />
5.2.1. „User-Centered Design“ und „Usability-Tests“ für eine adäquate<br />
Mo<strong>de</strong>llierung von NutzerInnen .............................................................. 222<br />
5.2.2. Ethnographische Studien und „Cultural Probes“ für adäquate<br />
Problem<strong>de</strong>finitionen von Technologien privater Nutzung....................... 225<br />
5.2.3. „Personas“: Zur Problematik <strong>de</strong>r Auswahl von Testpersonen und<br />
Freiwilligen ............................................................................................ 230<br />
5.3. Design für spezifische NutzerInnengruppen: Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Kompetenzannahmen und Arbeitsteilung überwin<strong>de</strong>n ...................................... 233<br />
5.3.1. „Contextual Design“ und Szenarien-basierte Ansätze: Arbeit<br />
verstehen und „unsichtbare Arbeit“ erkennen ........................................ 234<br />
5.3.2. „Participatory Design“ und „Collective Resource Approach“: Parteinahme<br />
für strukturell Benachteiligte in <strong>de</strong>r Technikgestaltung ............... 238<br />
5.3.3. Organisations-Design-Spiele und Zukunftswerkstätten:<br />
Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung in Organisationen<br />
aushan<strong>de</strong>ln ........................................................................................... 243<br />
5.3.4. Projekte „von und für Frauen“: Erfahrungen mit Qualifizierung,<br />
betrieblichem und technischem Empowerment in <strong>de</strong>r Praxis ................ 247<br />
ii
5.4. „Design for Experience and Reflection“: Geschlecht durch Technologie<br />
<strong>de</strong>konstruieren ............................................................................................. 254<br />
5.4.1. „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“: Vervielfältigung „weiblicher“ und<br />
„männlicher“ I<strong>de</strong>ntitäten in einem spezifischen Kontext ......................... 255<br />
5.4.2. „Design for Experience“: Den NutzerInnen viel<strong>de</strong>utige und<br />
provokante Geschlechtererfahrungen ermöglichen ............................... 258<br />
5.4.3. „Reflective Design“: Prozesse <strong>de</strong>r Reflektion <strong>de</strong>s<br />
Zweigeschlechtlichkeitssystems bei GestalterInnen und NutzerInnen<br />
mit offenem Ausgang ............................................................................ 264<br />
5.5. De-Gen<strong>de</strong>ring von Formalismen, Grundannahmen und Grundlagenforschung:<br />
Ansatzpunkte und Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate................................... 269<br />
5.5.1. „Narrative Transformation“ und „Mind Scripting“: Erinnerungs- und<br />
Reflektionsarbeit mit <strong>de</strong>n DesignerInnen............................................... 270<br />
5.5.2. „Value Sensitive Design“: Eine Metho<strong>de</strong> zur Re-Kontextualisierung<br />
von formalen Artefakten ........................................................................ 280<br />
5.5.3. „Critical Technical Practice“: Das Marginalisierte ins Zentrum stellen ... 289<br />
5.5.4. Sozial- und kulturwissenschaftliche „Laborstudien“: Kritischfeministische<br />
Intervention in <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r<br />
Informatik? ............................................................................................ 294<br />
5.6. Resümee: Methodische Konzepte für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte ...................................................................................................... 301<br />
KAPITEL 6 DE-GENDERING ALS „DESIGN FÜR LEBBARE WELTEN“:<br />
ENTWURF EINER METHODIK FEMINISTISCHER TECHNOLOGIE-<br />
GESTALTUNG IN DER INFORMATIK .................................................................. 305<br />
LITERATUR ……………………………………………………………………… 319<br />
iii
Kapitel 1<br />
Einleitung<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik ist in Deutschland ein junges Feld, das sich<br />
gegenwärtig institutionell etabliert und inhaltlich schnell entwickelt. Es kann mittlerweile<br />
auf mehr als zwei Jahrzehnte engagierter Aktivität und wissenschaftlicher Forschung<br />
zurückblicken. Einen Ausgangspunkt bil<strong>de</strong>te die 1986 gegrün<strong>de</strong>te Fachgruppe<br />
„Frauenarbeit und Informatik“ in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gesellschaft für Informatik. 1 1989 fand<br />
eine erste internationale wissenschaftliche Tagung zu diesem Thema in Deutschland<br />
statt (Schelhowe 1989a). Die „Informatica Feminale“, Sommeruniversität für Frauen in<br />
<strong>de</strong>r Informatik, wird seit 1998 jährlich in Bremen durchgeführt. 2 An <strong>de</strong>r Hochschule<br />
Bremen gibt es seit 2000 einen Informatikstudiengang für Frauen. Erste Professuren<br />
für Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik wur<strong>de</strong>n an Universitäten eingerichtet (1998<br />
an <strong>de</strong>r Universität Bremen, 2004 an <strong>de</strong>r Universität Hamburg). Zahlreiche Veröffentlichungen<br />
und Tagungsbän<strong>de</strong> dokumentieren, dass sich die Geschlechterforschung in<br />
<strong>de</strong>r Informatik mittlerweile ausdifferenziert hat und ein breites Themenspektrum<br />
umfasst. 3<br />
Der Gegenstand <strong>de</strong>s neuen Fachgebiets wird in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit, zum Teil auch in<br />
<strong>de</strong>n technischen Wissenschaften, häufig nur partiell wahrgenommen. Oft wird<br />
angenommen, die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik befasse sich im<br />
Wesentlichen mit <strong>de</strong>r Untersuchung <strong>de</strong>r Frage, wie mehr Frauen für ein Studium <strong>de</strong>r<br />
Informatik und für entsprechen<strong>de</strong> Berufe gewonnen wer<strong>de</strong>n können. In diesem Diskussionszusammenhang<br />
fin<strong>de</strong>n sich Positionen, die zum einen das Geschlechter-Technik-<br />
Verhältnis auf ein „Problem <strong>de</strong>r Frauen“ verkürzen und zum an<strong>de</strong>ren Technologien als<br />
außergesellschaftlich gegeben und (geschlechts-)neutral verstehen. Auf dieser Grundlage<br />
bleiben sowohl die Disziplin Informatik als auch und <strong>de</strong>ren Produkte unhinterfragt.<br />
4 Auf Basis dieser Position ist es schwierig, für eine Verankerung <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik zu plädieren, da Geschlecht vermeintlich<br />
nichts mit <strong>de</strong>n Inhalten und Produkten <strong>de</strong>r Informatik zu tun hat.<br />
In letzter Zeit gewinnt – insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Politik – ein zweites Verständnis von<br />
<strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik Aufmerksamkeit. 5<br />
Wissenschaftliche Erkenntnisse und technische Produkte sollten sich besser an <strong>de</strong>n<br />
Bedürfnissen, Interessen und Wünschen von Frauen ausrichten, um diese als Kundinnen<br />
und Käuferinnen gewinnen zu können. Die Forschung habe <strong>de</strong>shalb<br />
„geschlechtsspezifische“ Unterschie<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Entwicklung und Nutzung von<br />
Technologien, d.h. die Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Produkte, zu berücksichtigen. 6 Die mit<br />
solchen Vorstellungen verknüpfte Interpretation <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r<br />
1 Vgl. etwa Frauenarbeit und Informatik 2006<br />
2 Vgl. http://www.informatica-feminale.<strong>de</strong>. Dieses Konzept wur<strong>de</strong> später in Ba<strong>de</strong>n-Württemberg, Österreich<br />
(Salzburg) und Neuseeland übernommen.<br />
3 Vgl. etwa Grundy et al. 1997, Oechtering/ Winker 1998, Balka/ Smith 2000, Kreutzner/ Schelhowe 2003,<br />
Schmitz/ Schinzel 2004, Archibald et al 2005, Zorn et al. 2007 sowie die internationalen Tagungen<br />
„Women, Work and Computerization“ (seit 1985) und die „European Gen<strong>de</strong>r & ICT Symposia“ (seit 2003).<br />
4 Ähnliche Argumente fin<strong>de</strong>n sich in Zusammenfassungen <strong>de</strong>r feministischen Technik<strong>de</strong>batte, vgl. etwa<br />
Gill/ Grint 1995, Bath 1996, Henwood 2000, Saupe 2002, Bath 2005.<br />
5 vgl. etwa Schavan 2007. Siehe auch die Bestrebung <strong>de</strong>s Konzerns Volvo, ein Auto „von und für Frauen“<br />
zu entwickeln, vgl. Temm 2008, Wolffram 2005.<br />
6 Vgl. hierzu Bührer/ Schraudner 2006, Schraudner/ Lukoschat 2006 sowie <strong>kritisch</strong> und ausführlicher dazu<br />
Bath 2007 sowie Kapitel 2.2.<br />
1
Informatik wie<strong>de</strong>rum unterstellt, dass es grundlegen<strong>de</strong> Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n<br />
Geschlechtern gibt. Dies ist allerdings eine umstrittene Annahme. 7 Sie ist nicht nur ein<br />
Ausdruck <strong>de</strong>r Ignoranz <strong>de</strong>r vielfältigen Lebensrealitäten von Frauen und Männern,<br />
son<strong>de</strong>rn schreibt darüber hinaus selbst bestimmte Eigenschaften, Interessen und<br />
Tätigkeiten als weibliche (o<strong>de</strong>r männliche) fest. Damit können bestehen<strong>de</strong> gesellschaftlich-symbolische<br />
Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern, Heteronormativität<br />
und das Zweigeschlechtlichkeitssystem wie<strong>de</strong>rhergestellt wer<strong>de</strong>n. Diese zweite<br />
Position ist aus <strong>de</strong>r Perspektive aktueller Ansätze <strong>de</strong>r Geschlechterforschung unhaltbar,<br />
da sie Differenzen und Hierarchien zwischen Frauen und Männern essentialisiert.<br />
Die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit soll einen Beitrag zur Überwindung <strong>de</strong>r Verkürzungen <strong>de</strong>r<br />
bisherigen Debatte leisten. Dazu wird <strong>de</strong>r Fokus von „<strong>de</strong>n Frauen“ und vermeintlichen<br />
Geschlechterdifferenzen verschoben auf die Analyse von Technik und ihre Gestaltung.<br />
Mein Ziel ist es aufzuzeigen, dass und in welchem Sinne Software, Informationssysteme<br />
und weitere Produkte <strong>informatischer</strong> Tätigkeit vergeschlechtlicht sind, ohne<br />
dabei die Kategorien Weiblichkeit und Männlichkeit erneut normativ festzuschreiben.<br />
Zugleich sollen Vorschläge für eine alternative Technologiegestaltung vorgelegt wer<strong>de</strong>n,<br />
die diesen Prozessen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung zu begegnen vermögen. „De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte“ be<strong>de</strong>utet, <strong>de</strong>m „Gen<strong>de</strong>ring“ <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Informatik<br />
produzierten Artefakte entgegenzuwirken bzw. es im Vorhinein zu vermei<strong>de</strong>n. Dabei<br />
steht <strong>de</strong>r Terminus „De-Gen<strong>de</strong>ring“ für <strong>de</strong>n im Deutschen unaussprechlichen Begriff<br />
<strong>de</strong>r „Ent-Vergeschlechtlichung“. Er soll nahe legen, dass es keine „geschlechtsneutralen“<br />
Technologien o<strong>de</strong>r „geschlechtsfreie“ technische Räume gibt. Mit Hilfe eines<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses können vielmehr höchst problematische Formen <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von informatischen Produkten verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Dies soll durch<br />
eine feministisch-<strong>kritisch</strong>e Gestaltung von Technologien erreicht wer<strong>de</strong>n.<br />
Damit schließt diese Arbeit an grundlegen<strong>de</strong> Fragen <strong>de</strong>r Informatik an: Was sind<br />
„gute“ Software- und Informationssysteme? Wie lassen sich „gute“ Software- und<br />
Informationssysteme konzipieren und gestalten? Die Qualität von Systemen wird hier<br />
allerdings nicht allein im klassischen Sinne <strong>de</strong>r Informatik ge<strong>de</strong>utet, die dazu<br />
üblicherweise Kriterien wie Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz und<br />
Fehlervermeidung heranzieht. 8 Die zu entwickeln<strong>de</strong>n Systeme sollen hier darüber<br />
hinaus an <strong>de</strong>n Erkenntnissen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung und feministischen Technikwissenschaftsforschung<br />
gemessen wer<strong>de</strong>n. Somit besteht die Aufgabe erstens darin,<br />
Kritierien für Technologien, die als „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red“ bezeichnet wer<strong>de</strong>n können, zu<br />
erarbeiten. Zweitens sind Metho<strong>de</strong>n und Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
gesucht, die InformatikerInnen und DesignerInnen dabei unterstützen, mit diesen<br />
Kriterien entsprechen<strong>de</strong> Systeme zu konzipieren und konstruieren. Bei<strong>de</strong>s setzt eine<br />
theoretische Fundierung sowie eine sorgfältige systematische Analyse <strong>de</strong>r konkreten<br />
Prozesse voraus, die zur Vergeschlechtlichung von Produkten <strong>informatischer</strong> Tätigkeit<br />
führen. Daraus leitet sich die Struktur <strong>de</strong>r drei Hauptkapitel dieser Arbeit ab: 9<br />
7<br />
Zur Kritik an <strong>de</strong>r Vorstellung frauenspezifischer Zugänge zu Technik und <strong>de</strong>r Herstellung von<br />
Geschlechterhierarchie durch Geschlechterdifferenzansätze vgl. Schelhowe 1989b, Knapp 1989, Wetterer<br />
1992, Schelhowe 1993 sowie die unter Fußnote 4 angeführten Aufsätze.<br />
8<br />
Vgl. hierzu auch John/ Allhutter 2007, die Qualitätsmaßstäbe für Software aus <strong>einer</strong> Geschlechterperspektive<br />
untersuchen.<br />
9<br />
Kapitel 2 beschreibt <strong>de</strong>n Forschungsstand zum Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte.<br />
2
� Theoretische Grundlagen: Wie lässt sich die Vergeschlechtlichung (und das De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring) <strong>informatischer</strong> Artefakte theoretisch konzipieren? (Kapitel 3)<br />
� Praktiken <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Technologien: Welche Dimensionen<br />
und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte lassen sich<br />
unterschei<strong>de</strong>n? (Kapitel 4)<br />
� Methodische Konzepte <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Technologien: Wie<br />
lassen sich Informationstechnologien so gestalten, dass sie als „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red“<br />
bezeichnet wer<strong>de</strong>n können? (Kapitel 5)<br />
Zunächst ist eine Klärung <strong>de</strong>r zentralen Grundbegriffe, „Geschlecht“, „Technologie“ und<br />
„Informatik“ notwendig. Geschlecht wird im Folgen<strong>de</strong>n im Anschluss an die<br />
Erkenntnisse <strong>de</strong>r Geschlechterforschung nicht als „gegeben“, son<strong>de</strong>rn als soziale<br />
Konstruktion begriffen, die in <strong>de</strong>r jeweiligen Zeit, Gesellschaft und Kultur verankert ist.<br />
Analytisch betrachtet wer<strong>de</strong>n generell drei eng miteinan<strong>de</strong>r verwobene Prozesse <strong>de</strong>r<br />
Konstituierung von Geschlecht unterschie<strong>de</strong>n: erstens individuelle Prozesse <strong>de</strong>r<br />
Herausbildung weiblicher und männlicher Subjekte, zweitens strukturelle Prozesse wie<br />
die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung und drittens symbolische Prozesse, etwa<br />
Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit und geschlechtliche Kodierungen von<br />
Sprache, Tätigkeiten, Kompetenzen etc. 10 Auf dieser Grundlage wird Geschlecht<br />
primär als eine Strukturkategorie gefasst, mit <strong>de</strong>r soziale Positionierungen vorgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Dazu gehören die gesellschaftliche Verteilung ökonomischer Ressourcen,<br />
beruflicher Tätigkeiten, sozialen Prestiges und von Macht. Diese strukturelle<br />
Ebene ist meist schwer von <strong>de</strong>r symbolischen Ebene zu trennen, beispielsweise von<br />
<strong>de</strong>r geschlechtlichen Zuschreibung technischer o<strong>de</strong>r sozialer Kompetenz. Ferner ist die<br />
Kategorie Geschlecht als Ungleichheitsstruktur nicht einfach gegeben, son<strong>de</strong>rn wird im<br />
Alltäglichen ständig hergestellt. Geschlecht ist das Resultat eines Prozesses <strong>de</strong>r<br />
gleichzeitigen Herstellung von sozialen Hierarchien und geschlechtlichen Subjekten,<br />
<strong>de</strong>r selbst unsichtbar erscheint und binär strukturiert ist. Zweigeschlechtlichkeit gilt als<br />
selbstverständlich und erzeugt Normalität. Sie wird gestützt durch Sprache und<br />
Zeichen. Welche Symbole im Einzelnen als weiblich und als männlich gelten, unterliegt<br />
historisch-kulturellen Wandlungen. So haben etwa geschlechtersoziologische Untersuchungen<br />
aufgezeigt, dass Berufe „ihr Geschlecht“ wechseln können und<br />
insbeson<strong>de</strong>re technische Zuschreibungen dabei eine wesentliche Rolle spielen (vgl.<br />
Gil<strong>de</strong>meister/ Wetterer 1992, Cockburn 1988 [1985]). Hier wird <strong>de</strong>utlich, welche<br />
Einsichten eine nicht-essentialistische Geschlechterforschung eröffnet: Geschlecht<br />
wird nicht als gegeben gedacht, son<strong>de</strong>rn muss ständig, unter verschie<strong>de</strong>nen<br />
Rahmenbedingungen und damit auf verschie<strong>de</strong>ne Weisen hervorgebracht wer<strong>de</strong>n.<br />
Diese Flexibilität, die zwar keine beliebigen Verän<strong>de</strong>rungen zulässt, erlaubt jedoch<br />
feministisch-<strong>kritisch</strong>e Eingriffe in die bestehen<strong>de</strong>n Deutungs- und Präsentationsmuster.<br />
Solche Verschiebungen wie<strong>de</strong>rum können strukturell wirksam wer<strong>de</strong>n. Deshalb möchte<br />
ich <strong>de</strong>n Begriff Geschlecht hier zugleich politisch und performativ verstehen.<br />
10 Vgl. hierzu Harding 1990 [1986], siehe auch Frey Steffen 2006, 12ff.<br />
3
Das in <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zugrun<strong>de</strong> gelegte Verständnis von Technik bzw.<br />
Technologie bezieht sich auf <strong>de</strong>n englischsprachigen Begriff „technology“ 11 , <strong>de</strong>r<br />
min<strong>de</strong>stens drei Be<strong>de</strong>utungsebenen umfasst: 12 erstens können Technologien<br />
materielle Objekte sein. Zweitens umfasst Technologie Formen von Wissen. Denn<br />
technische Objekte erhalten erst durch das Wissen, sie zu benutzen, zu reparieren, zu<br />
entwerfen und herzustellen, einen sozialen Sinn. Und drittens kann <strong>de</strong>r Begriff<br />
Technologie bestimmte Tätigkeiten o<strong>de</strong>r Prozesse beschreiben. Er bezieht sich auf<br />
menschliche Handlungen und Praktiken. „Ein Computer ohne Programme o<strong>de</strong>r<br />
ProgrammiererIn ist lediglich eine nutzlose Zusammenstellung von Metall-, Plastik- und<br />
Silikonteilen“ (Wajcman 1994 [1991], 31). Noch etwas weiter gefasst wird Technologie<br />
in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Wissenschafts- und Technikforschung häufig als soziotechnisches<br />
Netzwerk verstan<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r Technisches und Soziales untrennbar in<br />
Systemen menschlicher und nicht-menschlicher Akteure verbun<strong>de</strong>n ist (vgl. hierzu<br />
Kapitel 3.3.).<br />
Diese Begriffsklärung kann dazu beitragen, Technologien als materiell und in ihren<br />
sozialen Kontext eingebettet und verwoben fassen zu können. Jedoch genügt sie nicht,<br />
um die Produkte <strong>informatischer</strong> Tätigkeit umfassend zu verstehen. Die Gegenstän<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Informatik sind „Hybridobjekte“ (Siefkes et al. 1998, 3): <strong>einer</strong>seits als Notationen<br />
immateriell-geistig, an<strong>de</strong>rerseits wird ihnen eine spezifische Form <strong>de</strong>r Bewegung und<br />
<strong>de</strong>s Agierens zugesprochen, die materiell wirksam ist. Das heißt, solche Objekte sind<br />
gleichzeitig Zeichen und Gegenstand (vgl. ebd., 3f).<br />
Ein Beispiel, das <strong>de</strong>n Hybridcharakter <strong>informatischer</strong> Gegenstän<strong>de</strong> ver<strong>de</strong>utlicht, ist<br />
das für die Informatik grundlegen<strong>de</strong> Konzept <strong>de</strong>r „Turingmaschine“. Sie ist<br />
Formalismus bzw. Notation und sich bewegen<strong>de</strong> Materialität zugleich und beschreibt<br />
sowohl menschliche wie auch maschinelle Rechner. Auch ein „Automat“ (vgl. von<br />
Neumann 1958) lässt sich sowohl als Symbolsystem, Maschine o<strong>de</strong>r als natürlicher<br />
Organismus vorstellen. Ebenso können Konzepte <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung<br />
wie <strong>de</strong>r „General Problem Solver“ zugleich als psychologisch-<strong>de</strong>skriptive Theorie<br />
menschlichen Denkens und als maschinelle Simulation menschlichen Problemlösens<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n (vgl. Stach 2001, 3f). In Hybridobjekten verschwimmt daher zum<br />
einen die Dichotomie geistig-materiell, zum an<strong>de</strong>ren „auch eine an<strong>de</strong>re Differenz – die<br />
zwischen Deskription und Konstruktion. Ein Hybridobjekt nie<strong>de</strong>rzuschreiben wird nicht<br />
nur als Deskription, son<strong>de</strong>rn genauso als (Auf)bauen und damit Konstruktion interpretiert.<br />
Denn die aufgeschriebenen Zeichen fungieren zugleich als Beschreibungen und<br />
Gegenstän<strong>de</strong>, die agieren und bewegen können. Damit scheint die Differenz zwischen<br />
<strong>einer</strong> räumlich-gegenständlichen und <strong>einer</strong> in Zeichen aufgehen<strong>de</strong>n, simulierten und<br />
programmierten Welt zu verschwin<strong>de</strong>n“ (Siefkes et al. 1998, 3).<br />
Die soeben dargelegte Sichtweise informatischen Han<strong>de</strong>lns hat weit reichen<strong>de</strong><br />
Folgen für das Vorhaben <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit. Sie erweitert <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>s zu<br />
Untersuchen<strong>de</strong>n auf folgen<strong>de</strong> Art und Weise: die Auflösung <strong>de</strong>r Differenz von<br />
Deskription und Konstruktion in <strong>de</strong>r Informatik be<strong>de</strong>utet, dass eine Vergeschlechtlichung<br />
von Beschreibungen, die InformatikerInnen von Anwendungsbereichen o<strong>de</strong>r<br />
menschlichem Han<strong>de</strong>ln und Denken vornehmen, vergeschlechtlichte technische<br />
11<br />
Im englischsprachigen Raum wird nicht wie im Deutschen zwischen „Technik“ und „Technologie“ unterschie<strong>de</strong>n.<br />
12<br />
Vgl. hierzu etwa Wajcman 1994 [1991], 30f und Felt et al. 1995, 183.<br />
4
Objekte hervorbringt. Umgekehrt besteht damit die Chance, auf <strong>de</strong>r Ebene von<br />
Konzepten und Grundannahmen <strong>de</strong>r Informatik anzusetzen, um ein De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Technologien und Produkte zu erreichen. Um zu ver<strong>de</strong>utlichen, dass<br />
sich das De-Gen<strong>de</strong>ring nicht nur auf Software- und Informationssysteme, d.h.<br />
Anwendungssysteme bezieht, son<strong>de</strong>rn auch weitere Produkte <strong>informatischer</strong> Tätigkeit<br />
wie Metho<strong>de</strong>n, Konzepte und Grundannahmen, auf <strong>de</strong>nen Anwendungssysteme und<br />
Mo<strong>de</strong>llierungen in <strong>de</strong>r Informatik basieren, betrachtet wer<strong>de</strong>n sollen, spreche ich hier<br />
von „informatischen Artefakten“. Dieser Begriff betont zugleich, dass diese Metho<strong>de</strong>n,<br />
Konzepte und Grundannahmen materiell höchst wirkmächtig sind, d.h. beispielsweise,<br />
dass sie hierarchische Verhältnisse zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern strukturell-symbolisch<br />
stützen können. Mit diesem Konzept möchte ich betonen, dass diese Metho<strong>de</strong>n,<br />
Konzepte und Grundannahmen materiell höchst wirkmächtig sind, d.h. auch, dass sie<br />
Differenzen und Hierarchien zwischen Geschlechtern strukturell-symbolisch beeinflussen<br />
und mitkonstituieren.<br />
Damit bringt das Verständnis <strong>informatischer</strong> Artefakte als Hybridobjekte sowohl<br />
ethische und als auch wissenschaftstheoretische Fragen ins Spiel. In welchem<br />
Verhältnis stehen informatische Beschreibungen und mo<strong>de</strong>llierte „Wirklichkeit“? Was<br />
„tun“ InformatikerInnen? Wie lässt sich ihre Tätigkeit begreifen? Wie können InformatikerInnen<br />
ihren jeweils betrachteten Gegenstand verstehen, darstellen und technisch<br />
gestalten? Wie können sie „verantwortlich“ han<strong>de</strong>ln? Und was können Maßstäbe dafür<br />
sein? Das Vorhaben <strong>einer</strong> feministisch-<strong>kritisch</strong>en Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
schließt in <strong>de</strong>m Sinne, wie ich es anfangs eingeführt hatte, direkt an diese Fragen an.<br />
Es befin<strong>de</strong>t sich daher mitten in <strong>de</strong>n Diskussionen zur „Theorie <strong>de</strong>r Informatik“, die in<br />
Deutschland seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1980er Jahre in <strong>de</strong>m gleichnamigen Arbeitskreis (vgl. Coy<br />
et al. 1992) und auf <strong>de</strong>n entsprechen<strong>de</strong>n Fachtagungen 2001-2004 13 geführt wor<strong>de</strong>n<br />
sind.<br />
Diese Arbeit ist im Fachgebiet „Informatik und Gesellschaft“ und <strong>de</strong>r Angewandten<br />
Informatik verortet. 14 Sie zieht zur Untersuchung ihrer Fragestellung gleichzeitig<br />
Erkenntnisse <strong>de</strong>r Geschlechterforschung, <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Wissenschafts-<br />
und Technikforschung sowie <strong>de</strong>r Wissenschaftstheorie heran. Die Ergebnisse dieser<br />
Arbeit bieten an<strong>de</strong>ren Fachgebieten <strong>de</strong>r Informatik, etwa <strong>de</strong>r Softwaretechnik o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Künstlichen Intelligenz-Forschung, die hauptsächlich ein „Verfügungswissen“ (Mittelstraß<br />
2003) bereithalten, ein „Orientierungswissen“ an. Verfügungswissen ist ein<br />
Wissen um Metho<strong>de</strong>n und Mittel zu vorgegebenen Zwecken. Es beantwortet „Fragen<br />
nach <strong>de</strong>m, was wir tun können, aber nicht Fragen nach <strong>de</strong>m, was wir tun sollen. Also<br />
muss zum positiven Wissen ein handlungsorientieren<strong>de</strong>s Wissen, eben das<br />
Orientierungswissen hinzutreten, das diese Aufgabe übernimmt.“ (ebd., 41). In <strong>de</strong>r<br />
vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit wird eine Orientierung informatischen Han<strong>de</strong>lns an gesellschafts-<br />
und wissenschafts<strong>kritisch</strong>en Ansätzen, Geschlechterforschung und insbeson<strong>de</strong>re<br />
feministischer Theorie vorgeschlagen. Der Ansatz <strong>de</strong>s „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte“ stellt somit insgesamt ein höchst interdisziplinäres Unternehmen dar, das<br />
primär für die Informatik umfangreiche Übersetzungsarbeit leistet. Im Sinne lebhaft<br />
benutzter „two-way streets“ (Fausto-Sterling 1992, Heinsohn 2006) soll er jedoch auch<br />
13 Vgl. Nake et al. 2001, 2002, 2004.<br />
14 Vgl. etwa Friedrich et al. 1995, das Schwerpunktheft „Informatik und Gesellschaft als aka<strong>de</strong>mische<br />
Disziplin“ <strong>de</strong>r FifF-Kommunikation 4/2001, Fuchs/ Hofkirchner 2003, Kreowski 2008.<br />
5
<strong>de</strong>r Geschlechterforschung fundierte Erkenntnisse über die Informatik und die von ihr<br />
produzierten Artefakte zur Verfügung stellen.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n skizziere ich die einzelnen Kapitel <strong>de</strong>r Arbeit, <strong>de</strong>ren Denkbewegungen<br />
von <strong>de</strong>n Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften auf die Informatik ausgerichtet<br />
sind.<br />
In Kapitel 2 wird die Frage nach <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte, die im Zentrum <strong>de</strong>r Untersuchung <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit steht, in <strong>de</strong>n<br />
Stand <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik eingeordnet. Im Abschnitt 2.1.<br />
wer<strong>de</strong>n zentrale historische Linien <strong>de</strong>r Theoriebildung über Geschlecht und Technik<br />
bzw. Informatik dargestellt, welche die Untersuchung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
infomatischer Artefakte ermöglicht o<strong>de</strong>r auch behin<strong>de</strong>rt haben. Der Abschnitt<br />
2.2. skizziert auf dieser Basis <strong>de</strong>n aktuellen Forschungsstand zur Theorie und<br />
empirischen Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte und zu methodischen<br />
Ansätzen <strong>de</strong>r Technikgestaltung, die darauf zielen, <strong>de</strong>n Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
entgegenzuwirken.<br />
In Kapitel 3 wer<strong>de</strong>n theoretische Grundlagen erarbeitet, wie die Vergeschlechtlichung<br />
(und das De-Gen<strong>de</strong>ring) <strong>informatischer</strong> Artefakte verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n soll. Ziel<br />
dieser Untersuchungsebene ist es, Vergeschlechtlichung als politischen und performativen<br />
Prozess zu begreifen – und damit we<strong>de</strong>r als Eigenschaft von Frauen und<br />
Männern noch als eine absichtsvolle Einschreibung in die Technik (3.1. und 3.2.).<br />
Ausgehend vom Verständnis von Geschlecht als Ungleichheitsstruktur wer<strong>de</strong>n Ansätze<br />
<strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Wissenschafts- und Technikforschung, die das Verhältnis<br />
von Technik und Gesellschaft bzw. von Mensch und Maschine grundlegend beschreiben,<br />
vorgestellt sowie <strong>de</strong>ren feministische Kritiken diskutiert (3.3.). Auf dieser Basis<br />
wird in zentrale Konzepte <strong>de</strong>r feministischen Technowissenschaftsforschung eingeführt<br />
(3.4.-3.6.). Es wird das Verständnis <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung,<br />
Technologie als Netzwerk von humanen und nichthumanen AkteurInnen zu begreifen,<br />
gesellschafts<strong>kritisch</strong> und feministisch gewen<strong>de</strong>t (Haraway 1995a [1991], 1995b, 1997).<br />
Anschließend wird die Materialität <strong>de</strong>r Artefakte betont und angesichts <strong>einer</strong><br />
asymmetrisch verteilten Handlungsfähigkeit Verantwortung konzeptualisiert (Barad<br />
1998, 2003, 2007). Ferner wer<strong>de</strong>n die entwickelten Konzepte auf die Informatik<br />
bezogen (Suchman 2002a, 2007).<br />
Das in diesen drei Abschnitten entwickelte Verständnis <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
stellt die oben eingeführte Auffassung, sie als „Hybridobjekte“ zu begreifen, auf eine<br />
theoretisch fundierte Grundlage. Denn sie wer<strong>de</strong>n sowohl als handlungsfähig als auch<br />
in soziale Kontexte und Netzwerke eingebun<strong>de</strong>n aufgefasst sowie als Zeichen und<br />
Gegenstand zugleich begriffen. Ferner wird Technologiegestaltung – wie es das<br />
Fachgebiet „Informatik und Gesellschaft“ einfor<strong>de</strong>rt – als ein verantwortungsvoller<br />
Prozess aufgefasst und durch die Konzepte Haraways, Barads und Suchmans<br />
gesellschaftstheoretisch-feministisch ausgerichtet. In ihrer Zusammenschau stellen die<br />
vorgestellten Ansätze feministischer Technowissenschaftsforschung damit einen<br />
theoretischen Rahmen dar, wie sich das Verhältnis von Geschlecht und informatischen<br />
Artefakten in dieser Arbeit fassen lässt.<br />
Im letzten Teil <strong>de</strong>s Kapitels 3 wer<strong>de</strong>n konkrete Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte theoretisch begrün<strong>de</strong>t. Dazu wird das gegenwärtig viel<br />
6
ezipierte Konzept <strong>de</strong>s „Gen<strong>de</strong>rskripts“ (Rommes 2002) diskutiert. Dieses erweist sich<br />
jedoch bei genauerer Betrachtung als unzureichend für das vorliegen<strong>de</strong> Vorhaben<br />
(3.7.). Daher wird mit Rückgriff auf das Konzept <strong>de</strong>r „posthumanistischen<br />
Performativität“ (Barad 2003) ein eigener Ansatz <strong>de</strong>r „Ko-Materialisierung von<br />
Technologie und Geschlecht“ entwickelt, <strong>de</strong>r die vorgestellten Mo<strong>de</strong>lle konstruktiv auf<br />
die Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte und ihr De-Gen<strong>de</strong>ring bezieht (3.8.).<br />
Das Kapitel 4 verschiebt die analytische Perspektive von <strong>de</strong>n theoretischen<br />
Aspekten hin zu <strong>de</strong>n Praktiken <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte. Es wird<br />
gezeigt, dass die Produkte, Grundannahmen und Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Informatik<br />
vergeschlechtlicht sind. Gleichzeitig wird dargestellt, wie Geschlecht in die<br />
informatischen Artefakte „hinein gerät“. Hauptziel dieses Kapitels ist eine systematische<br />
Bestandsaufnahme vorliegen<strong>de</strong>r Analysen konkreter Vergeschlechtlichungsprozesse.<br />
Anhand von Fallstudien aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r feministischen Wissenschafts-<br />
und Technikforschung und <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Informatik wer<strong>de</strong>n <strong>einer</strong>seits<br />
Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte, an<strong>de</strong>rerseits<br />
Mechanismen, wie diese Gen<strong>de</strong>ring-Prozesse in <strong>de</strong>r Technikgestaltung und -nutzung<br />
erfolgen, herausgearbeitet.<br />
Zunächst wer<strong>de</strong>n anhand von Beispielen für die Vergeschlechtlichung physischer<br />
Artefakte wie <strong>de</strong>r Tastatur und <strong>de</strong>s Geräts „Personal Computer“ Dimensionen <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichungen <strong>informatischer</strong> Artefakte i<strong>de</strong>ntifiziert, die <strong>de</strong>m vorliegen<strong>de</strong>n<br />
empirischen Material eine Struktur geben können (4.0.). Als erste Dimension wer<strong>de</strong>n<br />
strukturelle Ausschlüsse bestimmter Personengruppen von <strong>de</strong>r Nutzung beschrieben,<br />
die aufgrund impliziter Annahmen und Problem<strong>de</strong>finitionen, auf <strong>de</strong>nen Technologien<br />
basieren, entstehen (4.1.). Die zweite Dimension umfasst die Digitalisierung von<br />
Ungleichheit durch Software, mittels <strong>de</strong>rer geschlechtsstereotype Kompetenzen,<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung sowie geschlechtlich markierte Körper<br />
technologisch fortgeschrieben wer<strong>de</strong>n (4.2.). Weitere Formen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte kommen durch die informatischen Tätigkeiten <strong>de</strong>r<br />
Formalisierung, Dichotomisierung bzw. Klassifizierung sowie durch Objektivitätsannahmen<br />
zustan<strong>de</strong>. Sie sind auf <strong>de</strong>r Ebene ontologischer Setzungen und epistemologischer<br />
Annahmen angesie<strong>de</strong>lt und betreffen insbeson<strong>de</strong>re die Grundlagenforschung <strong>de</strong>r<br />
Informatik (4.3.).<br />
Ich beziehe mich in diesem Kapitel vorwiegend auf historische Beispiele, die nicht<br />
nur gut untersucht und ausgearbeitet sind, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>nen nicht zuletzt aufgrund <strong>de</strong>r<br />
zeitlichen Distanz zu ihrer Entstehung Aspekte sichtbar wer<strong>de</strong>n, die bei aktuellen<br />
Artefakten häufig schwerer erkennbar sind, da die ForscherInnen selbst in <strong>de</strong>r eigenen,<br />
von Technologien und Geschlecht durchdrungenen Kultur befangen sind. Dieser<br />
Zugang hat zur Folge, dass die dargestellten Ergebnisse im Kontext <strong>de</strong>s in Kapitel 3<br />
entwickelten Rahmens neu interpretiert wer<strong>de</strong>n müssen, da einzelne Studien vor<br />
einem an<strong>de</strong>ren theoretischen Hintergrund durchgeführt und interpretiert wur<strong>de</strong>n.<br />
Durch dieses Neu-Lesen vorliegen<strong>de</strong>r Untersuchungen soll das Kapitel <strong>de</strong>utlich<br />
machen, dass Geschlechter-Analysen im Bereich <strong>informatischer</strong> Artefakte stets im<br />
Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Geschlecht stehen.<br />
Gegenstrategien zu problematischen Vergeschlechtlichungen können <strong>de</strong>shalb im<br />
Berücksichtigen von Differenz, <strong>de</strong>r Rekonstruktion o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Dekonstruktion von<br />
Geschlecht bestehen. In <strong>de</strong>n Fällen, in <strong>de</strong>nen sich TechnologiegestalterInnen implizit<br />
7
als RepräsentantInnen <strong>de</strong>r NutzerInnen verstehen und dadurch Technologie mit eingeschränkten<br />
Nutzungsmöglichkeiten entwickeln, kann eine <strong>kritisch</strong>e Intervention darin<br />
bestehen, diese Nutzungsoptionen <strong>de</strong>r Artefakte zu pluralisieren und multiplizieren.<br />
Falls dagegen „unsichtbare Arbeit“ bei <strong>de</strong>r Softwareentwicklung ignoriert wur<strong>de</strong>, kann<br />
versucht wer<strong>de</strong>n, diese oft weiblich konnotierten Tätigkeiten sichtbar zu machen, zu<br />
mo<strong>de</strong>llieren und durch Technologie zu unterstützen. Bei Neutralitäts- und Objektivitätsannahmen<br />
lässt sich die vermeintliche Abwesenheit <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht<br />
überprüfen. Demgegenüber kann bei geschlechtsstereotypen und sexu(alis)ierten informationstechnologischen<br />
Repräsentationen versucht wer<strong>de</strong>n, Geschlecht zu <strong>de</strong>konstruieren,<br />
um <strong>de</strong>r Ten<strong>de</strong>nz zur Normalisierung von Zweigeschlechtlichkeit und<br />
Heteronormativität entgegenzuwirken. Mein Vorschlag besteht somit darin, die Strategien<br />
<strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring je nach betrachtetem informatischen Artefakt und <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung auszudifferenzieren. Die Analysen in Kapitel 4 sind als Kern<br />
dieser Arbeit zu verstehen. Sie stellen die Verbindung zwischen <strong>de</strong>m in Kapitel 3<br />
entwickelten theoretischen Verständnis <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und<br />
Geschlecht und <strong>de</strong>n in Kapitel 5 vorgestellten, praktisch ausgerichteten methodischen<br />
Ansätzen <strong>einer</strong> alternativen Technologiegestaltung dar.<br />
In Kapitel 5 wird die Perspektive von <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichungsprozesse<br />
und von möglichen De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien zur Praxis <strong>de</strong>r alternativen<br />
Technologiegestaltung verschoben. Ziel dieser Untersuchungsebene ist es, methodische<br />
Konzepte zu entwickeln, mit Hilfe <strong>de</strong>rer „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ konzipiert<br />
und gestaltet wer<strong>de</strong>n können, um damit Grundlagen <strong>einer</strong> feministisch-<strong>kritisch</strong>en<br />
Technikgestaltung herauszuarbeiten. Durch diese speziellen Gestaltungsmetho<strong>de</strong>n<br />
sollen die in Kapitel 4 i<strong>de</strong>ntifizierten Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, ohne<br />
in die im ersten Teil aufgezeigten theoretischen Fallen hineinzugeraten. 15 Das be<strong>de</strong>utet<br />
jedoch zunächst zu klären, was ein De-Gen<strong>de</strong>ring von Technologien für die<br />
betrachteten Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung be<strong>de</strong>uten kann<br />
(5.1.). Dazu wer<strong>de</strong>n aus <strong>einer</strong> geschlechtertheoretischen Perspektive drei Ziele <strong>de</strong>s<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring unterschie<strong>de</strong>n: die Berücksichtung von Differenzen, die Inklusion (d.h.<br />
gleicher Zugang und die Aufwertung <strong>de</strong>r als weiblich gelten<strong>de</strong>n Tätigkeiten und<br />
Kompetenzen) und die De-Konstruktion von Geschlecht bzw. Technologiegestaltungsprozessen.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s formalen Charakters vieler <strong>informatischer</strong> Artefakte, die<br />
Neutralität und Objektivität suggerieren, wer<strong>de</strong>n diese Ziele ergänzt durch die Re-<br />
Kontextualisierung, Reflektion und Revision grundlegen<strong>de</strong>r Formalismen und Konzepte<br />
sowie <strong>de</strong>r Verschiebung hin zu <strong>einer</strong> konstruktivistischen Epistemologie. Insgesamt<br />
wird eine starke Situiertheit <strong>de</strong>r methodischen Vorgehensweisen empfohlen.<br />
Im Hauptteil <strong>de</strong>s Kapitels 5 sollen verschie<strong>de</strong>ne Ansätze <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Technikgestaltung<br />
in <strong>de</strong>r Informatik vorgestellt und darauf hin untersucht wer<strong>de</strong>n, inwieweit sie<br />
zu <strong>de</strong>n Zielen <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring beitragen können. Betrachtet wer<strong>de</strong>n u.a. „User-<br />
Centered Design“ (5.2.), „Participatory Design“ (5.3.), „Reflective Design“ (5.4.), „Mind<br />
Scripting“, „Value Sensitive Design“ und „Critical Technical Practice“ (5.5.). Dabei ist zu<br />
diskutieren, ob die methodischen Konzepte zum Zweck <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring informa-<br />
15 Solche Fallen könnten beispielsweise in technik- o<strong>de</strong>r sozial<strong>de</strong>terministischen Positionen o<strong>de</strong>r in <strong>einer</strong><br />
Essentialisierung von Technologie bzw. Geschlecht bestehen, vgl. hierzu Kapitel 3.<br />
8
tischer Artefakte ergänzt o<strong>de</strong>r modifiziert wer<strong>de</strong>n müssen. Dies wird möglichst konkret<br />
anhand <strong>de</strong>r in Kapitel 4 beschriebenen Fallstudien ausgearbeitet.<br />
Das Abschlusskapitel 6 stellt <strong>de</strong>n mit dieser Arbeit vorgelegten Entwurf <strong>einer</strong><br />
Methodik <strong>kritisch</strong>-feministisch Technologiegestaltung zusammenfassend dar. Dabei<br />
wird auf Potentiale <strong>de</strong>s Ansatzes ebenso hingewiesen wie auf theoretische Fallstricke,<br />
Grenzen und mögliche Fehlinterpretationen. Schließlich wird „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte“ auf <strong>de</strong>r Basis aktueller feministischer Technowissenschafts- und<br />
Geschlechterforschung – speziell Donna Haraways und. Judith Butlers Konzepte „lebbarer<br />
Welten“ bzw. „lebenswerter Leben“ – als ein Beitrag zur umfassen<strong>de</strong>ren Vision<br />
eines „Design für lebbare Welten“ dargestellt.<br />
9
Kapitel 2<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik – eine Bestandsaufnahme<br />
Die Frage nach <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte, die das<br />
zentrale Thema <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit darstellt, ist – wie die meisten<br />
wissenschaftlichen Probleme – erst auf <strong>de</strong>r Basis bestimmter fachlicher Vorarbeiten<br />
<strong>de</strong>nkbar gewor<strong>de</strong>n. Diese Arbeit baut auf einen umfangreichen Korpus an Wissen auf,<br />
<strong>de</strong>n die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik in <strong>de</strong>n letzten drei Deka<strong>de</strong>n hervorgebracht<br />
hat. Dieses Forschungsgebiet ist ein höchst interdisziplinäres. Es lässt sich<br />
we<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Erkenntnissen <strong>de</strong>r allgemeinen Geschlechterforschung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
feministischen Technikforschung noch von <strong>de</strong>n Entwicklungen <strong>de</strong>r Informatik klar<br />
trennen. Daher wird die Fragestellung <strong>de</strong>r Arbeit insgesamt in einem breiten Rahmen<br />
diskutiert.<br />
In diesem Kapitel wer<strong>de</strong>n wesentliche Erkenntnisse und Debatten <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
beschrieben, die für die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik relevant<br />
sind und eine Voraussetzung <strong>de</strong>s in dieser Arbeit vorgelegten Ansatzes darstellen.<br />
Gleichzeitig wer<strong>de</strong>n Forschungslücken herausgearbeitet, die im Zentrum <strong>de</strong>r<br />
Untersuchung <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Kapitel stehen. Im Abschnitt 2.1 wer<strong>de</strong>n Linien <strong>de</strong>r<br />
Theoriebildung zu Geschlecht und Technik bzw. Informatik in ihrer historischen<br />
Entwicklung vorgestellt, die das theoretische Fundament für eine Beschäftigung mit<br />
<strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte bil<strong>de</strong>n. Dabei wer<strong>de</strong>n<br />
konzeptionelle Hür<strong>de</strong>n, die im vorherrschen<strong>de</strong>n Wissenschaftsverständnis <strong>de</strong>r<br />
Informatik und in <strong>de</strong>n Differenzansätzen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung begrün<strong>de</strong>t sind,<br />
ebenso diskutiert, wie konstruktivistische Theorien, welche die Möglichkeit, die<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte zu <strong>de</strong>nken, prinzipiell eröffnet haben.<br />
Der Abschnitt 2.2 gibt auf dieser Grundlage einen Überblick über die zentralen, aktuell<br />
vorliegen<strong>de</strong>n Ansätze <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik. Diese wer<strong>de</strong>n in<br />
Hinblick auf ihren jeweiligen Beitrag, die Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte zu verstehen, dargelegt. Ferner wer<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n und einzelne<br />
Projekte, die sich als Ansätze eines De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte verstehen<br />
lassen, vor <strong>de</strong>m theoretischen Hintergrund eines binäritäts<strong>kritisch</strong>en Geschlechtsverständnisses<br />
diskutiert.<br />
Ziel dieses Kapitels ist es somit, die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit in <strong>de</strong>n gegenwärtigen Stand<br />
<strong>de</strong>r Forschung einzuordnen. Dabei wer<strong>de</strong>n erstens Theorie und zweitens empirische<br />
Analysen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte sowie drittens methodische Ansätze<br />
eines De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte diskutiert. Während <strong>de</strong>r Aufbau und die<br />
Hauptargumentationslinien <strong>de</strong>r gesamten Arbeit in <strong>de</strong>r Einleitung bereits positiv<br />
beschrieben wur<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n sie hier anhand <strong>de</strong>r in diesem Kapitel herausgearbeiteten<br />
Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rata ausführlich erläutert.<br />
2.1. Historischer Hintergrund zur Theoriebildung über Technik, Informatik<br />
und Geschlecht<br />
Um die Frage nach <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu<br />
erklären, ist ein historischer Rückblick auf die Theoriebildung zu <strong>de</strong>n Verhältnissen von<br />
11
Geschlecht und Technik bzw. Informatik seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren notwendig. Dabei<br />
lassen sich meines Erachtens drei grundlegen<strong>de</strong> Zeiträume differenzieren: erstens die<br />
Anfangszeit <strong>de</strong>r Disziplin Informatik in <strong>de</strong>n 1970er und 1980er Jahre, in <strong>de</strong>r ein<br />
Objektivitätsverständnis dominierte, durch das eine Vergeschlechtlichung von Technik<br />
un<strong>de</strong>nkbar war. Zu dieser Zeit war <strong>de</strong>r Geschlechterdiskurs von Differenz- und<br />
Gleichheitsansätzen geprägt. Zweitens haben sich seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren in vielen<br />
Wissenschaftsbereichen, zum Teil auch in <strong>de</strong>r Informatik, sozialkonstruktivistische und<br />
<strong>de</strong>konstruktivistische Ansätze durchgesetzt. Drittens entstan<strong>de</strong>n während <strong>de</strong>r letzten<br />
Deka<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>r Jahrtausendwen<strong>de</strong> vor allem in Bereichen außerhalb <strong>de</strong>r Informatik<br />
Konzeptionen eines De-Gen<strong>de</strong>ring, die – wie die vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit zeigt – wichtige<br />
Impulse für eine Weiterentwicklung <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
gegeben haben.<br />
Differenz vs. Gleichheit in <strong>einer</strong> als objektiv und wertfrei gelten<strong>de</strong>n Disziplin<br />
In <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>r Informatik war zwar <strong>de</strong>r geringe Frauenanteil innerhalb <strong>de</strong>s<br />
aka<strong>de</strong>mischen Faches und in informatischen Berufen offensichtlich, 16 jedoch wur<strong>de</strong> die<br />
Disziplin selbst als objektiv, wertfrei und damit als geschlechtsneutral angesehen.<br />
Dieses Wissenschaftsverständnis kann unter an<strong>de</strong>rem durch die starken historischen<br />
Wurzeln <strong>de</strong>r Informatik in <strong>de</strong>r Mathematik und Elektrotechnik erklärt wer<strong>de</strong>n, die bis<br />
heute in <strong>de</strong>n Zweigen <strong>de</strong>r Theoretischen Informatik und Technischen Informatik<br />
präsent sind. 17 Deshalb zeigten zwar viele FachvertreterInnen durchaus ein Interesse<br />
an <strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>n für die Unterrepräsentanz von Frauen sowie an möglichen Maßnahmen,<br />
diese Situation zu verbessern. Allerdings wur<strong>de</strong>n diese Fragen nicht notwendigerweise<br />
als ein legitimes Teilgebiet <strong>de</strong>r Informatik aufgefasst, son<strong>de</strong>rn vorwiegend<br />
in <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Frauenför<strong>de</strong>rung und Gleichstellung verwiesen. 18<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r engen Verflechtungen von Informationstechnologie und sozialkulturellen<br />
Entwicklungen konnten die Themen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung – im<br />
Unterschied zu <strong>de</strong>n meisten an<strong>de</strong>ren naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen –<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Informatik einen Platz fin<strong>de</strong>n. Sie wur<strong>de</strong>n und wer<strong>de</strong>n primär im Fachgebiet<br />
„Informatik und Gesellschaft“ verhan<strong>de</strong>lt, welches die Wechselwirkungen von Informationstechnologie<br />
mit Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Individuen<br />
untersucht. 19 In diesem Rahmen wur<strong>de</strong>n zunächst biografische und strukturelle<br />
Ursachen für die ungleiche Partizipation <strong>de</strong>r Geschlechter an <strong>de</strong>r Disziplin diskutiert. 20<br />
Gleichzeitig wiesen feministische InformatikerInnen auch auf Zusammenhänge <strong>de</strong>r<br />
Unterrepräsentanz von Frauen mit <strong>de</strong>m Verständnis von Informatik als objektiver<br />
Wissenschaft sowie als technisch orientierter bzw. ingenieurwissenschaftlicher<br />
Disziplin hin. 21 Sie argumentierten dabei in erster Linie auf <strong>einer</strong> wissenschaftstheore-<br />
16<br />
Freyer 1993 zufolge lag <strong>de</strong>r Frauenanteil unter <strong>de</strong>n Informatikstudieren<strong>de</strong>n in Deutschland 1980 bei<br />
19% und sank bis 1991 auf 10%. Im Studienjahr 2007/2008 beträgt dieser Anteil wie<strong>de</strong>r 17%, doch nur<br />
8,5% <strong>de</strong>r Professuren sind mit Frauen besetzt (Quelle: Jahresbericht <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gesellschaft für<br />
Informatik für das Studienjahr 2007/2008).<br />
17<br />
Zur Entstehungsgeschichte <strong>de</strong>r Informatik an <strong>de</strong>utschen Universitäten vgl. Coy 2004.<br />
18<br />
Vgl. hierzu auch Bath 2001b, 2002a.<br />
19<br />
Vgl. etwa Friedrich/ Hermann/ Peschek/ Rolf 1995, Schwerpunktheft „Informatik und Gesellschaft als<br />
aka<strong>de</strong>mische Disziplin“ <strong>de</strong>r FifF-Kommunikation 4/2001, Fuchs/ Hofkirchner 2003, Kreowski 2008.<br />
20<br />
Vgl. etwa Hoffmann 1987, Roloff 1989, Behnke 1992, Funken/ Schinzel 1993, Schmitt 1993, Schinzel et<br />
al. 1998, Schinzel 2000.<br />
21<br />
Vgl. etwa Schinzel 1992, 1993, siehe auch Grundy 1998, 2000a, b.<br />
12
tischen Ebene gegen verengte Vorstellungen <strong>de</strong>r Disziplin. Diese Kritik, die <strong>de</strong>m<br />
damaligen Stand <strong>de</strong>r feministischen Naturwissenschaftsanalyse entsprechend auf<br />
Metaphernanalysen und Geschlechtersymbolismen basierte, erschienen jedoch<br />
schwer auf die Konzepte <strong>de</strong>r Softwareentwiklung und Informatik übertragbar. Denn es<br />
blieb unklar, wie vermeintlich weibliche Vorlieben fürs Konkrete, Subjektive und Emotionale<br />
für die Konzeption und Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte produktiv nutzbar<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n könnte, da <strong>de</strong>r „Kern“ informatischen Han<strong>de</strong>lns gera<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>n<br />
jeweiligen Gegenpolen, das heißt auf <strong>de</strong>m Abstrakten, Objektiven und Rationalen, zu<br />
beruhen schien. 22<br />
Da die bis zu dieser Zeit vorherrschen<strong>de</strong>n feministischen Ansätze vorwiegend auf<br />
Erklärungsmo<strong>de</strong>llen basierten, die eine produktive Übersetzung zwischen Geschlechterforschung<br />
und Informatik erschwerten, war die Frauenforschung <strong>de</strong>r 1970er und<br />
1980er Jahre quasi gespalten. 23 Einerseits war sie von liberalen Ansätzen geprägt, die<br />
auf die Gleichstellung <strong>de</strong>r Geschlechter zielten und die Wissenschaft und Technik<br />
selbst nicht hinterfragten. An<strong>de</strong>rerseits dominierten vor allem ökofeministische Positionen,<br />
die eine <strong>kritisch</strong>e Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit Technik weitgehend verhin<strong>de</strong>rten. 24<br />
Denn <strong>de</strong>r Ökofeminismus verstand Technik als inhärent und essentiell patriarchal und<br />
begrün<strong>de</strong>te damit eine prinzipielle Ablehnung von Technologien, die auch die<br />
Beteiligung an <strong>de</strong>ren technischer (Neu-)Entwicklung und Konstruktion betraf. Als<br />
TechnikgestalterInnen konnten sich feministische Informatikerinnen nicht direkt auf<br />
diesen Ansatz beziehen. 25 Dennoch diskutierten sie Varianten, die ebenso wie <strong>de</strong>r<br />
Ökofeminismus eine prinzipielle Differenz zwischen Frauen und Männern unterstellten.<br />
Einige Vertreterinnen sahen Chancen für Frauen in <strong>de</strong>r Informatik darin, dass kommunikative<br />
und generell soziale Kompetenzen, die als weibliche Eigenschaften verstan<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r Software-Entwicklung an Be<strong>de</strong>utung gewannen. 26 Dieses Argument<br />
wur<strong>de</strong> von Feministinnen wie von kultur<strong>kritisch</strong>en VertreterInnen <strong>de</strong>r Disziplin<br />
dahingehend gewandt, große Hoffnungen auf Frauen zu setzen. Gera<strong>de</strong> sie könnten<br />
eine verantwortungsvollere, menschlichere Technik als die bestehen<strong>de</strong> entwickeln, da<br />
sie qua Geschlecht o<strong>de</strong>r Sozialisation fürsorglicher und sozialer als Männer seien. 27<br />
Als eine weitere Variante geschlechtsdifferenzieren<strong>de</strong>r Zuweisungen wur<strong>de</strong> die These<br />
vom frauenspezifischen Zugang zu Technik bzw. von weiblichen Umgangsweisen mit<br />
Artefakten vertreten 28 und die Behauptung diskutiert, dass es harte und weiche<br />
Programmierstile gäbe, die geschlechtlich zugeordnet wer<strong>de</strong>n könnten. 29 Insgesamt<br />
waren diese Ansätze jedoch äußerst umstritten. Sie unterminierten zu<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>n<br />
22 Vgl. etwa Krabbel 1988.<br />
23 Für Überblicke zur feministischen Technik<strong>de</strong>batte vgl. Gill/Grint 1995, Bath 1996, Singer 1998,<br />
Henwood 2000, Saupe 2002, sowie speziell für die Informatik Bath 2000, 2005, Maaß et al. 2007.<br />
24 Die bekannteste <strong>de</strong>utsche Vertreterin <strong>de</strong>s Ökofeminismus ist Maria Mies, vgl. Mies 1984, 1990 [1984].<br />
Zur Gleichsetzung von Frau und Natur, die mit <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>r Unvereinbarkeit von Weiblichkeit und<br />
Technik korreliert vgl. <strong>kritisch</strong> Wichterich 1995.<br />
25 Dennoch wur<strong>de</strong>n insbeson<strong>de</strong>re die Auswirkungen <strong>de</strong>s Computereinsatzes auf Frauen(arbeitsplätze)<br />
<strong>kritisch</strong> beurteilt, vgl. etwa Webster 1996, siehe auch die kontroverse Diskussion um Telearbeit, vgl. etwa<br />
Winker 1997.<br />
26 So fragt etwa Reisin 1988a, ob menschenzentrierte Softwareentwicklung ein typisch weibliches Anliegen<br />
sei. Zehn Jahre später belegt Funken 1998, dass weibliche TechnikgestalterInnen die NutzerInnen<br />
besser verstün<strong>de</strong>n.<br />
27 Vgl. etwa Janshen 1990 sowie <strong>kritisch</strong> dazu Holtgreve 1991, Bath 2000.<br />
28 Vgl. etwa Bran<strong>de</strong>s/ Schiersmann 1986, Schiersmann 1987 sowie <strong>kritisch</strong> dazu Schelhowe 1989b.<br />
29 Vgl. etwa Turkle 1986.<br />
13
Augen <strong>de</strong>rjenigen FachvertreterInnen, die von einem durch Objektivität geprägten<br />
Wissenschaftsverständnis ausgingen, die Glaubwürdigkeit <strong>de</strong>r Geschlechterforschung.<br />
Die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik bewegte sich somit lange Zeit im<br />
Wesentlichen zwischen zwei Polen: <strong>de</strong>m liberalen Ansatz, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>r<br />
prinzipiellen Gleichheit <strong>de</strong>r Geschlechter beruht, und <strong>de</strong>m Differenzansatz, <strong>de</strong>r prinzipielle<br />
Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern unterstellt. Während die Maßnahmen<br />
<strong>de</strong>s liberalen Ansatzes letztendlich erfolglos blieben, insofern sie sich ausschließlich<br />
auf die För<strong>de</strong>rung von Frauen konzentrierten, 30 ohne dabei das institutionell-kulturelle<br />
Umfeld zu verän<strong>de</strong>rn, ließen sich die Thesen zur Differenz zwischen <strong>de</strong>n<br />
Geschlechtern empirisch nicht ein<strong>de</strong>utig nachweisen.<br />
Sozialkonstruktivistische Ansätze in <strong>de</strong>r Geschlechter- und Technikforschung<br />
Erst mit <strong>einer</strong> sozialkonstruktivistischen Auffassung von Geschlecht, aber auch von<br />
Technik, die sich ab <strong>de</strong>n 1990er Jahren zunehmend durchsetzte, geriet die<br />
festgefahrene, zwischen Differenz und Gleichheitsansätzen polarisierte Debatte in<br />
Bewegung. 31 Diese Verschiebung in <strong>de</strong>n theoretischen Konzepten ermöglichte es nun,<br />
nach <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte zu fragen, ohne Technik – wie<br />
beim Gleichheitsansatz – prinzipiell als neutral zu betrachten o<strong>de</strong>r – wie beim<br />
Differenzansatz – per se als „männlich“ zu begreifen. Vielmehr konnten nun jenseits<br />
pauschaler Technik- und Geschlechterauffassungen Prozesse <strong>de</strong>r Zuweisungen von<br />
technischen Artefakten zu Geschlechterkonstruktionen auf Basis konstruktivistischer<br />
Ansätze in <strong>de</strong>n Blick genommen wer<strong>de</strong>n. 32<br />
Zu <strong>de</strong>m neuen Verständnis von Geschlecht in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung hatte<br />
insbeson<strong>de</strong>re die breite Rezeption von Judith Butlers Arbeiten beigetragen, die sich<br />
gegen Naturalisierungen wandte und Geschlecht zugleich als einen Effekt von Diskurs<br />
begreift. 33 Ihr Ansatz unterlief die bis dato in <strong>de</strong>m Gebiet übliche Unterscheidung<br />
zwischen körperlichem und sozialem Geschlecht (im Englischen „sex“ und „gen<strong>de</strong>r“)<br />
und eröffnete <strong>de</strong>n Blick auf die performativen Prozesse <strong>de</strong>r Herstellung von Geschlechtern<br />
und Subjekten. Jedoch erschien <strong>de</strong>n GeschlechterforscherInnen in <strong>de</strong>r Infomatik<br />
diese Forschungsperspektive zunächst ebenso schwer mit <strong>de</strong>n konstruktiv-technischen<br />
Ansprüchen ihrer Disziplin verknüpfbar wie die frühen wissenschaftstheoretischen<br />
Kritiken. 34 Die Diskussionen und Fallstudien zu <strong>de</strong>n Geschlechter-Technik-Verhältnissen<br />
waren in <strong>de</strong>n 1990er Jahren <strong>de</strong>shalb vorwiegend auf Perspektiven <strong>de</strong>s „Doing<br />
Gen<strong>de</strong>r“ 35 (and Technology) beschränkt, ohne dabei das Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
grundlegend zu hinterfragen und ohne dabei <strong>de</strong>n eigenen Anteil daran, dieses<br />
strikt binär konzipierte System durch <strong>de</strong>n Bezug auf „Frauen“ o<strong>de</strong>r Geschlechterdifferenzen<br />
in wissenschaftliche Arbeiten mitzukonstruieren und aufrechtzuerhalten,<br />
ausreichend zu reflektieren.<br />
30<br />
Vgl. hierzu Henwood 2000, Bath 2000, Saupe 2002<br />
31<br />
Für einen Überblick über verschie<strong>de</strong>ne Strömungen <strong>de</strong>s Konstruktivismus in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
vgl. etwa Helduser et al. 2004.<br />
32<br />
Vgl. hierzu auch Bath 2002a.<br />
33<br />
Vgl. Butler 1991 [1990], 1995 [1993], für die Rezeption ihres Ansatzes in Deutschland vgl. das Schwerpunktheft<br />
„Kritik <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht“ <strong>de</strong>r Feministischen Studien 2/1993 sowie zusammenfassend<br />
Knapp 2000.<br />
34<br />
Vgl. hierzu die Tagung „Erfahrung und Abstraktion. Frauensichten auf die Informatik“ in Hamburg 1994.<br />
Für einen Tagungsbericht siehe Löchel 1994.<br />
35 Vgl. West/ Zimmerman 1987.<br />
14
GeschlechterforscherInnen in <strong>de</strong>r Informatik bezogen sich vor allem auf <strong>kritisch</strong>e<br />
Ansätze in <strong>de</strong>r Disziplin, die nach <strong>de</strong>n historischen, gesellschaftlichen und wissenschaftstheoretischen<br />
Grundlagen <strong>de</strong>s Faches fragten. 36 Aufgrund <strong>de</strong>s verstärkten<br />
Einsatzes von Computern an Arbeitsplätzen im Laufe <strong>de</strong>r 1980er Jahre wur<strong>de</strong> zunehmend<br />
<strong>de</strong>utlich, dass Softwareentwicklung als Gestaltung von Arbeit zu verstehen ist.<br />
Deshalb plädierten <strong>kritisch</strong>e FachvertreterInnen für eine Erweiterung <strong>de</strong>s vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
wissenschaftlichen Selbstverständnisses <strong>de</strong>r Informatik um arbeits- und sozialwissenschaftliche<br />
Erkenntnisse und Metho<strong>de</strong>n. 37 Dieser Aufruf wur<strong>de</strong> von feministischer<br />
Seite <strong>einer</strong>seits auf <strong>einer</strong> theoretischen Ebene begrüßt. 38 Zugleich griffen<br />
Frauen- und Geschlechterforscherinnen diese For<strong>de</strong>rung auf, um im Zuge <strong>de</strong>r mit<br />
Informationstechnik verbun<strong>de</strong>nen Neuorganisation betrieblicher Strukturen auch<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilungen und Zuweisungen zu verän<strong>de</strong>rn. 39 Das<br />
Vorhaben, die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten an sogenannten Frauenarbeitsplätzen<br />
durch eine entsprechen<strong>de</strong> Technikgestaltung zu verbessern, wur<strong>de</strong> zu einem<br />
zentralen Anliegen <strong>de</strong>r Frauen- und Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik.<br />
Parallel zu <strong>de</strong>n Entwicklungen in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung und Informatik setzten<br />
sich während <strong>de</strong>r 1990er Jahre auch in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
konstruktivistische Ansätze durch. 40 Diese begriffen Technik als soziale Konstruktion<br />
und setzten sie nicht mehr als gegeben o<strong>de</strong>r als fertiges Produkt voraus. Vielmehr<br />
konnten nun die historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse differenziert<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n, die Technologie Be<strong>de</strong>utung verleihen. In <strong>de</strong>r feministischen Technikforschung<br />
41 wur<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n Konzepte <strong>de</strong>r sozialen Konstruktion (wohlbemerkt<br />
aber nicht die <strong>de</strong>konstruktiven Ansätze) von Geschlecht und von Technik zusammengedacht.<br />
Seither kann von <strong>de</strong>r „Ko-Konstruktion von Technik und Geschlecht“ ausgegangen<br />
wer<strong>de</strong>n: „An emerging technofeminism conceives of a mutually shaping<br />
relationship between gen<strong>de</strong>r and technology, in which technology is both a source and<br />
a consequence of gen<strong>de</strong>r relations. In other words, gen<strong>de</strong>r relations can be thought of<br />
as materialized in technology, and masculinity and femininity in turn acquire their<br />
meaning and character through their enrolment and embed<strong>de</strong>dness in working<br />
machines“ (Wajcman 2004, 107).<br />
Das Konzept <strong>de</strong>r Ko-Konstruktion von Technik und Geschlecht 42 ist ein wichtiger<br />
Meilenstein dafür, das Gen<strong>de</strong>ring von Informationstechnologien theoretisch zu fassen.<br />
Fallstudien auf dieser Grundlage beschäftigen sich jedoch bisher eher mit <strong>de</strong>r Konstitution<br />
von Subjekten und Netzwerken, etwa <strong>de</strong>r Frage, wie durch Technik (hegemoniale)<br />
Männlichkeit hergestellt wird, o<strong>de</strong>r sie untersuchen vergeschlechtlichte Berufskulturen<br />
in <strong>de</strong>n Ingenieurwissenschaften sowie auch Nutzungsaspekte <strong>de</strong>s Internet. 43<br />
Damit fokussieren die Analysen, wie sich Geschlecht und Technik gleichzeitig<br />
36<br />
Vgl. Coy et al. 1992, Floyd et al. 1992, siehe auch Hellige 2004.<br />
37<br />
Später wur<strong>de</strong> diesem Argument hinzugefügt, dass <strong>de</strong>r mediale Charakter <strong>de</strong>s Computers und die<br />
Interaktivität von Computersystemen eine Erweiterung <strong>de</strong>s Wissenschaftsverständnisses in <strong>de</strong>r Informatik<br />
notwendig mache, vgl. Coy 1995, Schelhowe 1997.<br />
38<br />
Vgl. Schelhowe 1993, Erb 1996, Schelhowe 2004, Björkman 2005<br />
39<br />
Vgl. hierzu die frühen feministischen Projekte <strong>de</strong>s „Participatory Design“ <strong>de</strong>r Skandinavischen Schule,<br />
die in Kapitel 5.3.diskutiert wer<strong>de</strong>n. Für ein Beispiel aus <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Raum vgl. etwa Winker 1995.<br />
40<br />
Vgl. MacKenzie/ Wajcman 1985, Bijker et al. 1987, Bijker/ Law 1992 sowie die Ausführungen in Kapitel<br />
3.3.<br />
41<br />
Für Überblicke vgl. etwa Wajcman 1994 [1991], Wajcman 2007.<br />
42<br />
Vgl. etwa Faulkner 2001, Wajcman 2004.<br />
43<br />
Vgl. etwa Paulitz 2005, Carstensen 2007, Schachtner/ Winker 2005 sowie Faulkner 2007.<br />
15
konstituieren, stärker auf die Seite <strong>de</strong>r vergeschlechtlichten Subjekte und weniger auf<br />
die Herstellung <strong>de</strong>r technischen Artefakte, die im Zentrum dieser Arbeit steht. Darüber<br />
hinaus kann mit Blick auf das Anliegen <strong>einer</strong> theoretischen Fundierung <strong>de</strong>r Fragestellung<br />
dieser Arbeit kritisiert wer<strong>de</strong>n, dass das Konzept <strong>de</strong>r Ko-Konstruktion von<br />
Technik und Geschlecht <strong>de</strong>n Hybridcharakter <strong>informatischer</strong> Artefakte als Zeichen und<br />
Gegenstand nicht ausreichend berücksichtigt. Denn ein umfassen<strong>de</strong>s Verständnis<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte als Hybridobjekte erfor<strong>de</strong>rt zusätzliche ethische und epistemologische<br />
Analyseebenen, 44 die über die sozialwissenschaftlichen Perspektiven, aus<br />
<strong>de</strong>nen heraus das Konzept entwickelt wur<strong>de</strong>, hinausweisen.<br />
Für eine Analyse <strong>de</strong>r wissenschaftstheoretischen Aspekte <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte sind daher auch die Interventionen Donna Haraways von<br />
zentraler Be<strong>de</strong>utung (vgl. Haraway 1995d [1988]). 45 Haraway übernahm von <strong>de</strong>n<br />
frühen ökofeministischen Ansätzen <strong>de</strong>n wissenschafts<strong>kritisch</strong>en Anspruch, wen<strong>de</strong>te<br />
diesen jedoch zugleich politisch wie poststrukturalistisch. Der objektivistische Blick von<br />
Nirgendwo („view from nowhere“) ist ihr zufolge nicht möglich, da Wissen stets von<br />
einem spezifischen historischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ort aus entsteht.<br />
D.h. Wissen ist physisch und physikalisch verkörpert, sozial konstruiert und in kulturelle<br />
Politiken eingebun<strong>de</strong>n sowie durch das forschen<strong>de</strong> Subjekt bedingt, <strong>de</strong>ssen Geschlecht,<br />
Klasse, Ethnie und subjektive Erfahrungen die Forschungsergebnisse<br />
mitbestimmen. Deshalb ist je<strong>de</strong>s Wissen notwendigerweise parteilich, verortet und<br />
situiert.<br />
In ihrem berühmten Cyborg-Manifest bezog Haraway (1995c [1985], 35ff) darüber<br />
hinaus <strong>de</strong>zidiert Position gegen <strong>de</strong>n Ökofeminismus und <strong>de</strong>ssen Annahme essentialistischer<br />
Geschlechterdifferenz. Statt Technik zu dämonisieren analysierte sie die<br />
aktuellen Technowissenschaften aus politischer, erkenntnistheoretischer und feministischer<br />
Perspektive. Dabei konstatierte sie eine Auflösung <strong>de</strong>r geschlechtlich kodierten<br />
Dichotomie von Natur und Kultur, aber auch <strong>de</strong>r Grenzen zwischen Mensch und<br />
Maschine. FeministInnen rief sie explizit dazu auf, diese Grenzverwischung zu genießen<br />
und Verantwortung bei <strong>de</strong>ren Neukonstruktion zu übernehmen. Damit ist ihr<br />
Ansatz nicht nur wissenschaftstheoretisch und ethisch zu verstehen, son<strong>de</strong>rn for<strong>de</strong>rt zu<br />
(feministischen) Interventionen auf. Mit Hilfe ihrer theoretischen Konzeptionen wird<br />
eine feministische Technikgestaltung jenseits <strong>de</strong>r These frauenspezifischen Umgangs<br />
mit Technik und <strong>de</strong>r Hoffnung, <strong>de</strong>rzufolge Frauen eine bessere, sozial verträgliche<br />
Technik entwickeln wür<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nkbar. Haraway stellt jedoch kein explizites Konzept <strong>de</strong>s<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring von Technologien zu Verfügung. 46<br />
Theoretische Konzepte <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
Aus an<strong>de</strong>ren Disziplinen und zu an<strong>de</strong>ren Gegenstandbereichen als technischen Artefakten<br />
dagegen liegen bereits ausgearbeitete Vorschläge für ein De-Gen<strong>de</strong>ring vor. So<br />
zielt etwa das Konzept <strong>de</strong>r Soziologin Judith Lorber (vgl. Lorber 2000, 2004) auf eine<br />
radikale Auflösung <strong>de</strong>r Zwei-Geschlechter-Struktur. „Ein einfacher Einstieg in das<br />
44<br />
Zur Notwendigkeit, ethische und wissenschaftstheoretische Aspekte in die Analyse <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte einzubeziehen vgl. die Ausführungen in <strong>de</strong>r Einleitung.<br />
45<br />
Für einen Überblick über die Rezeption Haraways im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum vgl. etwa<br />
Messerschmidt 2007.<br />
46<br />
Zu Haraways Ansatz vgl. auch die Ausführungen in Kapitel 3.4<br />
16
Degen<strong>de</strong>ring besteht darin, sich klar zu machen, dass die bei<strong>de</strong>n Geschlechter alles<br />
an<strong>de</strong>re als homogene Kategorien sind, da in <strong>de</strong>n meisten westlichen Gesellschaften<br />
alle möglichen an<strong>de</strong>ren Formen <strong>de</strong>s sozialen Status – rassisch-ethnische Gruppe,<br />
soziale Klasse, Familienstand, Status <strong>de</strong>r Eltern, nationale I<strong>de</strong>ntität, Religionszugehörigkeit<br />
– sowie individuelle Varianten wie Alter, sexuelle Orientierung und körperliche<br />
Verfassung quer durch sie hindurchgehen. […] Zusätzlich zu dieser bewussten<br />
Wahrnehmung <strong>de</strong>r Komplexität <strong>de</strong>r Geschlechter besteht ein an<strong>de</strong>rer wichtiger<br />
Prozess <strong>de</strong>s Degen<strong>de</strong>ring darin, sich klar zu machen, dass Frauen und Männer in<br />
ihrem Verhalten, ihrem Denken und ihren Gefühlen ähnlich sind, und bei diesen<br />
Ähnlichkeiten anzusetzen – also die Geschlechtergrenzen zu verwischen“ (Lorber<br />
2004, 10). Geschlecht träte <strong>de</strong>mnach zurück, wenn <strong>de</strong>r Blick auf die Subjekte und<br />
sozialen Interaktionen gerichtet wird. Jedoch wür<strong>de</strong> die Kategorie wie<strong>de</strong>r hervortreten,<br />
wenn sozial strukturieren<strong>de</strong> Praktiken fokussiert wer<strong>de</strong>n. Lorber zufolge hätte ein De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring, das einen tief greifen<strong>de</strong>n Wan<strong>de</strong>l einleiten soll, an <strong>de</strong>n vergeschlechtlichten<br />
sozialen Strukturen anzusetzen, die über grundlegen<strong>de</strong> gesellschaftliche Institutionen<br />
wie Erwerbszusammenhänge, Familien, Bildungseinrichtungen, Religionen und<br />
kulturelle Institutionen vermittelt sind,. Ihr Ansatz könnte im Hinblick auf die Mitwirkung<br />
von Technologie an <strong>de</strong>r Herstellung vergeschlechtlichter sozialer Strukturen weiter<br />
gedacht wer<strong>de</strong>n. Jedoch ist ihr Konzept bislang noch nicht dafür genutzt wor<strong>de</strong>n, ein<br />
Konzept <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu entwickeln.<br />
Ein weiteres mögliches Verständnis <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring liefert die Philosophin Judith<br />
Butler mit ihrem Konzept <strong>de</strong>s „Undoing Gen<strong>de</strong>r“ (2004), das an ihrem performativen<br />
Verständnisses von Geschlecht 47 ansetzt. Sie teilt Lorbers Plädoyer, binäre und<br />
heterosexuelle Konzeptionen zu verlassen, fokussiert jedoch nicht auf gesellschaftliche<br />
Institutionen, son<strong>de</strong>rn auf die diskursiven Konstruktionen von Subjekten, Sexualität und<br />
Geschlechteri<strong>de</strong>ntitäten. Auf dieser Grundlage lässt sich ihr Konzept als ein „undo[ing]<br />
restrictively normative conceptions of sexual and gen<strong>de</strong>red life“ (Butler 2004, 1)<br />
begreifen. Butler betont, dass es jedoch gute wie schlechte Seiten <strong>de</strong>r Erfahrung <strong>de</strong>s<br />
“becoming undone” gäbe: „Sometimes a normative conception of gen<strong>de</strong>r can undo<br />
one’s personhood, un<strong>de</strong>rmining the capacity to persevere in a livable life. Other times,<br />
the experience of a normative restriction becoming undone can undo a prior conception<br />
of who one is only to inaugurate a relatively newer one that has greater livability as its<br />
aim“ (ebd.). Nach Butler sei damit auch immer verbun<strong>de</strong>n, Menschenrechte und<br />
Gerechtigkeit zu wahren. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei die Verän<strong>de</strong>rung<br />
restriktiver Geschlechternormen, <strong>de</strong>ren Effekt inhuman sei, da sie <strong>de</strong>n Individuen – wie<br />
sie am Beispiel von Intersexualität und Transsexualität aufzeigt – ein binäres<br />
Geschlechtersystem aufzwängen und <strong>de</strong>shalb Interventionen erfor<strong>de</strong>rlich machen. „To<br />
intervene in the name of transformation means precisely to disrupt what has become<br />
settled knowledge and knowable reality and to use […] one’s unreality to make an<br />
otherwise impossible or illegible claim“ (Butler 2004, 27). Die von ihr vorgeschlagenen<br />
Eingriffe zielen somit auf Wissenskonzeptionen und symbolische Dimensionen von<br />
Geschlecht. So betrachtet, eröffnet Butler die Möglichkeit, ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>rjenigen<br />
informatischen Artefakte zu <strong>de</strong>nken, die geschlechtliche Subjekte und vergeschlechtlichte<br />
Wissensformationen hervorbringen. Es bleibt jedoch offen, wie ihr Konzept o<strong>de</strong>r<br />
47 Vgl. hierzu die Bemerkungen in <strong>de</strong>r Einleitung sowie die Ausführungen in Kapitel 3.8.<br />
17
auch das Lorbers für die Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik genutzt und konkret<br />
umgesetzt wer<strong>de</strong>n könnte.<br />
2.2. Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte:<br />
Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate im aktuellen Diskurs<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n möchte ich vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r skizzierten Theoriebildungsprozesse<br />
und <strong>de</strong>r Entwicklungen in <strong>de</strong>r Informatik <strong>de</strong>n gegenwärtigen Stand <strong>de</strong>r<br />
Diskussionen zur Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte zusammenfassen. Ich<br />
unterschei<strong>de</strong> drei Perspektiven, die in <strong>de</strong>r Struktur <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit durch die<br />
Hauptkapitel 3 bis 5 wie<strong>de</strong>r aufgenommen und weiter geführt wer<strong>de</strong>n: erstens<br />
theoretische Konzepte <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte, zweitens<br />
empirische Analysen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik und drittens<br />
Vorschläge, Maßnahmen und Metho<strong>de</strong>n, die dazu dienen, problematischen<br />
Vergeschlechtlichungen entgegenzuwirken. Ziel ist es, Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate zu<br />
i<strong>de</strong>ntifizieren.<br />
Zum Stand theoretischer Konzeptionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
Für die Frage, wie das Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
theoretisch gefasst wer<strong>de</strong>n kann, liegen mit <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlich-konstruktivistischen<br />
Technikforschung, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>konstruktivistischen Geschlechteranalyse<br />
und insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Konzeptionen Butlers, Haraways und Lorbers, eine<br />
Reihe fruchtbarer Ansätze vor. Diese wur<strong>de</strong>n jedoch bisher noch nicht zu einem<br />
eigenständigen theoretischen Konzept weiterentwickelt, welches die Vergeschlechtlichungsprozesse<br />
speziell für die in <strong>de</strong>r Informatik produzierten Artefakte erklärt. Das<br />
Vorhaben, das diese Arbeit leitet, birgt mehrere Herausfor<strong>de</strong>rungen. Erstens ist <strong>de</strong>r<br />
Prozesscharakter <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring, auf <strong>de</strong>n speziell Butler hingewiesen hatte, zu<br />
berücksichtigen sowie das binäre Geschlechtersystem <strong>de</strong>konstruktiv zu hinterfragen.<br />
Dies konnte die sozialkonstruktivistische Perspektive <strong>de</strong>r Ko-Konstruktion von Technik<br />
und Geschlecht bisher noch nicht ausreichend leisten. Ein zweites, bislang noch nicht<br />
angesprochenes Problem besteht darin, die Verhältnisse von Mensch und Maschine<br />
bzw. von Gesellschaft und Technik vor <strong>de</strong>m Hintergrund neuerer Ansätze <strong>de</strong>r<br />
Technikforschung zu begreifen, die Technik eine gewisse Handlungsfähigkeit<br />
(„agency“) zugestehen. Zwar grün<strong>de</strong>t Haraways Ansatz auf einem solchen<br />
Verständnis, sie hat jedoch selbst kein Konzept vorgelegt, wie das Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Technologie auf dieser Basis gedacht wer<strong>de</strong>n kann. Drittens hat Haraway auf Politik,<br />
Verantwortlichkeit und Wissenschaftstheorie im Kontext <strong>de</strong>r Wissens- und<br />
Technologieproduktion aufmerksam gemacht. Jedoch bleibt dabei unklar, wie diese<br />
Aspekte mit <strong>einer</strong> über die Analyse hinausgehen<strong>de</strong>n Konstruktion von technischen<br />
Artefakten zu verbin<strong>de</strong>n ist. Viertens stellt sich schließlich die Frage, wie ein Konzept<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung die spezifische Hybridität <strong>informatischer</strong> Artefakte und <strong>de</strong>ren<br />
sozio-technische bzw. materiell-diskursive Wirksamkeit berücksichtigen kann. In<br />
Kapitel 3 wer<strong>de</strong>n diese Forschungslücken auf <strong>de</strong>r theoretischen Ebene grundlegend<br />
bearbeitet. Es wird ein Konzept <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht<br />
entwickelt, das über bisherige Verkürzungen hinausweist. Dabei wird auch <strong>de</strong>r<br />
18
theoretische Rahmen <strong>de</strong>s Konzepts, <strong>de</strong>r primär in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung und insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r feministischen Technowissenschaftsforschung<br />
begrün<strong>de</strong>t ist, ausführlich erläutert.<br />
Zum Stand empirischer Analysen und praktischer Maßnahmen in <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
Die historische Entwicklung und <strong>de</strong>r aktuelle Stand theoretischer Debatten über<br />
Geschlecht und Technik bzw. Informatik prägen zugleich das Feld <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n<br />
empirischen Analysen. Deren wesentliche Erkenntnisse lassen sich gegenwärtig – wie<br />
an an<strong>de</strong>rer Stelle ausführlich dargestellt (Bath et al. 2008) – entlang ihres jeweiligen<br />
Gegenstands in vier Forschungsperspektiven unterteilen.<br />
Bis heute liegen zur Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik vorwiegend<br />
Untersuchungen über Frauen in <strong>de</strong>r aka<strong>de</strong>mischen Informatik, in informatischen<br />
Berufen und in <strong>de</strong>r schulischen Ausbildung vor. Diese Studien untersuchen zumeist<br />
<strong>de</strong>n Zugang zur Informatik und Informationstechnik, insbeson<strong>de</strong>re biografische<br />
Faktoren, strukturelle Barrieren und Diskriminierungserfahrungen in Familie, Schule,<br />
Hochschule und Beruf. 48 Zu<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong>n dabei positive Effekte <strong>de</strong>r Netzwerkbildung für<br />
<strong>de</strong>n Einstieg und die Karriere von Frauen in Informatik, Technik und Wissenschaft<br />
hervorgehoben. 49<br />
Auf diesen Erkenntnissen grün<strong>de</strong>n viele Maßnahmen <strong>de</strong>r Gleichstellung, die auf<br />
Basis sozialkonstruktivistischer Ansätze nun auch auf strukturelle Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
sozialen Kultur und Lehrpläne <strong>de</strong>r Informatik sowie <strong>de</strong>r medialen Repräsentation<br />
zielen. 50 Damit wer<strong>de</strong>n die Kritiken an <strong>de</strong>n frühen Strategien <strong>de</strong>s liberalen Feminismus<br />
berücksichtigt, die auf eine „reine“ Frauenför<strong>de</strong>rung gesetzt hatten. Denn die<br />
Erfahrungen haben gezeigt, dass Initiativen zur Gleichstellung multifaktoriell gebün<strong>de</strong>lt<br />
und speziell an die Situation vor Ort angepasst wer<strong>de</strong>n müssen, um erfolgreich zu sein.<br />
Dies wie<strong>de</strong>rum erfor<strong>de</strong>rt eine sorgfältige empirische Begleitforschung. 51<br />
Ein zweiter Bereich <strong>de</strong>r empirischen Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
befasst sich mit <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>s öffentlichen Bil<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>r Fachkultur und<br />
<strong>de</strong>r Curricula <strong>de</strong>r Disziplin. Diese Ansätze kritisieren das Hacker-Image <strong>de</strong>s Faches, 52<br />
das einseitige Bild von Studium und Beruf, welches informatische Tätigkeit aufs<br />
Programmieren reduziert, 53 sowie die fachlichen Anerkennungsstrukturen 54 und die<br />
Mystifizierung <strong>de</strong>s Technischen 55 - Merkmale, die allesamt strukturell und symbolisch<br />
zum Ausschluss von Frauen beitragen. Viele dieser Untersuchungen nehmen jedoch<br />
eine erneute Zuordnung zwischen Männlichem und Technischem bzw. von Weiblichem<br />
und Sozialem, Kommunikativem sowie gesellschaftlicher Nutzungsorientierung vor,<br />
anstatt binäre Differenzen zu <strong>de</strong>konstruieren. Dies gilt insbeson<strong>de</strong>re für die auf <strong>de</strong>n<br />
48<br />
Vgl.etwa Schinzel et al. 1998, Schinzel 2000 sowie die entsprechen<strong>de</strong> in Bath et al. 2008 angegebene<br />
Literatur.<br />
49<br />
Vgl. etwa Rossiter 1993, Allmendinger et al. 1998, Wiesner 2002, Götschel 2002.<br />
50<br />
Vgl. etwa Erlemann 2000, Nie<strong>de</strong>rsächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur 1994.<br />
51<br />
Zu dieser Schlussfolgerung vgl. etwa Margolis/ Fisher 2002. Diese Studie beschreibt, mit welchen<br />
Maßnahmen es <strong>de</strong>r renommierte Informatikfachbereich an <strong>de</strong>r Carnegie Mellon Universität schaffte, <strong>de</strong>n<br />
Frauenanteil innerhalb von 6 Jahren von 7% auf 42% zu erhöhen.<br />
52<br />
Vgl. etwa Schinzel 1992, Klawe 2001.<br />
53<br />
Vgl. etwa Maaß/ Wiesner 2006, Rasmussen 1997.<br />
54 Vgl. etwa Håpnes/ Rasmussen 1991.<br />
55 Vgl. Erb 1996.<br />
19
Erkenntnissen solcher Studien aufbauen<strong>de</strong>n Maßnahmen, etwa zur geschlechtssensiblen<br />
Didaktik, 56 zur Integration kommunikativer Kompetenzen in die Softwareentwicklung<br />
57 o<strong>de</strong>r zur interdisziplinären Ausrichtung von Studieninhalten, die dazu tendieren,<br />
die Geschlechterdifferenz und damit verbun<strong>de</strong>ne Stereotype selbst zu re-inszenieren 58 .<br />
Sie bringen damit Differenz als Grundlage <strong>de</strong>r Hierarchisierung erneut hervor. Nur<br />
wenige Projekte und Ansätze in diesem Bereich basieren dagegen tatsächlich auf <strong>de</strong>m<br />
theoretischen Ansatz <strong>de</strong>r Dekonstruktion von Geschlecht. 59<br />
Der dritte Bereich informatikbezogener Geschlechterforschung untersucht die<br />
Chancen, Nutzungsweisen und Wirkungen, die speziell das Internet zeigt. In diesem<br />
Themenfeld dominierten in <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>r computervermittelten Kommunikation<br />
Ansätze, die das neue Medium euphorisch als Befreiungstechnologie und als<br />
„I<strong>de</strong>ntitätswerkstatt“ auffassten. 60 In <strong>de</strong>n 1990er Jahren wur<strong>de</strong> das Internet oft als ein<br />
i<strong>de</strong>aler Raum verstan<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m überkommene Geschlechter- und Subjektkonzeptionen<br />
überwun<strong>de</strong>n, Körper und Geschlechtlichkeit neu konstituiert wer<strong>de</strong>n<br />
könnten und das Konzept <strong>de</strong>s „Doing Gen<strong>de</strong>r“ praktisch erprobbar wer<strong>de</strong>. 61 Diese<br />
Ansätze grün<strong>de</strong>n zwar theoretisch auf einem <strong>de</strong>konstruktivistischen Verständnis von<br />
Geschlecht, jedoch haben sozialwissenschaftliche Studien die formulierten Hoffnungen<br />
empirisch wi<strong>de</strong>rlegt. 62 Auch neuere Untersuchungen lieferten eher ernüchtern<strong>de</strong><br />
Erkenntnisse. Sie dokumentierten die Wie<strong>de</strong>rherstellung geschlechtsstereotyper und<br />
hierarchischer Verhältnisse in <strong>de</strong>r Nutzung <strong>de</strong>s Internet. 63 Eine an<strong>de</strong>re Studie, bei <strong>de</strong>r<br />
technische GestalterInnen befragt wur<strong>de</strong>n, versteht die Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
im Anschluss an Foucault als „Technologien <strong>de</strong>s vernetzten<br />
Selbst“. 64 Auch sie liefert damit Erkenntnisse über Subjektkonstitutionen im Technikentwicklungsprozess,<br />
nicht jedoch über die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte.<br />
Die sozialwissenschaftliche Forschung beschäftigt sich somit vorwiegend mit <strong>de</strong>r<br />
Nutzung <strong>de</strong>s Internet o<strong>de</strong>r Subjektivierungsweisen und bezieht sich damit auf Aspekte,<br />
die als Gegenstand <strong>informatischer</strong> Gestaltung eine untergeordnete Rolle spielen.<br />
Im Gegensatz zu diesen empirischen Ansätzen griffen Cyberfeministinnen die<br />
frühen Verheißungen <strong>de</strong>s Internet aus <strong>einer</strong> kulturwissenschaftlichen Perspektive auf. 65<br />
Im Rekurs auf Haraway zielten cyberfeministische Interventionen auf eine symbolische<br />
Umschreibung herkömmlicher Geschlechter-Technik-Verhältnisse, die in theoretischen<br />
Texten, künstlerischen Praxen und systemimmanenten Störaktionen Ausdruck fand. 66<br />
Cyberfeministinnen versuchten zwar, Technologie im Sinne eines De-Gen<strong>de</strong>ring zu<br />
verän<strong>de</strong>rn. Dabei konzentrierten sie sich jedoch auf Re-Definitionen von Be<strong>de</strong>utung<br />
und auf Kunstformen, welche die informatikbasierten Technologien sowie <strong>de</strong>ren<br />
56 Vgl. etwa Schwarze et al. 2008.<br />
57 Vgl. etwa Mahn 1997, Schinzel et al 1999.<br />
58 Zu dieser Kritik vgl. genauer Bath 2005a, 2006c.<br />
59 Vgl. etwa Bauer/ Götschel 2006 sowie Wiesner 2007 für solche Beispiele aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Curri-<br />
cularentwicklung und Didaktik.<br />
60 Vgl. Bruckman 1992.<br />
61 Vgl. etwa Bruckman 1993, Reid 1994, Stone 1995.<br />
62 Vgl. etwa Funken 1999, 2000, Herring 2000, Eisenrie<strong>de</strong>r 2003, Lübke 2005, zu diesen technikeuphorischen<br />
Argumenten sowie <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mgegenüber ernüchtern<strong>de</strong>n empirischen Analysen vgl. auch Kapitel<br />
4.2.5.<br />
63 Vgl. etwa Carstensen 2007, Carstensen/ Winker 2005, Schachtner/ Winker 2005.<br />
64 Vgl. Paulitz 2005.<br />
65 VNS Matrix 1991, Wilding o.J., obn o.J. Mit Bezug auf diese Autorinnen verstehe ich Cyberfeminismus<br />
gera<strong>de</strong> nicht als einen weiteren Ansatz, <strong>de</strong>r darauf zielt, mehr Frauen für die Technik zu gewinnen.<br />
66 Obn o.J., Sollfrank 1999, Reiche/ Sick 2002.<br />
20
epistemologische Grundlagen, theoretischen Konzepte und impliziten Annahmen intakt<br />
lassen und als gegeben hinnehmen. Technologie wird dabei genutzt, um neue<br />
Verständnisse von Frauen und Technik jenseits essentialistischer Festschreibungen zu<br />
produzieren und zu verbreiten. Somit wer<strong>de</strong>n auch hier keine Interventionen in die<br />
Konzeption und Konstruktion <strong>informatischer</strong> Artefakte angestrebt.<br />
Ein vierter Bereich <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik fokussiert auf die<br />
Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Software, Informationstechnologien und<br />
Grundlagen <strong>de</strong>r Informatik, die im Zentrum <strong>de</strong>r Untersuchung dieser Arbeit stehen. Im<br />
Vergleich zu <strong>de</strong>n bisher skizzierten drei Hauptsträngen fällt <strong>de</strong>r Umfang dieser<br />
Forschungsrichtung jedoch eher gering aus. Es liegen zwar vereinzelte einschlägige<br />
Fallstudien vor, die das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte aufzeigen und <strong>de</strong>tailliert<br />
beschreiben. Diese sind vorwiegend aus <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
bekannt und stammen zumeist aus <strong>de</strong>m anglo-amerikanischen Raum. Diese<br />
Ergebnisse sind bisher jedoch we<strong>de</strong>r für die <strong>de</strong>utschsprachige Informatiik noch für die<br />
<strong>de</strong>utschsprachige Geschlechterforschung aufgearbeitet wor<strong>de</strong>n. Es liegt noch keine<br />
systematische Zusammenschau vorliegen<strong>de</strong>r Analysen über die Dimensionen <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte vor.Selbst in <strong>de</strong>r internationalen Forschung fehlt<br />
bisher sowohl eine Differenzierung <strong>de</strong>r unterschiedlichen Prozesse, die zu <strong>einer</strong><br />
Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Produkte <strong>informatischer</strong> Tätigkeit führen können, als auch<br />
eine sorgfältige Analyse <strong>de</strong>r Mechanismen, die <strong>de</strong>r jeweiligen Art <strong>de</strong>r Einschreibung<br />
von Geschlecht zugrun<strong>de</strong> liegen. Eine wesentliche Herausfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Vorhabens,<br />
einen Gesamtüberblick über vorliegen<strong>de</strong> empirische Erkenntnisse zu geben, besteht<br />
darin, zugleich <strong>de</strong>n aktuellen Stand <strong>de</strong>r Theoriebildung in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
und in <strong>de</strong>r Technikforschung zu berücksichtigen. Dazu müssen vorliegen<strong>de</strong>n Studien,<br />
die eine Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte aufzeigen, zum Teil neu<br />
gelesen, kritisiert und re-interpretiert wer<strong>de</strong>n. Ein solch <strong>de</strong>tailliertes Verständnis <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring ist notwendig, um konkrete Vorschläge für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte machen zu können und stellt ein zentrales Anliegen dieser Arbeit dar.<br />
Technikgestaltungsansätze zum De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
Im Vergleich zu empirischen Analysen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Informatik und<br />
informatischen Artefakten sind methodische Vorschläge zum De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte relativ rar. Zu diesem Bereich gehören erstens Ansätze <strong>de</strong>r Gestaltung<br />
von Technik „von und für Frauen“, die häufig vom „Participatory Design“ <strong>de</strong>r<br />
Skandinavischen Schule inspiriert sind, und zweitens aktuelle Leitfa<strong>de</strong>n-Ansätze zum<br />
geschlechtersensiblen Design.<br />
Die <strong>de</strong>m „Participatory Design“ zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n methodischen Konzepte sowie<br />
<strong>de</strong>ssen bisherigen praktische Erfolge wer<strong>de</strong>n in Kapitel 5.3. ausführlich dargestellt. Zu<br />
<strong>de</strong>n auf dieser Grundlage durchgeführten Projekte kann bereits an dieser Stelle<br />
bemerkt wer<strong>de</strong>n, dass sie zumeist auf <strong>einer</strong> gründlichen Analyse <strong>de</strong>r Arbeitsprozesse<br />
basieren, die durch Technik unterstützt wer<strong>de</strong>n sollen, nicht notwendigerweise jedoch<br />
auf <strong>einer</strong> Analyse <strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse und -ordnungen. Obwohl Projekte „von<br />
und für Frauen“ vielen in <strong>de</strong>r Informatik Engagierten aufgrund <strong>de</strong>r langjährig unhinterfragten<br />
These <strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rspruchs von Frauen und Technik weiterhin erfor<strong>de</strong>rlich<br />
21
scheinen, 67 ist diesem Ansatz aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>s Vorhabens dieser Arbeit<br />
entgegenzuhalten, dass er dazu tendiert, Geschlecht zu essentialisieren statt Dimensionen<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung zu differenzieren. Projekte „von Frauen für Frauen“<br />
grün<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel nicht auf <strong>einer</strong> sorgfältigen Analyse von Vergeschlechtlichungsprozessen,<br />
die in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Kapiteln als eine notwendige Voraussetzung eines<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte aufgezeigt wird. Dennoch haben partizipative<br />
Technikentwicklungsprojekte „von und für Frauen“ aus <strong>de</strong>m Blickwinkel <strong>de</strong>r Fragestellung<br />
dieser Arbeit insofern große Be<strong>de</strong>utung, als sie feministische Anliegen konkret<br />
und methodisch in technische Gestaltungsvorhaben integrieren. Dieser Vorteil tritt im<br />
Vergleich zu sogenannten Gen<strong>de</strong>r-Leitfä<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>n zweiten Bereich vorliegen<strong>de</strong>r<br />
methodischer De-Gen<strong>de</strong>ring-Ansätze für die Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik bil<strong>de</strong>n,<br />
<strong>de</strong>utlich hervor.<br />
Eines <strong>de</strong>r in Deutschland bekanntesten Projekt dieser Richtung ist „Discover<br />
Gen<strong>de</strong>r“, das unter <strong>de</strong>r Leitung von Martina Schraudner an <strong>de</strong>r Fraunhofergesellschaft<br />
durchgeführt wor<strong>de</strong>n ist. 68 Dieses Projekt zielt darauf, Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r (natur-<br />
und technikwissenschaftlichen) Forschung zu erkennen und zu bewerten, um die<br />
Vorgaben <strong>de</strong>r EU-För<strong>de</strong>rung zum Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming zu erfüllen. Kern <strong>de</strong>r Projektergebnisse<br />
ist ein Gen<strong>de</strong>r-Leitfa<strong>de</strong>n zur Ermittlung von Gen<strong>de</strong>r-Aspekten, <strong>de</strong>ssen Nutzen<br />
anhand von dreizehn Fallbeispielen aus unterschiedlichen, nicht nur informatischen<br />
Anwendungsfel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>monstriert wird. Der Ansatz beruht auf <strong>de</strong>r Grundannahme,<br />
technische Produkte stärker an <strong>de</strong>n potentiellen Kundinnen auszurichten<br />
und damit Frauen als (neue) Zielgruppe zu addressieren. Auf diesen Trend ist bereits<br />
in <strong>de</strong>r Einleitung hingewiesen wor<strong>de</strong>n. Dieser Prämisse entsprechend fokussiert <strong>de</strong>r<br />
Leitfa<strong>de</strong>ns primär Geschlechterunterschie<strong>de</strong>, die damit reproduziert und verfestigt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Die zum Erkennen von Gen<strong>de</strong>r-Relevanz intendierten Fragen richten sich auf<br />
Differenzen im Körperbau (Ergonomie, Kraft, Größe), auf weitere körperliche Unterschie<strong>de</strong>n<br />
(Stimmlage, Gesichtssinn, Gehörsinn, Propriozeptoren, innere Muskelanspannung,<br />
Tast- und Klimasinn, etc.), auf unterschiedliche Nutzungszusammenhänge<br />
und -gewohnheiten sowie unterschiedliche Ansprüche an die Nutzungsführung, die<br />
Gestalt und die Inhalte <strong>de</strong>r Technik. Dabei wer<strong>de</strong>n Unterschie<strong>de</strong> unter Frauen und<br />
unter Männern nicht in <strong>de</strong>n Blick genommen. Zwar wird am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Fragenkatalogs<br />
doch noch nach Stereotypisierungen gefragt sowie nach <strong>de</strong>r Festschreibung bestehen<strong>de</strong>r<br />
gesellschaftlicher Arbeitsteilung durch eine bestimmte Gestaltung von Technik.<br />
Jedoch ist <strong>de</strong>r Blick – eine konkrete Anwendung <strong>de</strong>s Leitfa<strong>de</strong>ns vorausgesetzt – zu<br />
diesem Zeitpunkt bereits auf ein binäres, biologistisches Geschlechterverständnis<br />
verengt, das die strukturell-symbolischen Dimensionen <strong>de</strong>r hierarchischen Geschlechterordnung<br />
in <strong>de</strong>n Hintergrund rücken lässt. Problematisch ist vor allem, dass <strong>de</strong>r<br />
Leitfa<strong>de</strong>n die Erkenntnis <strong>de</strong>r Geschlechterforschung ignoriert, dass Geschlecht – auch<br />
das körperliche – in <strong>de</strong>m Sinne sozial konstruiert ist, dass es ständig wie<strong>de</strong>r neu<br />
hervorgebracht wird (vgl. etwa Butler 1991 [1990], 1995 [1993]). Dieser Prozess wird in<br />
„Discover Gen<strong>de</strong>r“ nicht reflektiert, <strong>de</strong>nn statt für Vervielfältigung, Brüche und<br />
Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Geschlechter(verhältnisse) zu plädieren, wirken die Fragestellun-<br />
67 Vgl. etwa Hammel 2003, Kreutzner/ Schelhowe 2003, Schelhowe et al. 2005.<br />
68 Vgl. Bührer/ Schraudner 2006, Schraudner/ Lukoschat 2006.<br />
22
gen <strong>de</strong>s Leitfa<strong>de</strong>ns daran mit, Geschlecht auf eine strikt binäre Logik zu verengen, die<br />
nur stereotype Frauen und Männer kennt. Insofern spiegelt <strong>de</strong>r Leitfa<strong>de</strong>n we<strong>de</strong>r das<br />
<strong>de</strong>r Studie zugrun<strong>de</strong> gelegte, weitaus differenziertere Geschlechterkonzept 69 noch <strong>de</strong>n<br />
selbst gesetzten Anspruch, Geschlechtszuschreibungen nicht zu reproduzieren,<br />
adäquat wi<strong>de</strong>r. Auch aus <strong>de</strong>n Perspektiven <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
und <strong>de</strong>r gestaltungsorientierten Forschung <strong>de</strong>r Informatik erscheint <strong>de</strong>r Leitfa<strong>de</strong>n<br />
theoretisch unfundiert. 70<br />
Demgegenüber zielen die im Rahmen <strong>de</strong>s SIGIS-Projekts 71 entwickelten Richtlinien<br />
zu einem „Gen<strong>de</strong>r Sensitive Design“ von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
explizit auf eine Vermeidung von Geschlechterstereotypen im technischen<br />
Gestaltungsprozess. Es wird empfohlen, männliche und weibliche Elemente zu<br />
kombinieren statt Differenzen zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern aufzubauschen. Damit<br />
zeigt dieser Ansatz Nähe zu einem sozialkonstruktivistischen Verständnis von Geschlecht.<br />
72 Die SIGIS-Richtlinie knüpft ferner stärker als die „Discover Gen<strong>de</strong>r“-Studie<br />
an vorliegen<strong>de</strong> Gestaltungsansätze aus <strong>de</strong>r Informatik an. So nehmen vier von sechs<br />
Vorschlägen zum „Gen<strong>de</strong>r Sensitive Design“ Bezug auf die Partizipation von<br />
NutzerInnen, um damit die Zielgruppe <strong>de</strong>s Produktes bei <strong>de</strong>r Technikgestaltung besser<br />
zu berücksichtigen. Es sollen NutzerInnen <strong>de</strong>r tatsächlichen Zielgruppe involviert<br />
wer<strong>de</strong>n statt von – womöglich falschen und stereotypen – Imaginationen auszugehen.<br />
Diese sollten ferner möglichst früh am technischen Entwicklungsprozess beteiligt<br />
wer<strong>de</strong>n. Darüber hinaus sei die Auswahl <strong>de</strong>r NutzerInnen für Usertests sorgfältig zu<br />
treffen, damit die gewünschte Diversität repräsentiert wird. Zugleich sollten<br />
NutzerInnen über das Internet und Email die Möglichkeit erhalten, auf das Design<br />
Einfluss zu nehmen. Insgesamt beschränkt sich die Richtlinie <strong>de</strong>r SIGIS-Studie zum<br />
„Gen<strong>de</strong>r Sensitive Design“ auf wenige Empfehlungen. 73 Diese erscheinen aus <strong>de</strong>r<br />
Perspektive <strong>de</strong>r Geschlechter- und Technikforschung weitaus fundierter als die Vorschläge<br />
<strong>de</strong>r „Discover Gen<strong>de</strong>r“-Studie, jedoch halten sie trotz eines konstruktivistischen<br />
Verständnisses von Geschlecht und <strong>de</strong>m Anspruch weibliche und männliche<br />
Aspekte zusammenzubringen letztendlich an <strong>de</strong>r binären Zweigeschlechtlichkeit fest<br />
und verbleiben hinsichtlich <strong>de</strong>r vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n zum De-Gen<strong>de</strong>ring in<br />
Technikgestaltung auf <strong>einer</strong> allgemeinen Ebene.<br />
Ein dritter Leitfa<strong>de</strong>n zur gen<strong>de</strong>rgerechten Gestaltung, <strong>de</strong>r speziell auf <strong>de</strong>n Einsatz<br />
digitaler Medien in <strong>de</strong>r Hochschullehre ausgerichtet ist, liegt aus <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen<br />
69<br />
Dieses theoretische Konzept umfasst soziale, symbolische, psychisch-individuelle und körperliche Aspekte.<br />
70<br />
Vgl. hierzu genauer Bath 2007.<br />
71<br />
SIGIS ist ein im 5. Rahmenprogramm <strong>de</strong>r EU von 2000 bis 2004 durchgeführtes Forschungsprojekt. vgl.<br />
Faulkner 2004, Faulkner/ Lie 2007 sowie http://www.sigis-ist.org. Das Akronym steht für „Strategies of<br />
Inclusion, Gen<strong>de</strong>r and the Information Society“. Dieser Titel verweist auf die allgemeine Fragestellung <strong>de</strong>s<br />
Projekts, das auf Analysen und Maßnahmen zielt, mehr Frauen in die Informationsgesellschaft<br />
einzubeziehen.<br />
72<br />
Dennoch wird hier eher ein Geschlechterdifferenzmo<strong>de</strong>ll unterstellt. Darauf <strong>de</strong>utet auch die Empfehlung<br />
<strong>de</strong>r Richtlinie, mehr Frauen in das Design-Team zu integrieren und ihnen Entscheidungskompetenzen zu<br />
geben, speziell dann, wenn das Produkt für weibliche NutzerInnen gedacht ist. Die dabei zugrun<strong>de</strong><br />
liegen<strong>de</strong> These, dass „[g]en<strong>de</strong>r diversity clearly enhances gen<strong>de</strong>r sensitive <strong>de</strong>sign practices“ (Rommes<br />
2004, 56), lässt sich aus <strong>einer</strong> geschlechtertheoretisch-<strong>de</strong>konstruktivistischen Perspektive hinterfragen.<br />
Denn die Zugehörigkeit zur Gruppe <strong>de</strong>r Frauen führt nicht notwendigerweise zu einem alternativen,<br />
geschlechtersensiblen Design, wie Rommes selbst anhand ihrer Studie zur Digitalen Stadt Amsterdam<br />
(vgl. Kapitel 4.1.4) empirisch belegt hat.<br />
73<br />
Der geringe Umfang kann auf die Zielrichtung <strong>de</strong>s SIGIS-Gesamtprojekts zurückgeführt wer<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m<br />
das „Gen<strong>de</strong>r Sensitive Design“ nur ein Aspekt von vielen darstellt.<br />
23
Projekt „Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming medial“ 74 vor. Diese Empfehlungen betonen erstens<br />
die Notwendigkeit, die bestehen<strong>de</strong> Technikkultur zu verän<strong>de</strong>rn. Zweitens geben sie<br />
Hinweise zur Partizipation und technischen Ausbildung <strong>de</strong>r Nutzen<strong>de</strong>n, zum<br />
technischen Support sowie zu <strong>de</strong>n Zugangsvoraussetzungen zu Lernplattformen, die<br />
ich hier nicht betrachten will. Der dritte Teil unterbreitet Vorschläge zu einem Design<br />
<strong>de</strong>r Lernumgebungen im engeren Sinne.<br />
Der erste Teil, <strong>de</strong>r für eine neue Technikkultur plädiert, die auf die Interessen und<br />
Belange bei<strong>de</strong>r Geschlechter eingeht, gibt Aufschluss über das im Projekt zugrun<strong>de</strong><br />
gelegte Geschlechter-Technik-Verständnis. Dabei wird das Kommunizieren über<br />
Technik, das bislang fast ausschließlich in Männergruppen stattfän<strong>de</strong>, als ein<br />
wesentliches Problem <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n Technikkultur i<strong>de</strong>ntifiziert. Es wird <strong>de</strong>shalb<br />
angestrebt, Studieren<strong>de</strong>n wie Lehren<strong>de</strong>n das Sprechen über Technik durch ein<br />
„learning by doing and asking“ zu ermöglichen. Sie sollen sich mit <strong>de</strong>r Technik<br />
„wohlfühlen“ und „Spaß an <strong>de</strong>r Sache“ haben. Voraussetzung dafür sei, dass sie diese<br />
mitgestalten können und von Anfang an aktiv in <strong>de</strong>n technischen Entwicklungsprozess<br />
einbezogen wer<strong>de</strong>n. Ferner sei eine kontinuierliche Verbindung von sozialen und technischen<br />
Aktivitäten herzustellen und die Trennung zwischen technischen MacherInnen<br />
und KonsumentInnen zu überwin<strong>de</strong>n. Somit erklärt das Projekt „Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming<br />
medial“ die Dekonstruktion zweier geschlechtlich konstituierter Dichotomien als ein<br />
zentrales Anliegen: die von technischen und sozialen Aspekten beim Lernen und die<br />
von Gestaltung und Nutzung beim Umgang mit Technologien. Diese <strong>de</strong>konstruktivistische<br />
Perspektive wird in Empfehlungen zum Design von Lernumgebungen<br />
konkretisiert.<br />
Die meisten <strong>de</strong>r insgesamt 44 Empfehlungen sind eher allgemeinen Charakters, <strong>de</strong>r<br />
auf <strong>de</strong>m aktuellen Stand <strong>de</strong>r Ergonomie- und Human-Computer-Interaction-Forschung<br />
grün<strong>de</strong>t. So wird etwa vorgeschlagen, Zugriffsrechte transparent zu machen, Hilfefunktionen<br />
und klare Erläuterungen zu Verfügung zu stellen und unterschiedliche<br />
Darstellungsformen (Bildschirmausgabe, Druck-/Textausgabe, Online-/Offline-Version)<br />
zu ermöglichen. Viele dieser Anregungen zielen auf eine Vervielfältigung <strong>de</strong>r Optionen<br />
ein, die nicht speziell auf die Überwindung vermeintlicher Differenzen zwischen Frauen<br />
und Männern ausgerichtet ist, son<strong>de</strong>rn diese Varianten gera<strong>de</strong> nicht zweigeschlechtlich<br />
differenzierend zuweist. Vielmehr soll Technik für die NutzerInnen als gestaltbar erfahren<br />
wer<strong>de</strong>n und Neugier auf die Nutzungsmöglichkeiten wecken. Auch <strong>de</strong>r Vorschlag,<br />
die Lernumgebung in gewissem Umfang für die NutzerInnen konfigurierbar zu machen,<br />
ist implizit <strong>de</strong>m Stereotyp weiblicher technischer Inkompetenz entgegengesetzt, ohne<br />
jenes dabei explizit zu reproduzieren. Nur fünf <strong>de</strong>r Empfehlungen nehmen direkt auf<br />
die Geschlecht Bezug. Beispielsweise sollen geschlechterstereotype Icons und Illustrationen<br />
vermie<strong>de</strong>n und statt<strong>de</strong>ssen die Unterschiedlichkeit und Vielfalt von Frauen und<br />
Männern (z.B. Personen aus unterschiedlichen Kulturen, verschie<strong>de</strong>ner Hautfarbe und<br />
aus unterschiedlichen Schichten) dargestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Leitfa<strong>de</strong>n vermei<strong>de</strong>t es somit insgesamt sehr bewusst, dualistische Differenzen<br />
zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern zu unterstellen und durch erneute Betonung zu reprodu-<br />
74 Dieses Projekt zielte darauf, 100 Verbundprojekte, die im Bereich „Neue Medien in <strong>de</strong>r Bildung“ vom<br />
BMBF geför<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>r Implementierung von Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming zu begleiten, zu beraten und<br />
diesen Implementierungsprozess in <strong>de</strong>n Projekten zu beforschen und zu evaluieren, vgl. Wiesner 2004 et<br />
al. a, b, Zorn et al. 2004.<br />
24
zieren. Auch die angestrebte Überwindung <strong>de</strong>r Dichotomie von technischem Design<br />
und Nutzung sowie <strong>de</strong>r Anspruch, die technische Gestaltung nicht strikt von <strong>de</strong>r<br />
sozialen Gestaltung <strong>de</strong>r Technologie zu trennen, ver<strong>de</strong>utlichen ein <strong>de</strong>konstruktivistisches<br />
Geschlechterverständnis. Damit steht <strong>de</strong>r Ansatz im Einklang mit <strong>de</strong>r zuvor entwickelten<br />
geschlechtertheoretischen Perspektive. Aus Perspektive <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
bleiben jedoch Fragen offen. Diese betreffen <strong>einer</strong>seits die Reichweite <strong>de</strong>r Vorschläge.<br />
Denn <strong>de</strong>r Leitfa<strong>de</strong>n fokussiert eine spezifische Anwendung: die Lernplattformen im<br />
universitären Bereich. Es kann davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass sich viele <strong>de</strong>r<br />
Empfehlungen auf die Bildschirmgestaltung an<strong>de</strong>rer Systeme übertragen lassen. Für<br />
ein De-Gen<strong>de</strong>ring, das stärker an <strong>de</strong>r Funktionalität von Softwaresystemen ansetzt,<br />
wer<strong>de</strong>n allerdings kaum Hinweise gegeben. An<strong>de</strong>rerseits stellt sich die Frage nach <strong>de</strong>n<br />
konkreten Metho<strong>de</strong>n <strong>einer</strong> geschlechtersensitiven Technikgestaltung. So schlägt <strong>de</strong>r<br />
Leitfa<strong>de</strong>n zwar vor, die Technologie partizipativ mit NutzerInnen zu entwickeln. Nach<br />
welchen Grundsätzen und Metho<strong>de</strong>n diese Beteiligung <strong>de</strong>r NutzerInnen erfolgen kann<br />
und welche praktischen Schwierigkeiten und Fallstricke dabei speziell aus<br />
Geschlechterforschungsperspektiven zu beachten wären, 75 wird dabei nicht diskutiert.<br />
Der Leitfa<strong>de</strong>n liefert insgesamt einen guten Ausgangspunkt für das praktische De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte. Es sind jedoch weitere Anstrengungen notwendig,<br />
um auch <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung an<strong>de</strong>rer Anwendungstechnologien und an<strong>de</strong>rer<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte (z.B. Konzepte <strong>de</strong>r Grundlagenforschung) entgegen wirken zu<br />
können. Dabei erscheint es aufgrund <strong>de</strong>r Erkenntnisse aus <strong>de</strong>n skizzierten De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Vorhaben sinnvoll, Metho<strong>de</strong>n für bestimmte Technologien anhand zuvor<br />
herausgearbeiteter Vergeschlechtlichungsprozesse auszuwählen und anzupassen.<br />
Eine breite systematische Differenzierung methodischer Ansätze <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
nach <strong>de</strong>n Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
liegt jedoch bislang noch nicht vor.<br />
Die Herausfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte besteht insgesamt<br />
darin, die Reichweite bereits vorliegen<strong>de</strong>r methodischer Ansätze (z.B. <strong>de</strong>r HCI-<br />
Forschung und <strong>de</strong>s „Participatory Design“) zu klären und gegebenenfalls weitere<br />
Konzepte zu entwickeln, die auch <strong>de</strong>n noch nicht erfassten Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
begegnen können. Es ist systematisch zu untersuchen, welche methodischen<br />
Konzepte <strong>de</strong>r Technikgestaltung für einen De-Gen<strong>de</strong>ringprozess herangezogen o<strong>de</strong>r<br />
angepasst wer<strong>de</strong>n können, in welchen Fällen bestimmte Metho<strong>de</strong>n zum De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
beitragen können und was De-Gen<strong>de</strong>ring dabei in einem geschlechtertheoretischen<br />
Sinne be<strong>de</strong>utet. Diese Analyse ist Gegenstand <strong>de</strong>s Kapitels 5.<br />
Resümee<br />
Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Gebiet <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>n<br />
Natur- und Technikwissenschaften und daher auch in <strong>de</strong>r Informatik bislang weniger<br />
umfassend entwickelt ist als in <strong>de</strong>n Sozial- und Geisteswissenschaften. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
in Bezug auf die Inhalte, Theorien, Metho<strong>de</strong>n, impliziten Annahmen und Produkte <strong>de</strong>r<br />
Informatik bestehen weiterhin Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate. Diese betreffen, wie in diesem<br />
75 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt 5.4, in <strong>de</strong>m neben verschie<strong>de</strong>nen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r partizipativen<br />
Technikgestaltung auch ein Entwicklungsbeispiel diskutiert wird, in <strong>de</strong>m die Prinzipien <strong>de</strong>s<br />
„learning-by-asking-and-doing“ und <strong>de</strong>s Erfahrbarmaches <strong>de</strong>r Gestaltbarkeit von Technik erfolgreich<br />
angewen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n.<br />
25
Kapitel aufgezeigt wur<strong>de</strong>, sowohl die theoretische Konzeptualisierung <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte als auch die Systematisierung<br />
vorliegen<strong>de</strong>r empirischer Erkenntnisse über die Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring. Ferner fehlt<br />
bislang auch eine umfassen<strong>de</strong>, differenzierte und zugleich theoretisch fundierte<br />
Umsetzung von Analysen in alternative Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung, die als<br />
Ansätze zum De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte bezeichnet wer<strong>de</strong>n können.<br />
26
Kapitel 3<br />
Theoretische Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
Ziel dieses Kapitels ist es, ein theoretisch fundiertes Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu entwickeln. Dabei sollen diese Prozesse in ihrer<br />
Komplexität begriffen wer<strong>de</strong>n. Dies be<strong>de</strong>utet, die Verhältnisse von Technik, Gesellschaft<br />
und Geschlecht zu untersuchen und Vergeschlechtlichung nicht als eine Eigenschaft<br />
von Frauen und Männern o<strong>de</strong>r als eine <strong>de</strong>m Artefakt inhärente Verfasstheit.<br />
Ebenso wenig wird sie als ein absichtsvoller Einschreibungsprozess durch die InformatikerInnen<br />
mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Diskriminierung gedacht.<br />
Da die Disziplin <strong>de</strong>r Informatik zur Bearbeitung dieser Fragestellung selbst keine<br />
Metho<strong>de</strong>n zur Verfügung stellt, wird in diesem Kapitel primär auf Ansätze <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung Bezug genommen. Denn dieses Gebiet untersucht<br />
die Verhältnisse von Technik und Gesellschaft bzw. <strong>de</strong>r Einschreibung <strong>de</strong>s Sozialen in<br />
technologische Artefakte. Es wird gezeigt, dass sich die dort gewonnenen Erkenntnisse<br />
als anschlussfähig an das gesellschaftspolitische Verständnis <strong>de</strong>s De/Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte erweisen.<br />
Ausgehend von Langdon Winners These, dass Artefakte politisch sind, wer<strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>n ersten drei Abschnitten (3.1.-3.3.) grundlegen<strong>de</strong> Konzepte aus <strong>de</strong>r konstruktivistischen<br />
Technikforschung zum Verhältnis von Technik und Gesellschaft bzw. von<br />
Mensch und Maschine vorgestellt (Technik<strong>de</strong>terminismus, Social Shaping of Technology,<br />
Social Construction of Technology, Akteur-Network-Theory). Dabei diskutiere ich<br />
die Möglichkeiten und Grenzen <strong>de</strong>r Übertragbarkeit dieser Konzepte auf dTheorien <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte.<br />
Ziel <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n drei Abschnitte (3.4.-3.6.) ist es, auf dieser Grundlage<br />
einen Rahmen herauszuarbeiten, um das Gen<strong>de</strong>ring von Technologie theoretisch zu<br />
fassen. Dazu wer<strong>de</strong>n feministische Kritiken und Re-Formulierungen von Ansätzen<br />
sozialwissenschaftlicher Technikforschung herangezogen: Erstens die Arbeiten Donna<br />
Haraways, insbeson<strong>de</strong>re ihr Netzwerkansatz. Zweitens <strong>de</strong>r erkenntnistheoretische<br />
Ansatz Karen Barads, <strong>de</strong>r die Berücksichtigung von Materialität und Verantwortung vor<br />
<strong>de</strong>m Hintergrund eines asymmetrischen Verhältnisses von Mensch und Materie bzw.<br />
Technologie hervorhebt. Drittens Lucy Suchmans Konzept <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-(Re-<br />
)Konfigurationen, das Haraways und Barads Ansätze für die Informatik und die Analyse<br />
von Informationstechnologien fruchtbar macht.<br />
Die letzten bei<strong>de</strong>n Abschnitte (3.7. und 3.8.) fokussieren auf Prozesse <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring, d.h. auf die Entstehung <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Informationstechnologien.<br />
Diese sollen auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>n vorangegangen Abschnitten theoretisch<br />
erarbeiteten Rahmens konkreter gefasst wer<strong>de</strong>n. Dazu wird auf die Konzepte <strong>de</strong>s<br />
„Gen<strong>de</strong>rskripts“ (Rommes 2002) und <strong>de</strong>r „posthumanistischen Performativität“ (Barad<br />
2003) zurückgegriffen, die an <strong>de</strong>n Skriptansatz Akrichs bzw. das Performativitätskonzept<br />
Butlers angelehnt sind. Um diese Konzepte konstruktiv auf die Gestaltung von<br />
Technologien und ihr mögliches De-Gen<strong>de</strong>ring beziehen zu können, wer<strong>de</strong>n sie zu<br />
einem eigenen Ansatz <strong>de</strong>r „Ko-Materialisierung von Technologie und Geschlecht“<br />
weiterentwickelt.<br />
27
3.1. Das Technische ist politisch!<br />
“Do artifacts have politics? ‘Of course not’. Such has been for many years<br />
the common sense answer: technical objects are as neutral as Aesop’s<br />
tongue. They simply take the shape given to them. But when the philosopher<br />
Langdon Winner raised the question, several <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>s ago, his answer<br />
was a resounding ‘yes’: far from being neutral, technologies could<br />
‘embody’ oppression in such a <strong>de</strong>vious way that it was ma<strong>de</strong> irreversible.”<br />
(Latour 2004, o.S.)<br />
Unter <strong>de</strong>m Titel „Do artifacts have politics?“ veröffentlichte <strong>de</strong>r Politikwissenschaftler<br />
und Technikphilosoph Langdon Winner 1980 einen Aufsatz, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung große Aufmerksamkeit erlangen sollte. Darin behauptet<br />
er die Existenz „inhärent politischer Technologien“, <strong>de</strong>nen bestimmte gesellschaftliche<br />
Herrschaftsstrukturen und Unterdrückungsmechanismen eingeschrieben sind. Als Beispiele<br />
führt er Atombomben o<strong>de</strong>r Kernkraftwerke an. Diese seien nicht mit <strong>de</strong>mokratischen<br />
Gesellschaftsformen vereinbar, son<strong>de</strong>rn erfor<strong>de</strong>rten ein totalitäres politisches<br />
Regime. Um Unfälle o<strong>de</strong>r Anschläge zu verhin<strong>de</strong>rn, sei ein autoritärer staatlicher Apparat<br />
vonnöten, <strong>de</strong>r ihren Einsatz und Betrieb sicherstellt. Solarquellen stellten einen Gegensatz<br />
zu diesen zentralisierten Technologien dar. Da sie <strong>de</strong>zentral-verteilt funktionierten,<br />
wären sie eher mit sozialer Gleichheit, Freiheit und <strong>de</strong>mokratischen Zielen<br />
vereinbar. Winner argumentiert, dass Entscheidungen für bestimmte technische Arrangements<br />
<strong>de</strong>shalb stets Entscheidungen für bestimmte politische Macht- und Autoritätsverhältnisse<br />
seien (vgl. Winner 1999 [1980], 30).<br />
Dass Technologien eine bestimmte Politik inhärent und ihr jeweiliger politischer<br />
Charakter damit unabhängig von kulturell-historischen Bedingungen bestimmbar seien,<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Debatten sozialwissenschaftlicher Technikforschung<br />
relativiert. In <strong>de</strong>r Rezeption <strong>de</strong>s Aufsatzes beson<strong>de</strong>rs umstritten war Winners These,<br />
dass manche Entwickler_innen intendierten, eine soziale Ungleichheitsstruktur mit Hilfe<br />
von Technologie fortzuführen. Das heißt: „Jemand will bewusst einen sozialen Effekt<br />
erzielen und verlegt seine Intention gezielt in ein Artefakt, das dann <strong>de</strong>n Effekt auf<br />
Dauer stellt“ (Joerges 1999a, 45). Gelingt <strong>de</strong>r soziale Ausschluss und die Behin<strong>de</strong>rung<br />
<strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r NutzerInnen, so wird die entsprechen<strong>de</strong> Ungleichheitsstruktur<br />
nicht nur in die Technologie eingeschrieben, son<strong>de</strong>rn bleibt langfristig wirksam<br />
und aufrechterhalten. Sie wird durch Technologie verfestigt, quasi „verhärtet“ (vgl.<br />
Latour 1991). In diesem Sinne ließen sich technische Artefakte als Formen sozialer<br />
Ordnung verstehen: „Because choices tend to become strongly fixed in material<br />
equipment, economic investment, and social habit, the original flexibility vanishes for all<br />
practical purposes once the initial commitments are ma<strong>de</strong>. In that sense technological<br />
innovations are similar to legislative acts or political foundings that establish a framework<br />
for public or<strong>de</strong>r that will endure over many generations“ (Winner 1999 [1980], 32)<br />
Als einprägsames Beispiel dieser Klasse technischer Artefakte führt Winner eine<br />
Reihe von Brücken an, die in <strong>de</strong>n 1930er Jahren von <strong>de</strong>m renommierten New Yorker<br />
Stadtplaner Robert Moses konstruiert wor<strong>de</strong>n sind. Diese Überführungen über <strong>de</strong>n<br />
sogenannten Parkways 76 zwischen New York und Long Island waren so niedrig<br />
gebaut, dass sie von öffentlichen Bussen nicht passiert wer<strong>de</strong>n konnten. Winner<br />
76 Parkways sind Bun<strong>de</strong>sstrassen, die durch landschaftlich reizvolle Gegen<strong>de</strong>n führen.<br />
28
erklärt, dass ökonomisch schlecht Gestellte und insbeson<strong>de</strong>re Schwarze, die sich kein<br />
Auto leisten konnten, mit Hilfe <strong>de</strong>r Brückenkonstruktion von <strong>de</strong>n „weißen“ Strän<strong>de</strong>n<br />
ferngehalten wer<strong>de</strong>n sollten. Er unterstellt <strong>de</strong>m Konstrukteur, persönliche klassen- und<br />
rassenspezifische Vorurteile in die Straßenbaukonstruktionen bewusst eingeschrieben<br />
zu haben. Moses habe einen sozialen Ausschluss in Stahl gegossen.<br />
Winners Aufsatz wur<strong>de</strong> nach s<strong>einer</strong> Erstveröffentlichung 1980 in zwei breit<br />
rezipierten Sammelbän<strong>de</strong>n (MacKenzie/ Wajcman 1985, Winner 1986) und <strong>einer</strong> Neuauflage<br />
(MacKenzie/ Wajcman 1999) wie<strong>de</strong>r abgedruckt. Sein Brücken-Beispiel<br />
avancierte in <strong>de</strong>n 1980er und 1990er Jahren zu <strong>einer</strong> Hauptreferenz für die<br />
Behauptung, dass soziale Ungleichheitstrukturen in technische Artefakte eingeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n. Es ist „ungezählte Male zitiert wor<strong>de</strong>n: es wur<strong>de</strong> zu einem festen Bestandteil<br />
<strong>de</strong>r technik- und stadtsoziologischen Folklore. […] Kein Zweifel: Die Geschichte von<br />
Winners Moses-Geschichte ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.“ (Joerges<br />
1999a, 46) betont Bernward Joerges. Doch war es Joerges selbst, <strong>de</strong>r Winners Erzählung<br />
<strong>de</strong>konstruierte. Er wi<strong>de</strong>rlegte Moses‘ vermeintlich rassistische Absicht, während<br />
Steve Woolgar und Geoff Cooper anhand von Busfahrplänen zeigten, dass es<br />
öffentliche Verkehrsverbindungen zwischen New York und Long Island gab. Seither<br />
wird das Brücken-Beispiel als ‚Parabel’ (Joerges 1999a, b) o<strong>de</strong>r ‚urbane Legen<strong>de</strong>’<br />
(Woolgar/ Cooper 1999) bezeichnet.<br />
Obwohl starke Zweifel an <strong>de</strong>r Validität <strong>de</strong>s konkreten Brückenbeispiels geäußert<br />
wor<strong>de</strong>n sind, erscheint Winners generelle Position, dass technische Artefakte politisch<br />
sind, noch immer attraktiv und überzeugungsfähig. Es besteht in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung ein weitgehen<strong>de</strong>r Konsens über Winners generelle<br />
Position, dass technische Artefakte politisch sind (vgl. etwa Sørensen 2004, 184). Die<br />
These, dass Technologien nicht neutral sind und we<strong>de</strong>r allein <strong>de</strong>m Fortschritt <strong>de</strong>r<br />
Menschheit dienen, noch unschuldig sind, ist auch für die Geschlechterforschung in<br />
<strong>de</strong>r Informatik anschlussfähig (vgl. Bath et al. 2003). 77 Deshalb soll die Vergeschlechtlichung<br />
von technischen Artefakten im Folgen<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Hintergrund dieser These<br />
ge<strong>de</strong>utet wer<strong>de</strong>n. Den konstatierten politischen Charakter technischer Artefakte auf die<br />
Kategorie Geschlecht zu übertragen, heißt jedoch nicht davon auszugehen, dass<br />
Technologien inhärent vergeschlechtlicht wären. Radikalfeministinnen sowie Ökofeministinnen<br />
hatten in <strong>de</strong>n 1970/80er Jahren behauptet, dass Technologien zutiefst<br />
patriarchal, d.h. prinzipiell in allen Facetten ‚<strong>de</strong>m Weiblichen‘ entgegengesetzt seien.<br />
Dieser Standpunkt wur<strong>de</strong> grundlegend kritisiert, u.a. dahingehend, dass er Frauen ausschließlich<br />
ein Verhältnis <strong>de</strong>r Ablehnung von Technologien, sozusagen ein Nichtverhältnis<br />
zugestehe und damit <strong>de</strong>n Mythos unterstütze, dass Frauen in <strong>de</strong>r Forschung<br />
und Entwicklung technischer Artefakte nicht vorkommen wür<strong>de</strong>n (vgl. etwa Haraway<br />
1995c [1985], Knapp 1989). Die Vorstellung, Technologien seien inhärent patriarchal,<br />
wi<strong>de</strong>rspricht nicht nur <strong>de</strong>n heutigen nicht-essentialistischen Konzeptionen von<br />
Geschlecht. Sie ignoriert zugleich jene aktuellen konstruktivistischen Ansätze feministischer<br />
Technikforschung, die aufzeigen, dass sich Frauen und Männer durch vielfältige<br />
77 Viele <strong>kritisch</strong>e InformatikerInnen, die sich bspw. in <strong>de</strong>r Organisation <strong>de</strong>s Fiff e.V. in Deutschland, auf <strong>de</strong>n<br />
‚Theorie <strong>de</strong>r Informatik‘-Tagungen 2001-2004 o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Critical Computing-Tagungen (1975-2005) zusammenfin<strong>de</strong>n,<br />
teilen diese Position. Ich wer<strong>de</strong> <strong>de</strong>ren Perspektive hier jedoch nicht geson<strong>de</strong>rt diskutieren,<br />
son<strong>de</strong>rn mich primär auf <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik beziehen, <strong>de</strong>r auf Technologiegestaltung<br />
fokussiert.<br />
29
Praktiken und Diskurse zu Technologie in Beziehung setzen. Aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r<br />
neueren Geschlechterforschung und feministischer Technikgestaltung ist <strong>de</strong>r Gedanke<br />
„inhärent vergeschlechtlichter Technologie“ höchst fragwürdig. Um zu verstehen, wie<br />
sich <strong>de</strong>nnoch Geschlechts- und Ungleichheitsstrukturen in <strong>de</strong>r Technologie i<strong>de</strong>ntifizieren<br />
lassen, ohne von essentieller Einschreibung auszugehen, wird im Folgen<strong>de</strong>n ein<br />
theoretischer Rahmen entwickelt.<br />
Ausgehend von Winners Brückenbeispiel möchte ich Gemeinsamkeiten aufzeigen<br />
zwischen <strong>de</strong>m Vorhaben, auf das Politische von Artefakten hinzuweisen, und <strong>de</strong>m hier<br />
verfolgten Anliegen, ein Konzept <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung informationstechnischer<br />
Artefakte zu entwickeln. Dabei will ich drei Aspekte herausstellen: Erstens die<br />
Fokussierung auf einen sozialen Ausschluss durch Technologien, <strong>de</strong>r strukturell<br />
begrün<strong>de</strong>t ist. Zweitens die Kritik an <strong>de</strong>r vermeintlichen Neutralität <strong>de</strong>r Artefakte, die<br />
sich auch als als die an <strong>de</strong>r Geschlechtsneutralität <strong>de</strong>uten ließe. Drittens das<br />
Phänomen, dass soziale Strukturen nicht nur in Technologien eingeschrieben, son<strong>de</strong>rn<br />
gleichzeitig unsichtbar wer<strong>de</strong>n.<br />
Erstens: Die Behauptung Winners, dass technische Artefakte politisch seien, die er<br />
mit <strong>de</strong>m Brückenbeispiel zu belegen versuchte, bietet einen Einstieg in die Diskussion,<br />
dass und die Frage, wie technische Artefakte vergeschlechtlicht sind, da gezeigt<br />
wer<strong>de</strong>n soll, , dass sich eine soziale Ungleichheitsstruktur in technischen Artefakten<br />
manifestieren kann. Geschlecht als eine Ungleichheitsstruktur zu begreifen, war ein<br />
Hauptausgangspunkt feministischer Theorie und Geschlechterforschung.<br />
Winners Beispiel ver<strong>de</strong>utlicht, dass technische Artefakte Formen <strong>de</strong>r Diskriminierung<br />
verkörpern können, die über <strong>de</strong>n (strukturellen) Zusammenhang von Autobesitz<br />
und Klassen- bzw. ethnischer Zugehörigkeit hergestellt wer<strong>de</strong>n. Dass die in die<br />
Brücken eingeschriebene Diskriminierung nicht auf körperliche o<strong>de</strong>r kognitive Merkmale<br />
rekurriert, son<strong>de</strong>rn sich auf gesellschaftliche Strukturverhältnisse bezieht, ist ein<br />
Aspekt, <strong>de</strong>r das Brückenbeispiel Winners für die hier verfolgte Frage <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring<br />
von Artefakten anschlussfähig macht. In <strong>de</strong>r Informatik wird die Vorstellung <strong>einer</strong><br />
Vergeschlechtlichung von Technologien, die auf strukturell-symbolischen Dimensionen<br />
von Ungleichheit grün<strong>de</strong>t, durch ein zum Positivismus tendier<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Wissenschafts-<br />
und Technikverständnis sowie durch eine verkürzte Auffassung von Geschlecht<br />
erschwert. Geschlecht wird innerhalb <strong>de</strong>r Disziplin oft allein als ein körperliches Merkmal<br />
von Individuen verstan<strong>de</strong>n. 78 Insofern besteht eine Neigung dazu, strukturelle<br />
Ebenen gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse ebenso wie die symbolischen<br />
Zuschreibungen zu vernachlässigen (vgl. etwa Bath 2002a). Auf dieser Basis ist die<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte jedoch nur eingeschränkt zu verstehen.<br />
Die Analyse bliebe auf wenige physiologische o<strong>de</strong>r mentale Differenzen zwischen<br />
Frauen und Männern begrenzt, die bei <strong>de</strong>r Techniknutzung relevant sein können. 79<br />
Demgegenüber eröffnet das Brückenbeispiel – übertragen auf die Informatik und ihre<br />
Artefakte – die Denkmöglichkeit, dass auch Geschlecht, als eine Strukturkategorie<br />
aufgefaßt, Einfluss auf die Gestaltung von Technologien hat. 80<br />
78<br />
Vgl. hierzu auch Kapitel 2.<br />
79<br />
Vgl. hierzu die Diskussion <strong>de</strong>s im Projekt „Discover Gen<strong>de</strong>r“ entwickelten Gen<strong>de</strong>r-Leitfa<strong>de</strong>ns in Kapitel<br />
2.2.<br />
80<br />
Zwar vermag das Winnersche Beispiel die Aufmerksamkeit auf strukturelle Ebenen <strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse<br />
zu lenken, es vernachlässigt dabei jedoch erkenntnis<strong>kritisch</strong>e sowie symbolische Ebenen <strong>de</strong>r<br />
30
Zweitens: Winners wesentlicher Beitrag zur Debatte um das Verhältnis von Technik<br />
und Gesellschaft wird zumeist in s<strong>einer</strong> Kritik an <strong>de</strong>r Annahme gesehen, dass<br />
Technologien neutral seien: „His is one of the most thoughtful attempts to un<strong>de</strong>rmine<br />
the notion that technologies are in themselves neutral – that all that matters is the way<br />
that societies choose to use them“ (MacKenzie/ Wajcman 1999, 4). Er wen<strong>de</strong>t sich damit<br />
gegen die Auffassung, Technologien selbst als gegeben zu unterstellen. Diese<br />
Vorstellung basiert auf <strong>de</strong>r Annahme, „that technological change is an in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt<br />
factor, impacting on society from outsi<strong>de</strong> society, so to speak“ (MacKenzie/ Wajcman<br />
1999, 5). Die von Winner kritisierte Position wird in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung unter <strong>de</strong>m Begriff „technologischer Determinismus“ gefasst. Technik<strong>de</strong>terministischen<br />
Ansätzen gelten technologische Entwicklungen insofern als unabhängig<br />
von externen Faktoren, als dass sie <strong>einer</strong> Eigendynamik folgten, die sich nicht<br />
auf an<strong>de</strong>re Logiken (z.B. die <strong>de</strong>r Ökonomie, <strong>de</strong>r Politik, <strong>de</strong>s Militärs) zurückführen<br />
ließen. Dabei wer<strong>de</strong>n Technologien als unabhängige Variablen verstan<strong>de</strong>n, die große<br />
Anpassungsleistungen von <strong>de</strong>n Menschen und sozialen Systemen erzwingen. Technologischer<br />
Determinismus 81 versteht das Technische als vom Sozialen getrennt und<br />
verankert das Primat im Verhältnis von Technik und Gesellschaft auf <strong>de</strong>r Seite <strong>de</strong>r<br />
Artefakte. Technischer Wan<strong>de</strong>l wür<strong>de</strong> sozialen Wan<strong>de</strong>l verursachen und <strong>de</strong>terminieren<br />
– sei es im Sinne <strong>einer</strong> konservativen Fortschrittslogik, <strong>einer</strong> kulturpessimistischen<br />
Aufklärungskritik o<strong>de</strong>r eines linken Fortschrittsoptimismus. 82 Winner wandte sich also<br />
gegen die Vorstellung, das Verhältnis von Technik und Gesellschaft darauf zu reduzieren,<br />
<strong>de</strong>r Technik <strong>de</strong>r Vorrang einzuräumen. Moses Brücken bringen zum Ausdruck,<br />
dass das Soziale auf Technologie Einfluss hat, und zwar bereits in <strong>de</strong>n frühen Phasen<br />
ihrer Entwicklung und Gestaltung.<br />
Die Kritik an <strong>de</strong>r vermeintlichen Neutralität <strong>de</strong>r Artefakte und ihrer Unabhängigkeit<br />
von sozialen Bedingungen teilt die sozialwissenschaftliche Technikforschung mit <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik. GeschlechterforscherInnen adressieren das<br />
Argument jedoch häufig eher an das in <strong>de</strong>r Informatik vorherrschen<strong>de</strong> objektivistische<br />
Wissenschaftsverständnis, beispielsweise gegen die Auffassung, dass <strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>r<br />
Softwareentwicklung rein formalen, technikinternen Logiken folgen wür<strong>de</strong> und bei <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterordnung, die in Kapitel 2 dargestellt wur<strong>de</strong>n und auf die ich weiter unten zurückkommen<br />
wer<strong>de</strong>.<br />
81 Technologischer Determinismus umfasst oft auch eine Techniktheorie, welche die Entwicklung von<br />
Technologie auf einzelne Erfin<strong>de</strong>r (in <strong>de</strong>r Regel Männer) sowie ihre Durchsetzung auf marktwirtschaftliche<br />
Prinzipien zurückführt. „This approach suggests that each generation produces a few inventors, whose<br />
inventions appear to be both the <strong>de</strong>terminants and stepping stones of human <strong>de</strong>velopment. Unsuccessful<br />
inventions are con<strong>de</strong>mned by their failure to the dustheap of history. Successful ones prove their value<br />
and are rapidly integrated into society, which they proceed to transform. In this sense, a technological<br />
breakthrough is claimed to have important social consequences.” (Henwood et al. 2000, 9). Eine solche<br />
Ansicht fin<strong>de</strong>t sich häufig in <strong>de</strong>n gesellschaftspolitischen Debatten um die Informationsgesellschaft.<br />
82 Auf diese unterschiedlichen Facetten <strong>de</strong>s technologischen Determinismus verweist Mona Singer. In <strong>de</strong>r<br />
klassischen Version, die sie als „objektivistisch evolutionäre hard science-Perspektive“ bezeichnet, wür<strong>de</strong>n<br />
Technologien als Umsetzung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse verstan<strong>de</strong>n, die nach forschungsimmanenten<br />
Regeln <strong>de</strong>r Objektivität gewonnen wur<strong>de</strong>n. Die zweite Version <strong>de</strong>s Technik<strong>de</strong>terminismus,<br />
die sie in <strong>de</strong>r Fortschrittskritik <strong>de</strong>r Linken (z.B. Günter An<strong>de</strong>rs) i<strong>de</strong>ntifiziert, begreift Technik als<br />
eine Übermacht, die eine selbst geschaffene Bedrohung für die Menschheit darstellt (z.B. Atombombe,<br />
globale Erwärmung) und die daraus resultiert, dass die mit <strong>de</strong>r Aufklärung in Gang gesetzte Ermächtigung<br />
<strong>de</strong>s rationalen Subjekts in Zweckrationalität umgeschlagen ist. Eine dritte, <strong>de</strong>mgegenüber eher technikeuphorische<br />
Variante verortet Singer in <strong>de</strong>r marxistischen Tradition, die in Naturwissenschaft und Technik<br />
Verbün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>s Sozialismus sieht. Technik wür<strong>de</strong> dort als Teil <strong>de</strong>r Sprengkraft <strong>de</strong>r Produktivkräfte gefasst,<br />
die <strong>de</strong>n kulturellen Überbau <strong>de</strong>terminierten und <strong>de</strong>n sozialen Wan<strong>de</strong>l verursachten (vgl. Singer 2003, 111).<br />
31
Mo<strong>de</strong>llierung die „Realität“ eines Anwendungskontextes quasi abgebil<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n könne.<br />
83 Im Kontrast dazu richtete sich Winner gegen <strong>de</strong>n damals in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Techniktheorie vorherrschen<strong>de</strong>n Strang <strong>de</strong>r Technikfolgenabschätzung:<br />
„Traditionally, social research has ten<strong>de</strong>d to focus on the ‚effects of technology on society’,<br />
its ’impact’, its ‘implications’, and so on” (Edge 1995 [1988], 14). Das Brückenbeispiel<br />
weist damit Geschlechterforschungsansätze in <strong>de</strong>r Informatik darauf hin, dass<br />
ein Verständnis <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte immer auch grundlegen<strong>de</strong> Annahmen<br />
über das Verhältnis von Technik und Gesellschaft enthält. Die Frage nach einem<br />
Konzept <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung wirft <strong>de</strong>mzufolge nicht nur erkenntnistheoretische<br />
Probleme auf, son<strong>de</strong>rn heißt zugleich, Fragen nach <strong>de</strong>r Natur <strong>de</strong>s Technischen und<br />
<strong>de</strong>s Sozialen sowie ihres Zusammenhangs bzw. <strong>de</strong>s Verhältnisses zwischen Menschen<br />
und Maschinen zu beantworten. Diese Fragen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung kontrovers diskutiert. Dabei wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r letzten 30<br />
Jahre ein breites Spektrum grundlegen<strong>de</strong>r Ansätze entwickelt, die auch <strong>einer</strong> feministischen<br />
Analyse unterzogen wor<strong>de</strong>n sind und damit für eine theoretische Fundierung<br />
<strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte vielversprechend erweisen. Diese wer<strong>de</strong>n im<br />
Kapitel 3.3. ausführlicher vorgestellt.<br />
Drittens: Ein weiteres Argument dafür, das Brückenbeispiel im Kontext <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
von Technologien zu diskutieren, besteht in <strong>de</strong>m emanzipatorisch<br />
intendierten Ansatz, einen in <strong>de</strong>n Artefakten manifestierten sozialen Ausschluss als<br />
verborgene Herrschaftssstruktur zu rekonstruieren. Ein großer Teil <strong>de</strong>r Empörung, die<br />
die Geschichte Winners gemeinhin hervorzurufen vermag, grün<strong>de</strong>t auf <strong>de</strong>r entlarvten<br />
Unsichtbarkeit <strong>de</strong>s Sozialen in <strong>de</strong>m fertig gestellten technischen Artefakt. Diesen Effekt<br />
beschreibt Winner anhand von Richard Moses Konstruktionen: „Many of his monumental<br />
structures of concrete and steel embody a systematic social inequality, a way of<br />
engineering relationships among people that, after a time, becomes just another part of<br />
the landscape” (Winner 1999 [1980], 31). Ist das Artefakt erst einmal in die Landschaft<br />
integriert, so erscheint es dort als selbstverständlich. Das dahinter liegen<strong>de</strong> Soziale<br />
wird nicht mehr hinterfragt. Was Winners Argumentation Überzeugungskraft verleiht,<br />
lässt sich – so die Soziologin und Technikforscherin Bettina Heintz – nicht allein auf die<br />
„Externalisierung <strong>de</strong>s Sozialen“ zurückführen. Das Problem bestün<strong>de</strong> vielmehr darin,<br />
dass das Soziale mit <strong>de</strong>r Verlagerung in technische Artefakte gleichzeitig unsichtbar<br />
gemacht wird. „Anstatt Verbotsschil<strong>de</strong>r aufzustellen ‚Zutritt für Schwarze nicht<br />
gestattet!‘, wer<strong>de</strong>n Brücken gebaut, die für Busse unpassierbar sind. Ein Verbotsschild<br />
– ‚Zutritt für Schwarze verboten!’ – macht die Diskriminierung offensichtlich und ruft<br />
Protest hervor. Eine Tafel mit <strong>de</strong>m Hinweisschild ‚Max. Durchfahrtshöhe 2,70 m’ erfüllt<br />
<strong>de</strong>n gleichen Zweck, ohne dass dies auf <strong>de</strong>n ersten Blick erkennbar ist.<br />
Diskriminierung ist hinter – o<strong>de</strong>r besser in – <strong>de</strong>r Technik versteckt und damit <strong>de</strong>m<br />
Alltagsbewußtsein entzogen ... D.h. mit zunehmen<strong>de</strong>r Technisierung wird es immer<br />
schwieriger, die in technischen Artefakten verborgenen sozialen Strukturen zu<br />
erkennen“ (Heintz 1994, 14). 84<br />
83 Für erkenntnis<strong>kritisch</strong>e Perspektiven auf die Prozesse <strong>de</strong>r Softwareentwicklung vgl. Floyd et al. 1992<br />
sowie Bath 2009 in Bezug auf Emotionskonzepte in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung.<br />
84 Joerges Versuch <strong>de</strong>r Dekonstruktion Winners sowie die Reaktionen von Woolgar und Cooper erschie-<br />
nen erst nach Heintz Interpretation.<br />
32
Zahlreiche feministische wie gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Ansätze <strong>de</strong>r Informatik teilen<br />
Winners Anliegen, Einschreibungen von Ungleichheitsstrukturen in Technologien<br />
herauszuarbeiten, Sowohl vom Standpunkt <strong>de</strong>r Technikgestaltung als auch von <strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>r Technikforschung geht es darum, Selbstverständnisse <strong>de</strong>r TechnikentwicklerInnen,<br />
die diese bewusst o<strong>de</strong>r unbewusst in <strong>de</strong>n Artefakten vergegenständlichen, transparent<br />
zu machen. Unhinterfragte Annahmen über das Soziale im Gestaltungsprozess <strong>de</strong>r<br />
Technologie sollen sichtbar und damit <strong>de</strong>r Kritik zugänglich gemacht wer<strong>de</strong>n. Das<br />
gemeinsame Ziel besteht damit in <strong>de</strong>r Rekonstruktionsarbeit, Selbstverständnisse und<br />
Annahmen <strong>de</strong>r EntwicklerInnen, die in <strong>de</strong>r Technologie verborgen sind, aufzuzeigen.<br />
Dies wirft die Frage nach <strong>einer</strong> theoretischen Fundierung und geeigneten Methodik auf,<br />
die <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Rekonstruktion impliziter Annahmen in <strong>de</strong>r Technik anleiten können.<br />
Die sozialwissenschaftliche Technikforschung hat bereits eine breite Palette von<br />
Vorgehensweisen entwickelt, um Ungleichheitsstrukturen in <strong>de</strong>n Artefakten zu analysieren.<br />
Auch von diesen Theoriebildungen und Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Technikforschung<br />
kann die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik lernen.<br />
An dieser Stelle wer<strong>de</strong>n jedoch bereits Grenzen <strong>de</strong>r Bezugnahme auf das Brückenbeispiel<br />
aus <strong>informatischer</strong> Perspektive <strong>de</strong>utlich. Denn während Winners Absicht<br />
primär darin besteht, die <strong>einer</strong> Technologie eingeschriebenen Agen<strong>de</strong>n politischer o<strong>de</strong>r<br />
ökonomischer Interessen zu „enthüllen“, bleiben VertreterInnen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
in <strong>de</strong>r Informatik nicht bei <strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>en o<strong>de</strong>r feministischen<br />
Analyse stehen. Ihr Interesse besteht vielmehr darin, Erkenntnisse über die Politik und<br />
Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Artefakte in die Technologiegestaltung zurückzuführen. Das<br />
Wissen über die sozialen Strukturen, die sich in <strong>de</strong>n Artefakten fin<strong>de</strong>n lassen, soll nach<br />
Möglichkeit in konkrete Handlungsanweisungen für die Gestaltung <strong>einer</strong> Technologie<br />
transformiert wer<strong>de</strong>n, um <strong>de</strong>r Reproduktion und Verfestigung von Ungleichheit durch<br />
Technologie entgegenzuwirken.<br />
Um in diesem Sinne eine Richtung zur Gestaltung von Technik angeben zu können,<br />
muss nicht nur aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, warum eine in Bezug auf das betrachtete Artefakt<br />
i<strong>de</strong>ntifizierte Politik o<strong>de</strong>r eine herausgearbeitete Vergeschlechtlichung problematisch<br />
ist. Es ist gleichzeitig positiv zu bestimmen, welche Form und Funktion die zu<br />
entwickeln<strong>de</strong> Technologie aus feministischer bzw. gesellschaftstheoretisch <strong>kritisch</strong>er<br />
Perspektive haben soll. Darüber hinaus sollte aus <strong>informatischer</strong> Sicht eine Vorgehensweise<br />
angegeben wer<strong>de</strong>n, wie die gewünschte Gestalt <strong>de</strong>s Artefaktes erreicht wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Feministische wie <strong>kritisch</strong>e Ansätze in <strong>de</strong>r Informatik stehen somit vor <strong>de</strong>m<br />
grundsätzlichen Problem, normative Setzungen in Bezug auf eine wünschenswerte<br />
Gestalt und <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess vornehmen zu müssen.<br />
Während es Winner 1980 plausibel erschien, dass Solarenergie mit <strong>de</strong>mokratischen<br />
Strukturen gut zusammenpasst („strongly compatible“, Winner 1999 [1980], 33),<br />
erscheint es heutzutage sowohl aus <strong>de</strong>r Perspektive aktueller gesellschaftlicher<br />
Entwicklungen wie auch auf Grundlage <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
unklar, welche Technologien wir gegenwärtig als egalitär, <strong>de</strong>mokratisch o<strong>de</strong>r emanzipatorisch<br />
bezeichnen können. Ebenso unsicher scheint, welche Technologien sich<br />
unter welchen Umstän<strong>de</strong>n als „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ begreifen ließen. Dies stellt<br />
ein grundsätzliches Problem dar, auf das ich in einem späteren Kapitel (Kapitel 5)<br />
zurückkommen wer<strong>de</strong>.<br />
33
Die theoretischen Unsicherheiten beginnen jedoch nicht erst bei <strong>de</strong>r Frage nach<br />
<strong>einer</strong> alternativen Gestaltung von Technologie, die sich primär darüber <strong>de</strong>finiert, dass<br />
ihr keine Ungleichheitsstruktur eingeschrieben ist. Vielmehr treten sie bereits bei <strong>de</strong>r<br />
Konzeption <strong>de</strong>s Politischen <strong>de</strong>r Artefakte auf. Winner hatte eine sehr vereinfachte Vorstellung<br />
von Unterdrückung und Diskriminierungstrukturen – eine Sichtweise, die auf<br />
<strong>de</strong>r Basis aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen sowie ihrer Theoretisierung nicht<br />
mehr adäquat erscheint und neu konzeptualisiert wer<strong>de</strong>n muss. Ebenso wie seine<br />
gesellschaftstheoretischen Annahmen ist auch seine Konzeption <strong>de</strong>s Verhältnisses von<br />
Technologien und Gesellschaft zu überarbeiten und auszudifferenzieren. Im verbleiben<strong>de</strong>n<br />
Teil dieses Kapitels wer<strong>de</strong>n Fragen <strong>de</strong>r Ungleichheit entlang <strong>de</strong>r Verständnisse<br />
sozialwissenschaftlicher und feministischer Technikforschung diskutiert und im<br />
Anschluss daran wird auf die Kategorie Geschlecht fokussiert, wie sie in <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung innerhalb <strong>de</strong>r letzten 30 Jahre konzeptualisiert wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Soweit betrachtet hat sich die <strong>kritisch</strong>e Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit Winners Aussagen<br />
über <strong>de</strong>n politischen Charakter von Technologien bereits als produktiv erwiesen, um<br />
die Problemstellung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring informationstechnischer Artefakte<br />
zu bearbeiten. Die Fragen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung und <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r Artefakte<br />
wiesen <strong>einer</strong>seits genügend Gemeinsamkeiten auf, um Übertragungen zuzulassen. So<br />
muss ein theoretisch fundierter Ansatz, <strong>de</strong>r die Vergeschlechtlichung von Technologien<br />
beschreiben will, grundlegen<strong>de</strong> Fragen nach <strong>de</strong>r Konzeption <strong>de</strong>s Verhältnisses von<br />
Technik und Gesellschaft, von Mensch und Maschine, nach <strong>de</strong>r Intention und Verantwortung<br />
von TechnologiegestalterInnen für ihre Produkte o<strong>de</strong>r die <strong>de</strong>s methodischen<br />
Zugriffs beantworten, die genuiner Gegenstand <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
sind. Dies betrifft nicht nur die Frage nach <strong>de</strong>n Grenzen <strong>de</strong>r Übertragbarkeit,<br />
beispielweise aufgrund qualitativer Unterschie<strong>de</strong> zwischen Stahlkonstruktionen und informatischen<br />
Artefakten, zwischen StadtplanerInnen und InformatikerInnen, o<strong>de</strong>r das<br />
vor <strong>de</strong>m Hintergrund aktueller Gesellschaftstheorien reduzierte Verständnis von Ungleichheit.<br />
Vielmehr greift Winners Plädoyer auch aus Sicht <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung an einigen Stellen zu kurz. Die Argumente, die sein Aufsatz in<br />
<strong>de</strong>n Debatten <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung <strong>de</strong>r letzten 25 Jahre darlegt,<br />
geben wertvolle Hinweise darauf, worin Fehlschlüsse auf theoretischer Ebene<br />
sowie systematische Verkürzungen liegen, die auf ein (noch zu entwickeln<strong>de</strong>s) Verständnis<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Artefakten ebenso zutreffen könnten. Sie sprechen<br />
damit Warnungen für eine feministische Analyse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von<br />
Technologien aus. Deshalb soll diesen Argumentationen hier Raum gegeben wer<strong>de</strong>n,<br />
um für das Anliegen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik – positiv wie negativ<br />
– von <strong>de</strong>n Entwicklungen im Feld <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
lernen zu können.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n möchte ich anhand <strong>de</strong>r Rezeption <strong>de</strong>s Brückenbeispiels in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung und <strong>de</strong>r daran anschließen<strong>de</strong>n Theorieentwicklung<br />
herausarbeiten, wie sich das Gen<strong>de</strong>ring informationstechnischer Artefakte<br />
theoretisch fassen lässt. Ziel ist es, eine allgemeine Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring technischer<br />
Artefakte zu entwickeln, die auf eine feministische Technikgestaltung hinführt<br />
und dabei we<strong>de</strong>r in dieselben theoretischen Fallstricke hineinstolpert, in <strong>de</strong>nen sich<br />
Protagonisten wie Winner o<strong>de</strong>r seine Gegenspieler bereits verwickelt hatten, noch <strong>de</strong>n<br />
34
politischen Charakter von Technologien aus <strong>de</strong>n Augen verliert, auf <strong>de</strong>n Winner hingewiesen<br />
hatte. 85<br />
3.2. Verkürzungen: Kritiken an Winners Brückenbeispiel in <strong>de</strong>r<br />
sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
In seinem Aufsatz „Die Brücken <strong>de</strong>s Robert Moses“ argumentiert Joerges, dass Winners<br />
Argument historisch inkorrekt ist. Ein Angriffspunkt <strong>de</strong>r Kritik ist die Moses unterstellte<br />
rassistische Absicht. Joerges zufolge erweist sich die Quelle, aus <strong>de</strong>r Winner<br />
<strong>de</strong>n Rassismusvorwurf an Moses bezieht, 86 als unglaubwürdig. Dennoch will er sich<br />
kein Urteil darüber anmaßen, ob Moses tatsächlich bewusst intendierte, Schwarze von<br />
<strong>de</strong>n Strän<strong>de</strong>n ausschließen, son<strong>de</strong>rn vermutet, dass Moses „wie praktisch je<strong>de</strong>r Angehörige<br />
<strong>de</strong>s Ostküsten-Establishments <strong>de</strong>r damaligen Zeit“ ein „struktureller Rassist“<br />
war. „Er unterstützte und implementierte eine Politik, die er als liberal und reformerisch<br />
verstand, eine Politik, die nichts<strong>de</strong>stoweniger die vorherrschen<strong>de</strong>n Rassenbeziehungen<br />
unangetastet ließ und hinnahm, dass die rasante ökonomische Entwicklung bis zur<br />
Depression sie noch zu verschärfen drohte. In einem Wort: Was Moses tat und dachte,<br />
war Normalform in seinen Kreisen, und er sah sich je<strong>de</strong>rzeit in voller Übereinstimmung<br />
mit <strong>de</strong>n vorwiegend <strong>de</strong>mokratischen und New-Deal-Politikern.“ (Joerges 1999a, 54).<br />
Joerges erklärt hier strukturellen Rassismus zur nicht weiter zu befragen<strong>de</strong>n<br />
Normalität <strong>einer</strong> bestimmten Schicht. Er versucht damit ein entpolitisiertes Verständnis<br />
nicht nur von Technik son<strong>de</strong>rn generell von Herrschaft zu etablieren. Joerges bagatellisiert<br />
hier die aktive Partizipation an einem hegemonialen Herrschafts- und Ausschließungszusammenhang.<br />
Durch ein „Mehrheitsargument“ wer<strong>de</strong>n Moses, seine<br />
Kreise, aber ebenso sozialwissenschaftliche Technikforscher_innen wie technische<br />
Artefakte freigesprochen von Verantwortlichkeit für bestimmte Ungleichheitsstrukturen.<br />
In Bezug auf die Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Artefakte scheint in <strong>de</strong>r Informatik eine<br />
vergleichbare Situation vorzuliegen, da diese in ähnlicher Weise unbeabsichtigt ist.<br />
Auch in diesem Kontext wür<strong>de</strong> vermutlich kaum jemand explizit und bewusst Frauen<br />
durch Informationstechnologien ausschließen o<strong>de</strong>r diskriminieren wollen. Dennoch<br />
kann dort Geschlecht als strukturelle Ungleichheitsstruktur auch im Technikgestaltungsprozess<br />
wirksam wer<strong>de</strong>n, wenn die „Normalform“ <strong>de</strong>s Denkens in Kreisen von<br />
TechnikentwicklerInnen nicht grundlegend gesellschafts<strong>kritisch</strong> reflektiert wird. Die<br />
fehlen<strong>de</strong> diskriminieren<strong>de</strong> Absicht <strong>de</strong>s Konstrukteurs besagt nicht, dass das technische<br />
Artefakt nicht trotz<strong>de</strong>m politisch bzw. vergeschlechtlicht sein kann. Im Gegenteil. Auch<br />
die im nachfolgen<strong>de</strong>n Kapitel vorgestellten Beispiele für das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte lassen nicht notwendigerweise auf eine von <strong>de</strong>n EntwicklerInnen intendierte<br />
Diskriminierung zurückschließen. Gera<strong>de</strong> aber, wenn die nicht-intentionale Fortschrei-<br />
85 Es ist jedoch zu fragen, warum kein vergleichbares Beispiel für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Informationstechnologien<br />
und die Kategorie Geschlecht bekannt gewor<strong>de</strong>n ist. Ein solches Beispiel für das Gen<strong>de</strong>ring informationstechnologischer<br />
Artefakte hätte die Institutionalisierung <strong>de</strong>r Geschlechterforschung innerhalb <strong>de</strong>r Informatik<br />
vermutlich schneller voran bringen können als das bisher geschehen ist. Im Folgen<strong>de</strong>n wird jedoch<br />
anhand <strong>de</strong>r Debatten <strong>de</strong>r sozialwissenschafltichen Technikforschung dargelegt, dass das Fehlen<br />
eines solchen einschlägigen „guten Beispiels“ darauf verweist, dass die Frage so falsch gestellt ist. Die<br />
Vergeschlechtlichung von Artefakten ist ein komplexer Prozess, <strong>de</strong>r sich nicht durch ein simples Beispiel<br />
veranschaulichen lässt.<br />
86 Winner bezieht sich vornehmlich auf die Moses-Biografie von Robert Caro: „The Power Broker: Robert<br />
Moses and the Fall of New York“ (Caro 1974).<br />
35
ung von Ungleichheitsstrukturen dafür <strong>de</strong>r Normalfall ist, wie Technologien einen politischen<br />
beziehungsweise geschlechtlichen Charakter erhalten, kommt es darauf an, die<br />
Mechanismen, die diesen Prozessen zugrun<strong>de</strong> liegen, herauszuarbeiten und – in einem<br />
ersten Schritt – genauer zu begreifen, anstatt diese <strong>einer</strong> weiteren, diesmal wissenschaftlichen<br />
Legitimationsschleife zu unterziehen und sie, so wie Joerges vorführt,<br />
erneut zu bestätigen.<br />
Joerges führt seine Dekonstruktion <strong>de</strong>s Brückenbeispiels fort, in<strong>de</strong>m er eine alternative<br />
Erklärung dafür liefert, warum die Brücken so niedrig gebaut wor<strong>de</strong>n sind. Nach<br />
US-amerikanischen Regelungen war und ist je<strong>de</strong>r kommerzielle Verkehr von Lastwagen<br />
bis hin zu öffentlichen Bussen auf <strong>de</strong>n Parkways verboten. Sie führten durch landschaftlich<br />
reizvolle Parks, die ursprünglich für Erholungsfahrten und nicht als Allzwecktransportweg<br />
gedacht waren. Parkways seien ein beson<strong>de</strong>rer Straßentyp, <strong>de</strong>r sich gera<strong>de</strong><br />
durch <strong>de</strong>n Ausschluss <strong>de</strong>s kommerziellen Verkehrs <strong>de</strong>finiert, im Vergleich zu <strong>de</strong>n<br />
sogenannten Freeways, die allen Arten von Fahrzeugen freien Zugang bieten. Joerges<br />
betont, dass viele TechnikforscherInnen Moses Konstruktion als Abweichung von<br />
einem in <strong>de</strong>n USA gelten<strong>de</strong>n Stand <strong>de</strong>r Brückenbautechnik interpretiert hatten, dabei<br />
hätte Moses „mit seinen Brücken nichts an<strong>de</strong>res getan als je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Parkway-Beauftragte<br />
im ganzen Land auch“ (Joerges 1999a, 57).<br />
Damit verweist Joerges auf ein Problem, dass auch bei <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte relevant wer<strong>de</strong>n kann. Es liegt nicht ausschließlich in <strong>de</strong>r Hand<br />
<strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen, einen diskriminieren<strong>de</strong>n Effekt von Technologien verstärken<br />
(o<strong>de</strong>r auch verhin<strong>de</strong>rn) zu können. Der Prozess ist vielmehr verwickelt in ein komplexeres<br />
Netzwerk von Gesetzen, informellen Regeln, organisatorischen Strukturen, ökonomischen<br />
Interessen uvm., 87 in <strong>de</strong>m auch wi<strong>de</strong>rsprüchliche Beiträge zu <strong>de</strong>m sozialen<br />
Auschluss geleistet wer<strong>de</strong>n können, die eine individuelle „Schuldzuschreibung“ unmöglich<br />
machen. Dennoch kann ihm vorgehalten wer<strong>de</strong>n, dass es im Fall <strong>de</strong>r Brücken<br />
zumin<strong>de</strong>st prinzipiell möglich gewesen wäre, sich politisch für die Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
offenbar diskriminieren<strong>de</strong>n Parkway-Regelung, keine öffentlichen Busse zuzulassen,<br />
einzusetzen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rweitig auf diesen rassisieren<strong>de</strong>n und klassisieren<strong>de</strong>n Effekt <strong>de</strong>r<br />
Regelung aufmerksam zu machen.<br />
KritikerInnen Winners warfen diesem nicht nur vor, dass er <strong>de</strong>m Brückenkonstrukteur<br />
Moses einen strukturellen Rassismus unterstelle, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>uteten diese Haltung<br />
gar als persönliche, in<strong>de</strong>m sie ihm die Verantwortung für die Zementierung <strong>de</strong>s sozialen<br />
Ausschlusses in <strong>de</strong>r Technik zuschrieben. Sie beanstan<strong>de</strong>ten zugleich, dass er<br />
Übereinstimmungen zwischen <strong>de</strong>r Intention <strong>de</strong>s Konstrukteurs und <strong>de</strong>r tatsächlichen<br />
Wirkung <strong>de</strong>s Artefaktes annimmt. AutorInnen verschie<strong>de</strong>nster theoretischer Couleur<br />
haben seither herausgearbeitet, dass <strong>de</strong>r Gestaltungskontext klar vom Nutzungskontext<br />
<strong>einer</strong> Technologie zu unterschei<strong>de</strong>n ist, ohne dies jedoch als Grund für die<br />
Ablehnung von Verantwortung zu missbrauchen (vgl. etwa Bijker et al. 1987,<br />
Oudshoorn/ Pinch 2003 sowie die dort angegebenen Studien). Eine Reihe von<br />
Fallstudien zeigte beispielsweise, dass NutzerInnen sich Technologien in an<strong>de</strong>rer<br />
87 Joerges führt explizit auch ökonomische Grün<strong>de</strong> an: eine Höherlegung <strong>de</strong>r Brücken hätte erhebliche<br />
Mehrkosten verursacht. Von Ingenieuren erwarte man jedoch generell, dass sie die ökonomisch günstigste<br />
Lösung für ihre Aufgaben fän<strong>de</strong>n (vgl. Joerges 1999a, 54). Diese Reduktion ingenieurwissenschaftlichen<br />
Han<strong>de</strong>lns auf <strong>de</strong>n bestmöglichen Kosten-Nutzen-Faktor ist m.E. jedoch gera<strong>de</strong> im Bereich<br />
staatlicher Infrastrukturmaßnahmen grundlegend zu hinterfragen.<br />
36
Weise aneignen als von <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen intendiert. Das „Scratchen“ mit<br />
einem Plattenspieler ist dafür ebenso ein Beispiel wie die Nutzung <strong>de</strong>s Autos als<br />
stationäre Energiequelle im ländlichen US-Amerika (vgl. Kline/ Pinch 1996). Die<br />
Beziehungen zwischen technologischem Design und Use erscheinen <strong>de</strong>mnach äußerst<br />
komplex und prinzipiell unvorhersagbar. Die Annahme, dass Gestaltungsziele und tatsächliche<br />
Nutzung übereinstimmen, bezeichnet Albrechtslund (2007) als „Positivismusproblem“:<br />
„I name it ‘positivism’, because it is the <strong>de</strong>fault position that the <strong>de</strong>sign of<br />
a technology will – more or less – correspond with the use of technology and this<br />
relation does not pose a problem” (Albrechtslund 2007, 68). 88<br />
In <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung war Steve Woolgar <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r<br />
ersten, <strong>de</strong>r auf dieses Problem in Winners Argument aufmerksam gemacht hatte:<br />
„[T]he motivations of the <strong>de</strong>signer are ren<strong>de</strong>red consistent with the effects of the<br />
<strong>de</strong>sign. This is <strong>de</strong>spite the frequently noted phenomena (a) that effects of a technology<br />
frequently diverge from the inten<strong>de</strong>d effects and (b) that a whole series of different<br />
effects can be said to result from the same technology.[…] Despite the argument that<br />
the outcome or impact of technologies are contentious, that it is highly problematic to<br />
nominate one or other effect as arising from technology per se than from other social<br />
‘factors’, [Winner’s story] unproblematically nominates the outcome (effects) of a<br />
technology” (Woolgar 1991a, 34, Hervorhebung im Orig.). Winner beschränke also<br />
seine Interpretation <strong>de</strong>r Brücken auf einen einzigen Effekt: ihre Funktion sei das<br />
Fernhalten <strong>de</strong>r sozial Schwachen und Schwarzen von <strong>de</strong>n weißen Strän<strong>de</strong>n. Er<br />
versuche nicht, wie Woolgar ihm vorwirft, das damit <strong>de</strong>n Brücken zugeschriebene<br />
Potential, auf das Soziale Einfluss zu nehmen, zu <strong>de</strong>konstruieren, son<strong>de</strong>rn setze<br />
voraus, was zu untersuchen sei. 89<br />
Ein wesentlicher Aspekt <strong>de</strong>r Macht <strong>de</strong>r Brücken bzw. <strong>de</strong>r Überzeugungsfähigkeit<br />
von Winners Geschichte resultiert aus <strong>de</strong>r Vorstellung, die unter ihnen durchgeführten<br />
Parkways seien exklusive Zugänge zu <strong>de</strong>n Strän<strong>de</strong>n Long Islands gewesen. Diese<br />
These bezeichnet Joerges, wie viele an<strong>de</strong>re, als absurd. Er führt dagegen parallel verlaufen<strong>de</strong><br />
Strassen wie <strong>de</strong>n ebenfalls von Moses gebauten Expressway sowie öffentliche<br />
Zugverbindungen an. In Woolgar und Cooper’s Artikel (1999) ist sogar ein Busfahrplan<br />
für die entsprechen<strong>de</strong> Strecke abgedruckt. Die Belege richten sich vornehmlich<br />
gegen die weit verbreitete Interpretation, dass Moses die Brücken physisch so gestaltete,<br />
dass ausschließlich die willkommenen Besucher passieren konnten, während<br />
sämtlichen an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>r Zugang verwehrt wur<strong>de</strong>.<br />
Während Joerges, Woolgar und Cooper ihre Argumentation als grundlegen<strong>de</strong><br />
Dekonstruktion verstehen, 90 <strong>de</strong>ute ich ihre Einwän<strong>de</strong> in Übertragung auf die Frage <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte primär dahingehend, dass Technologien vergeschlechtlicht<br />
88 Auf die Möglichkeit, <strong>de</strong>n Artefakten bewusst ein emanzipatorisches Moment durch eine entsprechen<strong>de</strong><br />
Gestaltung einzuschreiben wer<strong>de</strong> ich bei <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring informationstechnologischer<br />
Artefakte in Kapitel 5 zurückkommen.<br />
89 „Winner makes his case by treating as <strong>de</strong>finitive what might be elsewhere treated […] as essentially<br />
contingent and contextable versions of the capacity of technology. He is not concerned to <strong>de</strong>construct<br />
these particular versions of technical capacity, although from the point of view of a broad constructivist<br />
commitment, they are clearly part of the phenomena to be investigated“ (Woolgar 1991a, 35).<br />
90 Grint und Woolgar (1995) kritisieren Winners Position als normativ, es ginge ihm vornehmlich darum<br />
nachzuweisen, dass Technologien politisch sind. Joerges geht in dieser Interpretation sogar noch weiter,<br />
in<strong>de</strong>m er Winner vorwirft, dass es ihm nicht um Wissenschaftlichkeit ginge. Er zitiert ihn aus einem Interview<br />
zu <strong>de</strong>m Artefakt-Artikel: „Ich bin nicht an Theorien interessiert, son<strong>de</strong>rn an moralischen Fragen. Es<br />
geht mir nicht um Erklärungen, son<strong>de</strong>rn um politische Entscheidungen“ (Winner nach Joerges 1999a, 60).<br />
37
sein können, ohne, dass Frauen dadurch bestimmte Handlungsmöglichkeiten ein<strong>de</strong>utig<br />
versperrt bleiben. Selbst wenn das Artefakt eine Bedienung nahe legt, welche die Ungleichheitsstruktur<br />
„Geschlecht“ zwar fortschreibt, diese aber letztendlich umgangen<br />
wer<strong>de</strong>n kann, spreche ich – in Anlehnung an neuere Interpretationen <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung – von <strong>einer</strong> Einschreibung von Geschlecht in das Artefakt.<br />
91 Ebenso spreche ich unter bestimmten Umstän<strong>de</strong>n von <strong>einer</strong> Vergeschlechtlichung<br />
<strong>de</strong>r Technologie, selbst wenn alternative Formen <strong>de</strong>r Nutzung bzw. Nichtnutzung<br />
<strong>de</strong>s vergeschlechtlichten Artefakts bestehen. Denn auch diese Möglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Umgehung können wie<strong>de</strong>rum durch die soziale Geschlechterordnung strukturiert sein.<br />
Die Formen <strong>de</strong>r Reproduktion von Geschlecht als Strukturkategorie sind komplexer als<br />
sie auf ein<strong>de</strong>utige Unterdrückung von Frauen o<strong>de</strong>r Behin<strong>de</strong>rung von Frauen bei <strong>de</strong>r<br />
Nutzung von Technologie beschränken zu können.<br />
.Von Seiten <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung wirft auch Bruno Latour<br />
Licht auf die Debatte, in<strong>de</strong>m er Winners Argumentationen weiter führt. Er hinterfragt die<br />
von Winner postulierte Politik <strong>de</strong>r Artefakte: „But what does it mean to say that bridges<br />
‘embody’, ‘reify’ or ‘materialise’ some political intent?“ (Latour 2004, o.S.). Zwar stimmt<br />
er zu, dass je<strong>de</strong>r Kontakt und je<strong>de</strong> Interaktion mit <strong>einer</strong> Technologie unsere<br />
Handlungsweise beeinflusst und verän<strong>de</strong>rt. Das be<strong>de</strong>ute jedoch nicht, dass dadurch<br />
notwendigerweise eine in <strong>de</strong>m Artefakt verankerte Form <strong>de</strong>r Diskriminierung zum Ausdruck<br />
kommen wür<strong>de</strong>. Vielmehr eröffneten Technologien auch Handlungsmöglichkeiten:<br />
„We are also, thanks to them, ‘allowed’, ‘permitted’, ‘enabled’, ‘authorised’ to do<br />
things. Thus, to say that our ordinary course of action is intermingled with artifacts does<br />
not mean that they have politics” (Latour 2004, o.S.).<br />
Latour betrachtet Artefakte nicht als neutrale Objekte, die von Interessen und<br />
Werten unabhängig sind, son<strong>de</strong>rn als zentrale Knoten von Machtkämpfen. Insofern<br />
versteht er sie durchaus politisch. Er wen<strong>de</strong>t sich jedoch <strong>de</strong>zidiert gegen die<br />
Vorstellung Winners, dass Technologien nach <strong>de</strong>m Motto: “Give me the social<br />
structure, I will give you the shape technology should take” (Latour 2004, o.S.) eine<br />
Form <strong>de</strong>r Unterdrückung verkörperten. Denn dies hieße, dass die Konstruktionen nur<br />
<strong>de</strong>n reinen Effekt <strong>einer</strong> Herrschaftsstruktur in sich trügen, nicht aber selbst aktiv wirken<br />
könnten. Insofern wer<strong>de</strong> die Neutralitätsauffassung, die ehemals Gegenstand <strong>de</strong>r Kritik<br />
war, doch wie<strong>de</strong>r bestätigt.<br />
Für Latour besteht die Politik <strong>de</strong>r Artefakte nicht – wie es Winners Geschichte nahe<br />
legt – darin, dass TechnologiegestalterInnen soziale Ungerechtigkeiten irreversibel und<br />
materiell festschreiben. Im Gegenteil. In Abwandlung und Zuspitzung <strong>de</strong>s bereits angesprochenen<br />
Phänomens <strong>de</strong>r nicht-intendierten Nutzung von Technologien sieht er das<br />
Problem gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>n Macht und Kontrolle <strong>de</strong>r IngenieurInnen über die späteren<br />
Auswirkungen ihrer Konstruktionen. Als Beispiel dafür führt er das Hausmannsche<br />
Gebäu<strong>de</strong> an, das er in Paris bewohnt. Dessen Architektur wäre zu Zeiten s<strong>einer</strong><br />
Entstehung darauf ausgerichtet gewesen, die alltäglichen Wege <strong>de</strong>r höheren Klasse<br />
und die <strong>de</strong>s Dienstleistungspersonals klar voneinan<strong>de</strong>r abzugrenzen. Heutzutage habe<br />
dies allerdings <strong>de</strong>n Effekt, dass er seine Wohnung im 6. Stock bequem über <strong>de</strong>n Fahrstuhl<br />
erreichen kann, während die Studieren<strong>de</strong>n, die ihn besuchen wollen, die öffentlich<br />
zugänglichen Treppen benutzen müssten. Die sozialen Formungen von Technologien<br />
91 Vgl. hierzu das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept (Rommes 2002) bzw. die Ausführungen dazu im Kapitel 3.7.<br />
38
ächten also mitunter unerwartete Konsequenzen hervor, die von <strong>de</strong>n ursprünglichen<br />
Absichten <strong>de</strong>r GestalterInnen stark abweichen können. „But if artifacts do more than<br />
‘objectifying’ some earlier political scheme, if their <strong>de</strong>sign is full of unexpected consequences,<br />
if their durability means that all the original i<strong>de</strong>as their <strong>de</strong>signers entertained<br />
about them will have drifted in a few <strong>de</strong>ca<strong>de</strong>s, if, in addition, they do much more than<br />
carrying out power and domination and are also offering permissions, possibilities,<br />
affordances, it means that they are doing politics in a way not anticipated by Langdon<br />
Winner’s seminal article” (Latour 2004, o.S.).<br />
Latours Ausführungen basieren im Wesentlichen auf zwei Argumenten. Er betont<br />
<strong>einer</strong>seits, dass nicht je<strong>de</strong>m Artefakt eine Politik im Sinne von Herrschaft eingeschrieben<br />
ist. Es müsse diesen nicht notwendigerweise ein Unterdrückungsmoment innewohnen.<br />
Vielmehr können Technologien Zugänge und Erlaubnisse, Berechtigungen<br />
und Handlungsauffor<strong>de</strong>rungen bieten. Dazu erinnert Latour an technische Artefakte<br />
wie Wasserkocher, automatische Türschließer, Sicherheitsgurte o<strong>de</strong>r auch in Straßen<br />
eingebaute Rüttelschwellen, welche die FahrerIn eines Autos beispielsweise vor<br />
Schulen auf ihre Fahrgeschwindigkeit aufmerksam machen sollen.<br />
An<strong>de</strong>rerseits weist Latour darauf hin, dass Technologien eine historisch lang<br />
andauern<strong>de</strong> Nutzungsphase haben können. Dies ist ein Aspekt <strong>de</strong>r insbeson<strong>de</strong>re<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Informatik selten berücksichtigt wird, wie beispielsweise das Jahr 2000-<br />
Problem ver<strong>de</strong>utlicht hatte. 92 In <strong>de</strong>r hier vorliegen<strong>de</strong>n Analyse <strong>de</strong>r Politik und <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Artefakten stehen jedoch weniger die technischen Probleme<br />
im Mittelpunkt <strong>de</strong>r Betrachtung, die aufgrund mangeln<strong>de</strong>r Voraussicht Jahre später<br />
auftreten könnten. Vielmehr sind es die sozialen Nutzungszusammenhänge, die sich<br />
historisch (und es ließe sich hinzufügen auch kulturell) stark verschieben können.<br />
Latour wen<strong>de</strong>t sich damit gegen eine Auffassung, die Bettina Heintz in <strong>einer</strong> ihrer<br />
späteren Interpretationen <strong>de</strong>s Winnerschen Aufsatzes auf <strong>de</strong>n Punkt gebracht hatte:<br />
„Die Auslagerung sozialer Strukturen in technische Artefakte be<strong>de</strong>utet, dass sie […]<br />
nicht mehr verän<strong>de</strong>rbar sind. Sie sind so starr und statisch wie das Material, in <strong>de</strong>m sie<br />
verkörpert sind. In unseren technischen Artefakten tragen wir die sozialen Strukturen<br />
<strong>de</strong>r Gesellschaften mit uns herum. Wir können die Regeln <strong>de</strong>s Zusammenlebens<br />
än<strong>de</strong>rn, wir können Gleichberechtigungsgesetze aufstellen und Quotenregelungen<br />
erlassen. Was immer wir an Neuem erschaffen, in unserer materiellen Umwelt bleiben<br />
die alten Strukturen erhalten und zwingen uns unter Umstän<strong>de</strong>n ein Verhalten auf, das<br />
<strong>de</strong>n neuen Regeln wi<strong>de</strong>rspricht“ (Heintz 1994, 14).<br />
Wenn wir dagegen Latours Ausführungen folgen, so ist das Haus, in <strong>de</strong>m er wohnt,<br />
zu Zeiten s<strong>einer</strong> Entstehung als ein Ausdruck von Klassenverhältnissen zu lesen,<br />
während es heute eher als Diskriminierung innerhalb ein und <strong>de</strong>rselben bürgerlichen<br />
Klasse (Universitätsprofessor und Studieren<strong>de</strong>) wirke. Hier betreibt Latour zwar selbst<br />
einen sozialen Ausschluss, in<strong>de</strong>m er ignoriert, dass er seine Klassenposition nicht<br />
notwendigerweise mit allen Studieren<strong>de</strong>n teilt. Nimmt man sein prinzipielles Argument<br />
jedoch trotz<strong>de</strong>m ernst, so lässt sichin Bezug auf die Kategorie Geschlecht weiter<br />
92 Frühe Softwaresysteme aus <strong>de</strong>n 1960er und 70er Jahren verzichteten, um damals teuren Speicherplatz<br />
zu sparen, auf vierstellige Jahreszahlangaben. Aufgrund möglicher Verwechslungen <strong>de</strong>s Jahres 2000 mit<br />
1900 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 1990er Jahren groß angelegte Umstellungen von <strong>de</strong>r Computerindustrie eingeleitet,<br />
um befürchtete Katastrophen durch IT-Ausfälle und -Störungen beim Jahreswechsel 1999/2000 zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
39
<strong>de</strong>nken, dass ein Artefakt gegenwärtig eine starke Geschlechtseinschreibung tragen<br />
kann, während es zu späteren Zeiten in dieser Hinsicht unverfänglich wirkt – o<strong>de</strong>r auch<br />
umgekehrt. Was ehemals als männlich galt, erscheint heutzutage als weiblich. Einen<br />
solchen „Geschlechtswechsel“ hatte beipielsweise das Artefakt Mikrowelle mittels<br />
entsprechen<strong>de</strong>r Marketingstrategien vollzogen (Cockburn/Ormrod 1993). Die strukturell-symbolische<br />
Geschlechterordnung unterliegt wie an<strong>de</strong>re Ungleichheitsverhältnisse<br />
beizeiten starken Wandlungen. Deshalb kann eine Technologie also nicht „an sich“<br />
eine Herrschaftsstruktur in sich tragen. Die Politik eines Artefakts ist ebenso wie<br />
<strong>de</strong>ssen Vergeschlechtlichung stets ist an <strong>de</strong>n jeweiligen historischen, sozialen und<br />
kulturellen Kontext gebun<strong>de</strong>n.<br />
Bis hierher habe ich aus <strong>de</strong>n Debatten um Winners Brückenbeispiel fünf verbreitete,<br />
jedoch verkürzte Lesarten <strong>de</strong>r Einschreibung <strong>de</strong>s Sozialen in technische Artefakte<br />
herausgearbeitet:<br />
1. die Annahme, dass TechnologiegestalterInnen absichtsvoll Ungleichheitsstrukturen<br />
im Artefakt materialisieren (Intentionalität <strong>de</strong>r Einschreibung)<br />
2. die Vorstellung, dass sich die Absichten <strong>de</strong>r EntwicklerIn bzw. KonstrukteurIn direkt<br />
in soziale Wirkungen <strong>de</strong>s Artefakts übersetzen (Übereinstimmung von Gestaltungszielen<br />
und Wirkungen)<br />
3. die Interpretation, dass eine inkorporierte Unterdrückung und Diskriminierung ein<strong>de</strong>utig<br />
sein muss und keine Alternativen zulässt, um als Politik bezeichnet zu<br />
wer<strong>de</strong>n (Zwanghaftigkeit <strong>de</strong>s sozialen Ausschlusses)<br />
4. die Unterstellung, je<strong>de</strong>s technische Artefakt sei politischer Natur (generalisierter<br />
Herrschaftsvorwurf)<br />
5. die Ansicht, dass die Ungleichheitsstruktur geschichtslos und unabhängig vom sozio-kulturellen<br />
Kontext <strong>de</strong>r Nutzung in <strong>de</strong>m Artefakt „an sich“ verankert sei (technologische<br />
Essentialisierung <strong>de</strong>r Ungleichheit).<br />
Die bisherige Diskussion hat gezeigt, dass die Materialisierung von<br />
Ungleichheitsstrukturen in technischen Artefakten in einem differenzierteren Sinne<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n muss, als mit diesen fünf Punkten angenommen wird. Die diesen<br />
Lesarten entggengebrachte Kritik schärft nicht nur <strong>de</strong>n Blick auf die Politik <strong>de</strong>r<br />
Artefakte, son<strong>de</strong>rn zugleich darauf, wie die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte theoretisch fundiert wer<strong>de</strong>n kann. Wenn Geschlecht als eine<br />
Ungleichheitsstruktur verstan<strong>de</strong>n wird, so lässt sich das Ziel <strong>de</strong>s Kapitels nun<br />
präzisieren: es soll eine allgemeine Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
entwickelt wer<strong>de</strong>n, die auf eine feministische Technikgestaltung hinführt und dabei<br />
we<strong>de</strong>r in dieselben Verkürzungen und theoretischen Fallstricke hineinstolpert, in <strong>de</strong>nen<br />
sich Protagonisten wie Winner o<strong>de</strong>r seine Gegenspieler bereits verwickelt hatten, noch<br />
<strong>de</strong>n politischen Charakter von Technologien aus <strong>de</strong>n Augen verliert, auf <strong>de</strong>n Winner<br />
hingewiesen hatte.<br />
Die sozialwissenschaftliche Technikforschung stellt theoretische Ansätze zur<br />
Verfügung, die über die kritisierte verengte Sicht hinausgehen. Sie umfasst damit weitere<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen, die für eine Konzeptualisierung <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte fruchtbar erscheinen. Denn das angestrebte Konzept <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte muss notwendigerweise auch Annahmen<br />
darüber enthalten, was Technologie ist, wie sie entsteht, geformt, angeeignet wird und<br />
40
sich durchsetzt. Es setzt implizit voraus, wie sich das komplexe Zusammenspiel von<br />
Technischem und Sozialem, von Mensch und Maschine <strong>de</strong>nken lässt, enthält Vorstellungen<br />
darüber, wie und unter welchen Prämissen Forschung über Technologien<br />
durchgeführt wer<strong>de</strong>n soll und wie die Ergebnisse wissenschaftlich repräsentiert wer<strong>de</strong>n<br />
sollen, und wer dabei welche Handlungsfähigkeit und Verantwortlichkeit innehat. Eine<br />
theoretische Fundierung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte be<strong>de</strong>utet, sämtliche<br />
dieser Annahmen zu reflektieren und explizit zu machen. Hierzu hat die<br />
sozialwissenschaftliche Technikforschung produktive Vorschläge gemacht, die es auf<br />
die Fragestellung dieses Kapitels zu übertragen gilt.<br />
Im folgen<strong>de</strong>n Kaptiel 3.3. diskutiere ich ontologische und epistemologische<br />
Positionierungen zum Verhältniss von Technik und Gesellschaft sowie zu <strong>de</strong>n Fragen<br />
<strong>de</strong>s Technikverständnisses und <strong>de</strong>r Verantwortung von WissenschaftlerInnen bzw.<br />
TechnikgestalterInnen. Diese Ausführungen wer<strong>de</strong>n entlang von drei Hauptströmungen<br />
sozialwissenschaftlicher Technikforschung entwickelt, <strong>de</strong>n Ansätzen <strong>de</strong>s „Social Shaping<br />
of Technology“, <strong>de</strong>r „Social Construction of Technology“ und <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-<br />
Theorie. Dabei wer<strong>de</strong>n immanente wie feministische Kritiken dieser Ansätze ebenso<br />
diskutiert. Im Anschluß wer<strong>de</strong>n feministischen (Re-)Formulierungen eingeführt und mit<br />
<strong>de</strong>n vorgestellten Debatten gegengelesen, um auf dieser Basis einen theoretischen<br />
Rahmen und ein fundiertes Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte formulieren zu<br />
können.<br />
3.3. Social Shaping of Technology, Social Construction of Technology und<br />
Akteur-Netzwerk-Theorie: Ansätze sozialwissenschaftlicher<br />
Technikforschung<br />
Im Rahmen grundlegen<strong>de</strong>r Ansätze <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung,<br />
die das Verhältnis von Technik und Gesellschaft zu bestimmen versuchen, wird<br />
Winners Position jenem Ansatz zugeordnet, <strong>de</strong>r als „Social Shaping of Technology“<br />
(SST) bezeichnet wird. Denn sein Brückenbeispiel betonte die gesellschaftlich-soziale<br />
Formung und Formbarkeit von Technologie. MacKenzie und Wajcman, die mit <strong>de</strong>r<br />
Herausgabe ihres einschlägigen Sammelbands 1985 diesen Ansatz stark prägten,<br />
fassen unter <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s Sozialen u.a. ökonomische, kulturelle, politische, rechtliche<br />
und organisationsspezifische Faktoren, welche auf die spezifische Ausprägung<br />
technischer Artefakte Einfluss nehmen können. Sie beziehen dabei die Kategorie<br />
Geschlecht explizit mit ein (vgl. MacKenzie/ Wajcman 1999). In<strong>de</strong>m sie innerhalb <strong>de</strong>s<br />
Ban<strong>de</strong>s mehrere Fallstudien veröffentlichen, die <strong>de</strong>r Frage: „[I]s technology shaped by<br />
gen<strong>de</strong>r?“ (ebd., 25) nachgehen, formulieren sie eines <strong>de</strong>r ersten Konzepte <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Technologie.<br />
Der Ansatz <strong>de</strong>s „Social Shaping of Technology“ richtet sich – wie bereits<br />
beschrieben – explizit gegen die Auffassung <strong>de</strong>s technologischen Determinismus und<br />
<strong>de</strong>r Neutralität von Artefakten. Er verstand sich zunächst als ein Korrektiv zu Forschungen,<br />
welche ausschließlich auf die Untersuchung <strong>de</strong>r gesellschaftlichen und sozialen<br />
Auswirkungen <strong>de</strong>r Nutzung von Technologien zielten. McKenzie und Wajcman erklären<br />
rückblickend ihre Motivation, <strong>de</strong>n Rea<strong>de</strong>r 1985 zu veröffentlichen: „Existing discussion<br />
of the intertwining of society and technology was dominated, we felt, by a ‚naive <strong>de</strong>ter-<br />
41
minism‘“ (McKenzie/ Wajcman 1999, xiv). In <strong>de</strong>r grundlegend überarbeiteten Auflage<br />
<strong>de</strong>s Ban<strong>de</strong>s von 1999 betonen sie, dass die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>s „Social Shaping of Technology“<br />
in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung bis zur Neuauflage gut etabliert<br />
habe. Sie führen drei Grün<strong>de</strong> für die erneute Herausgabe <strong>de</strong>s Buches an. Erstens<br />
hätte <strong>de</strong>r Ansatz innerhalb <strong>de</strong>r breiteren Kultur, z.B. in <strong>de</strong>n Massenmedien und <strong>de</strong>r<br />
Politik, wenig Resonanz erfahren. Zweitens reflektiere die ingenieurwissenschaftliche<br />
Lehre kaum die Verwobenheit von Technischem und Sozialem o<strong>de</strong>r die ökonomische,<br />
soziale und ethische Verantwortung von IngenieurInnen. Und drittens drohe <strong>de</strong>r Ansatz<br />
zu einem solchen Allgemeinplatz zu wer<strong>de</strong>n, dass empirische Studien darüber, wie<br />
konkrete Technologien sozial geformt wer<strong>de</strong>n, nicht mehr für notwendig erachtet<br />
wer<strong>de</strong>n. Insbeson<strong>de</strong>re an das zweite und das dritte Argument kann die hier vorgelegte<br />
Arbeit anschließen. Doch ist die Auffor<strong>de</strong>rung zur spezifischen Untersuchung von<br />
Technologien in diesem Zusammenhang wesentlich.<br />
Sämtliche Strömungen <strong>de</strong>r konstruktivistischen sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
teilen die vom SST-Ansatz vorgelegte anti-essentialistische Position. Der Vorwurf<br />
<strong>de</strong>s Technik<strong>de</strong>terminismus scheint in diesem wissenschaftlichen Feld ebenso<br />
schwer zu wiegen wie innerhalb <strong>de</strong>r Geschlechterforschung die Kritik, biologistisch zu<br />
argumentieren und Geschlecht zu essentialisieren. 93 Ein Ansatz zu <strong>einer</strong> feministischen<br />
Technikforschung muss über bei<strong>de</strong> Formen <strong>de</strong>s Determinismus und <strong>de</strong>r Essentialisierung<br />
hinausgehen: „Determinism, whether biological or technical, is a conservative<br />
force tending to preserve existing power relations and disguise the possibility for<br />
social change“ (Cockburn/ Ormrod 1993, 8).<br />
Aus <strong>de</strong>r hier verfolgten Perspektive <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
lässt sich hinzufügen, dass es auch für die Entwicklung eines De-Gen<strong>de</strong>ring-Ansatzes,<br />
<strong>de</strong>r darauf zielt, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte entgegenzuwirken,<br />
notwendig ist, mit <strong>de</strong>r Abwendung von technik<strong>de</strong>terministischen Positionen und <strong>de</strong>r<br />
reinen Wirkungsforschung mitzugehen. Denn erst dann, wenn die Vorstellung überwun<strong>de</strong>n<br />
wird, dass sich technologische Innovationen von internen Charakteristiken <strong>de</strong>r<br />
Technologie ableiten lassen, können informatische Gestaltungsprozesse analytisch<br />
und konstruktiv in <strong>de</strong>n Blick genommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Dem „Social Shaping of Technology“-Ansatz wur<strong>de</strong> innerhalb <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung vielfach unterstellt, technik<strong>de</strong>terministische Positionen<br />
einfach nur radikal umzukehren und zu behaupten, dass Technik zutiefst sozial sei, wie<br />
Graham Button zusammenfasst: „By stressing how technology is shaped by social<br />
forces, such as economics and gen<strong>de</strong>r, an attempt was ma<strong>de</strong> to ground the technical<br />
in the social. Thus, technology was to be thought of through and through as a social<br />
phenomenon“ (Button 1993, 7, zitiert nach Lohan 2000, 899). Auch gegen Winners<br />
Brückenbeispiel wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vorwurf vorgebracht, eine Form <strong>de</strong>s Essentialismus durch<br />
eine an<strong>de</strong>re zu ersetzen, wie Keith Grint und Steve Woolgar anmerken: „This form of<br />
anti-essentialism turns out to be an attempt to supplant technical <strong>de</strong>terminism with<br />
social and political <strong>de</strong>terminism; it is the politics built into a technology which become<br />
the origin of ‚effects’. The object of critique is technological <strong>de</strong>terminism – not<br />
93 Nina Degele betont, dass in <strong>de</strong>r feministischen Forschung ähnliche „Erkenntnisschübe“ stattgefun<strong>de</strong>n<br />
hätten wie in <strong>de</strong>r soziologischen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit Technik. Ähnlichkeiten zeigten sich insbeson<strong>de</strong>re<br />
beim Hinterfragen und Überwin<strong>de</strong>n technischer und biologischer Determinismen (vgl. Degele 2002,<br />
98f).<br />
42
technological <strong>de</strong>terminism. For example, in Winner’s (1980) account, it is the bridge<br />
<strong>de</strong>signer’s politics which prevent blacks having access to Jones Beach, not the mere<br />
fact of the material construction. […] Unfortunately, the political <strong>de</strong>sign critique of<br />
essentialism ends up merely replacing one form of essentialism (that technologies are<br />
actually neutral) with another (that technologies are actually political)” (Grint/ Woolgar<br />
1995, 52f). 94<br />
VertreterInnen <strong>de</strong>s „Social Shaping of Technology“-Ansatzes, etwa David Edge,<br />
verteidigen jedoch die Perspektive, <strong>de</strong>m Sozialen im Verhältnis von Technik und<br />
Gesellschaft <strong>de</strong>n Vorrang zu geben. Denn dieser Zugang be<strong>de</strong>ute nicht, die sozialen<br />
Auswirkungen von Technologien aus <strong>de</strong>m Blick zu verlieren. Er wen<strong>de</strong> sich ausschließlich<br />
gegen die Verkürzungen, die mit <strong>de</strong>r einseitigen Fokussierung <strong>de</strong>r Wirkungsforschung<br />
einhergehen. „Social Shaping of Technology“ grün<strong>de</strong> vielmehr auf <strong>de</strong>r<br />
Annahme, dass sich das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft als Interaktion<br />
und rekursiver Prozess verstehen lässt. ‚Ursachen’ und ‚Wirkungen’ stün<strong>de</strong>n, wie Edge<br />
ausführlich darstellt, in einem komplexen Wechselverhältnis (vgl. Edge 1995 [1988],<br />
14f).<br />
Die Wissenschaftstheoretikerin Mona Singer führt die Kritik an <strong>de</strong>r Einseitigkeit<br />
techniksoziologischer Erklärungsmo<strong>de</strong>lle weiter. Sie weist darauf hin, dass ein solcher<br />
Ansatz in einem sozial<strong>de</strong>terministischen Sinne reduktionistisch ist, sobald Technologien<br />
„so vorgestellt wer<strong>de</strong>n, dass sie wie Marionetten funktionieren, bloß Stellvertreter<br />
und Projektionsflächen sind, <strong>de</strong>rer sich die Gesellschaft bedient. Diese Perspektive<br />
kommt beson<strong>de</strong>rs in Positionen zum Ausdruck, für die Technologien primär ein Fortsetzung<br />
<strong>de</strong>r Politik mit an<strong>de</strong>ren Mitteln und daher zentrale Schauplätze von<br />
Machtkämpfen sind. Die Interessen <strong>de</strong>r Gewinner bestimmen die Produktion, Distribution<br />
und Konsumption und schreiben sich in die Technologien ein. Die Einschreibungen<br />
von Macht und Herrschaft wer<strong>de</strong>n so verstan<strong>de</strong>n, dass sie zwingend auf die Gesellschaft<br />
zurückwirken und in ihrem Einsatz kein Spielraum für differente Decodierung<br />
und Reinterpretation zulassen“ (Singer 2003, 114).<br />
Dieser Einwand warnt davor, die Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Technologie als<br />
eine fixe Festschreibung ungleicher Geschlechterstrukturen zu verstehen. Während<br />
Winner mit <strong>de</strong>n Brücken Moses’ ein Beispiel anführt, dass es schwerlich vorstellbar<br />
macht, die durch sie verkörperte Ungleichheitsstruktur zu umgehen, sobald das Artefakt<br />
in die Landschaft eingebettet ist, plädiert Singer dafür, Spielräume für<br />
unterschiedliche Interpretationen eines Artefaktes durch die NutzerInnen<br />
hervorzuheben, die auch an<strong>de</strong>re Lesarten als die zwanghafte Wie<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>s<br />
eingeschriebenen Sozialen zulassen.<br />
Singers Kritik bezieht sich jedoch nicht allein auf Studien, die <strong>de</strong>m „Social Shaping“-<br />
Ansatz im engeren Sinne zuzuordnen sind, son<strong>de</strong>rn auch auf solche, die aufzeigen,<br />
94 Diese Verschiebung <strong>de</strong>r Argumentation erinnert an frühe feministische Debatten: Wur<strong>de</strong> dort die Unterscheidung<br />
von sozialem und biologischem Geschlecht ehemals eingeführt, um <strong>de</strong>r Annahme, gesellschaftliche<br />
und empirisch vorfindliche Geschlechterunterschie<strong>de</strong> seien auf biologische, „natürliche“ Differenzen<br />
zurückzuführen, entgegenzuwirken, setzten VertreterInnen <strong>de</strong>s „Social Shaping of Technology“-<br />
Ansatzes die Vorstellung <strong>einer</strong> sozial kontrollierten Gestaltbarkeit von Technologie <strong>de</strong>r technik<strong>de</strong>terministischen<br />
Auffassung <strong>einer</strong> Eigenlogik <strong>de</strong>s Technischen entgegen. Bei<strong>de</strong> Ansätze verankerten jedoch – so<br />
die Kritik – das Primat auf Seiten <strong>de</strong>s Subjektes, <strong>de</strong>s Sozialen, <strong>de</strong>r Politik – sei es in Bezug auf das Verhältnis<br />
von Technik und Gesellschaft o<strong>de</strong>r hinsichtlichtlich <strong>de</strong>r Frage, ob sex o<strong>de</strong>r gen<strong>de</strong>r, d.h. das biologische<br />
o<strong>de</strong>r soziale Geschlecht Ursache <strong>de</strong>r hierarchischen Geschlechterordnung sei. Zu diesen<br />
Parallelen vgl. auch Kapitel 2.<br />
43
dass soziale Verhaltensnormen gegen Technologien austauschbar wer<strong>de</strong>n. „Die<br />
Verkehrsampel ersetzt <strong>de</strong>n Polizisten und steht für die Steuerung und Disziplinierung<br />
<strong>de</strong>r VerkehrsteilnehmerInnen. Technische Artefakte sind <strong>de</strong>mnach Stellvertreter bzw.<br />
‚Leutnants‘ – das heißt diejenigen, die einen Ort im Auftrag von jemand an<strong>de</strong>rs halten<br />
‚lieu- tenants‘“ (Singer 2003, 114) zitiert Singer Latours Position. Bekannt ist sein<br />
Beispiel <strong>de</strong>s Berliner Schlüssels (Latour 1996a [1993]). Ausgangspunkt dieses<br />
Beispiels ist das Problem, dass viele HausbesitzerInnen und BewohnerInnen<br />
wünschen, dass die Haustür über Nacht abgeschlossen ist. Die MieterInnen halten sich<br />
jedoch nicht immer an diesen Teil <strong>de</strong>r Hausordnung. Statt nun aufwendige Überwachungen<br />
und teuere Disziplinierungsstrategien einzusetzen (z.B. eine WärterIn anzustellen<br />
und die Nichtbefolgung zu sanktionieren, bis hin zur Kündigung), wur<strong>de</strong> ein<br />
Schlüssel kreiert, <strong>de</strong>r sich nach <strong>de</strong>m Aufschließen nur dann wie<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Tür herausziehen<br />
lässt, wenn diese abgeschlossen wird. Bettina Heintz interpretiert dieses Beispiel<br />
dahingehend, dass dieses Artefakt gewissermaßen die Materialisierung <strong>de</strong>s<br />
Befehls ‚Türe immer abschließen‘ sei und zu s<strong>einer</strong> Befolgung zwinge. „Statt Erziehung<br />
und Disziplinierung – ein technischer Sachzwang.“ (Heintz 1994, 13). Das Technische<br />
wird also auch hier als zutiefst Soziales verstan<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung wur<strong>de</strong>n zwei Konzepte entwickelt,<br />
die das Verhältnis von Technik und Gesellschaft stärker miteinan<strong>de</strong>r verwoben konzipieren:<br />
das sozialkonstruktivistische, in <strong>de</strong>n 1980er Jahren von Bijker, Hughes und<br />
Pinch entwickelte „Social Construction of Technology“ (SCOT) sowie noch stärker die<br />
poststrukturalistisch bzw. semiotisch argumentieren<strong>de</strong> Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT),<br />
zu <strong>de</strong>ren Hauptvertretern Michel Callon, Bruno Latour und John Law zählen. Der<br />
Ansatz <strong>de</strong>r „Social Construction of Technology“ ist von <strong>de</strong>r Wissenssoziologie inspiriert<br />
und betont die „interpretative Flexibilität“ von Technologien, die besagt, dass<br />
Technologien keine inhärente Be<strong>de</strong>utung mit festen Grenzen haben. Unterschiedliche<br />
soziale Gruppen, die für die Gestaltung <strong>einer</strong> Technologie relevant sind, gäben einem<br />
Artefakt verschie<strong>de</strong>ne Be<strong>de</strong>utungen. Dabei <strong>de</strong>finierten sich „sozial relevante Gruppen“<br />
darüber, dass sie eine gemeinsame Interpretation <strong>de</strong>s Artefakts teilten.<br />
Ein klassisches Beispiel, anhand <strong>de</strong>ssen <strong>de</strong>r SCOT-Ansatz eingeführt wur<strong>de</strong>, ist die<br />
Entwicklung <strong>de</strong>s Fahrrad bis zu <strong>de</strong>r Form, in <strong>de</strong>r wir es heutzutage kennen. Ausgehend<br />
vom Hochrad entwickelten Gruppen wie Frauenvereine, sportbegeisterte junge Männer<br />
o<strong>de</strong>r Ingenieure En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts unterschiedliche Visionen, wie dieses<br />
Artefakt zu nutzen sei. An<strong>de</strong>rs ausgedrückt hatten diese Gruppen, die auf die technologische<br />
Entwicklung Einfluss nahmen, unterschiedliche Problem<strong>de</strong>finitionen. Die einen<br />
sahen darin ein alltägliches Fortbewegungsmittel, die an<strong>de</strong>ren ein Sportgerät o<strong>de</strong>r<br />
einen speziellen Hobbygegenstand. Pinch und Bijker (1987) arbeiteten heraus, dass<br />
das gegenwärtige Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Fahrrads sozial ausgehan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Die bis heute<br />
gültige Interpretation <strong>de</strong>s Artefakts entstand durch einen nichtlinearen Aushandlungsprozess<br />
über verschie<strong>de</strong>ne Anfor<strong>de</strong>rungen, die das Fahrrad erfüllen sollte, welche zu<br />
jeweils neuen Varianten <strong>de</strong>s Designs führten. Ein relativ niedriges Fahrrad mit Gummireifen<br />
vermochte zwischen <strong>de</strong>n Ansprüchen an Sportlichkeit und an Sicherheit zu<br />
vermitteln. Bei diesem Mo<strong>de</strong>ll, das sich letztendlich durchsetzen konnte, sah keine <strong>de</strong>r<br />
„sozial relevanten Gruppen“ mehr einen Handlungsbedarf, weitere Verän<strong>de</strong>rungen<br />
vorzunehmen, obwohl dieses nicht die technisch beste Lösung war. Vielmehr seien<br />
alternative Gestaltungsoptionen im Verlauf <strong>de</strong>s Prozesses ausgeschlossen wor<strong>de</strong>n.<br />
44
Den erzielten Konsens über die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Artefakts bezeichnen Pinch und Bijker<br />
als „Schließung“ bzw. „Stabilisierung“ (Pinch/ Bijker 1987, 39f). 95 Sie betonen damit,<br />
dass die Alternativlosigkeit zu einem auf <strong>de</strong>m Markt vorherrschen<strong>de</strong>n Produkt sozial<br />
erzeugt und nicht technisch notwendig ist.<br />
SCOT wen<strong>de</strong>t sich gegen traditionelle technikhistorische Erklärungsmo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>r<br />
Entwicklung von Technologien, die auf <strong>de</strong>r Annahme grün<strong>de</strong>n, dass technische Innovationsprozesse<br />
ausgehend von <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Ent<strong>de</strong>ckung bis hin zur wirtschaftlichen<br />
Umsetzung ein<strong>de</strong>utigen Pfa<strong>de</strong>n folgen, d.h. vorbestimmte Laufbahnen<br />
hätten. „The i<strong>de</strong>a that technologies have natural trajectories is <strong>de</strong>eply built into the way<br />
we talk. Almost as <strong>de</strong>ep is the notion that any individual technology moves through a<br />
natural life cycle: from pure to applied research, it moves to <strong>de</strong>velopment, and then to<br />
production, marketing, and maturity […] recent studies in the social history and sociology<br />
of technology suggest that these mo<strong>de</strong>ls are quite ina<strong>de</strong>quate. […] they are concerned<br />
to show that there is nothing inevitable about the way in which these evolve.<br />
Rather, they are a product of heterogeneous contingency” (Bijker/ Law 1992, 17).<br />
Technologien wer<strong>de</strong>n damit als Produkt <strong>einer</strong> stets an<strong>de</strong>rs gearteten Zufälligkeit vorgestellt,<br />
die es von <strong>de</strong>r Technikforschung im Konkreten zu untersuchen und zu<br />
rekonstruieren gilt. Damit wird zugleich von <strong>de</strong>r Vorstellung abgerückt, dass<br />
Technologien von einzelnen heroischen Erfin<strong>de</strong>rn hervorgebracht wer<strong>de</strong>n („a result of<br />
a momentous act by heroic inventor“, (Bijker 1995, 270)), son<strong>de</strong>rn vielmehr „as a<br />
gradual construction in the social interaction between and in relevant social groups“<br />
(ebd.) verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n müssen. Die Behauptung Winners, dass die Überführungen<br />
zwischen New York und Long Island vor allem aufgrund <strong>de</strong>r Absichten <strong>de</strong>s<br />
Konstrukteurs und Stadtplaners Moses so niedrig gestaltet wur<strong>de</strong>n, ist auf dieser<br />
theoretischen Grundlage nicht möglich.<br />
Zu <strong>de</strong>n Kernbegriffen <strong>de</strong>s „Social Construction of Technology“, welche diesen<br />
Ansatz von an<strong>de</strong>ren sozialkonstruktivistischen, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>m „Social Shaping of<br />
Technology“ unterschei<strong>de</strong>n, gehören die „interpretative Flexibilität“, das Konzept <strong>de</strong>r<br />
„relevanten sozialen Gruppen“ sowie das <strong>de</strong>r „Schließung“. Diese wur<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r<br />
Wissenssoziologie übernommen, um Technikentwicklungsprozesse zu beschreiben. 96<br />
Übernommen wur<strong>de</strong> dabei auch <strong>de</strong>r methodische Zugang, erfolgreiche Technologien<br />
mit <strong>de</strong>nselben Mitteln zu untersuchen wie gescheiterte Projekte, um nicht apriori eine<br />
Überlegenheit o<strong>de</strong>r bessere Angepasstheit <strong>de</strong>r betrachteten Technologie zu unterstellen.<br />
97 SCOT hat sich als produktiv erwiesen um <strong>de</strong>n offenen, kontingenten Charakter<br />
von Technologien zu erklären. Innerhalb <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
sind jedoch zwei wesentliche Kritiken gegen <strong>de</strong>n Ansatz vorgebracht wor<strong>de</strong>n<br />
(vgl. Kline/ Pinch 1996, 767f). Zum einen fokussiert das nützliche Konzept <strong>de</strong>r<br />
interpretativen Flexibilität auf die frühen Phasen <strong>de</strong>s Designs, wobei allerdings angenommen<br />
wird, dass sich die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s technologischen Artefakts im<br />
anschließen<strong>de</strong>n Prozess bis hin zur Nutzung zunehmend stabilisiert. Es wird also nicht<br />
95 Dabei wird die Einigung auf eine Form und Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Artefaktes unter verschie<strong>de</strong>nen Gruppen als<br />
„Schließung“ bezeichnet, die innerhalb <strong>einer</strong> Gruppe als „Stabilisierung“.<br />
96 Bezug genommen wur<strong>de</strong> auf das vor allem von Harry Collins entwickelte „empirische Programm <strong>de</strong>s<br />
Relativismus“ (EPOR). Für einen Überblick vgl. etwa Pinch/ Bijker 1987, 26f, Felt et al. 1995, 128f<br />
97 Dieses Symmetrie-Prinzip geht zurück auf das von David Bloor 1976 für die Soziologie <strong>de</strong>s Wissens<br />
vorgeschlagene so genannte „starke Programm“, nach <strong>de</strong>r das als richtig gelten<strong>de</strong>n Wissen mit <strong>de</strong>n gleichen<br />
Metho<strong>de</strong>n untersucht wer<strong>de</strong>n soll wie <strong>de</strong>r als falsch gelten<strong>de</strong>.<br />
45
hinterfragt, was nach <strong>de</strong>r „Schließung“ geschieht, ob die „Black Box“ 98 dann wie<strong>de</strong>r<br />
geöffnet wer<strong>de</strong>n kann und Neu-Interpretationen, z.B. durch die NutzerInnen <strong>de</strong>r<br />
Technologie, möglich wer<strong>de</strong>n. 99 Zweitens wird die mangeln<strong>de</strong> Analyse von Machtstrukturen<br />
kritisiert - ein Argument, welches sich insbeson<strong>de</strong>re anhand <strong>de</strong>r Frage, welche<br />
sozialen Gruppen von <strong>de</strong>n TechnikforscherInnen für die Technologie als relevant<br />
erachtet wer<strong>de</strong>n, entfalten läßt. Die soziale Ordnung, Hierarchien und Herrschaftsverhältnisse,<br />
in <strong>de</strong>nen Technologien entwickelt wer<strong>de</strong>n, stün<strong>de</strong>n bei SCOT kaum zur<br />
Debatte. Die Untersuchungen basierten we<strong>de</strong>r auf <strong>einer</strong> ethischen Perspektive noch<br />
wür<strong>de</strong>n sie ein politisches Interesse verfolgen. Langdon Winner (1993) behauptet etwa,<br />
dass das Ziel sozialkonstruktivistischer Untersuchungen „to look carefully into the inner<br />
workings of real technologies to see what is actually taking place” (Winner 1993, 364),<br />
fehlschlagen müsse, wenn diese Analysen nicht von einem gesellschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
Standpunkt aus formuliert wür<strong>de</strong>n. Die VertreterInnen <strong>de</strong>s SCOT-Ansatzes wür<strong>de</strong>n<br />
insofern zwar die Black Box <strong>de</strong>r Technik öffnen, sie dann aber letztendlich leer<br />
vorfin<strong>de</strong>n. 100<br />
Geschlechterverhältnisse wur<strong>de</strong>n im Rahmen <strong>de</strong>s SCOT-Ansatzes bereits in <strong>de</strong>r erwähnten<br />
frühen Studie zur Entstehung <strong>de</strong>s Fahrrads als relevante soziale Gruppe<br />
einbezogen, da das Vorgängermo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Hochra<strong>de</strong>s Frauen als NutzerInnen 101 nicht<br />
sicher genug war. Dennoch brachten feministische TechnikforscherInnen Argumente<br />
vor, welche die drei skizzierten Kritiken zuspitzten und konkretisierten. Erstens schließe<br />
<strong>de</strong>r Fokus <strong>de</strong>s SCOT-Ansatzes auf die frühen Phasen <strong>de</strong>s Technik<strong>de</strong>signs Frauen<br />
strukturell von <strong>de</strong>r Analyse aus. Im Mittelpunkt herkömmlicher Studien stün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>shalb<br />
männliche Macher, Gestalter und Interessensgruppen und ihre technischen Fähigkeiten,<br />
während die Nutzungsphasen, in <strong>de</strong>nen Frauen eine Rolle spielen, außer Acht<br />
gelassen wür<strong>de</strong>n. Feministische Technikforscherinnen hatten diese Kritik in <strong>de</strong>n 1990er<br />
Jahren konstruktiv in eine Reihe neuer Studien umgesetzt (vgl. etwa Cockburn/<br />
Fürst-Dilic 1994, Webster 1995, Lie/ Sørensen 1996). Eines <strong>de</strong>r bekanntesten<br />
Beispiele dieser Art ist die Untersuchung <strong>de</strong>s Mikrowellenherds von Cynthia Cockburn<br />
und Susan Ormrod (1993), in <strong>de</strong>r sie die Vergeschlechtlichung dieser Technologie auf<br />
98 „Unlike the inquiries of previous generations of social thinkers, social constructivism provi<strong>de</strong>s no solid,<br />
systematic standpoint or core of moral concerns from which to criticize or oppose any particular patterns of<br />
technical <strong>de</strong>velopment. Neither does it show any <strong>de</strong>sire to move beyond elaborate <strong>de</strong>scriptions, interpretations<br />
and explanations to discuss what ought to be done” (Winner 1993, 374).<br />
99 Dabei bezeichnet <strong>de</strong>r Term „Black Box“ in <strong>de</strong>r konstruktivistischen Technikforschung die Stabilisierung<br />
<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung eines Artefaktes, während für die Ingenieurwissenschaften darunter die Beschreibung<br />
eines Geräts o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> Technologie in Form von Eingaben und Ausgaben verstan<strong>de</strong>n wird und damit das,<br />
was innerhalb <strong>de</strong>r Black Box passiert, als unwichtig gilt.<br />
100 Eine dritte Kritik an SCOT richtet sich – ähnlich <strong>de</strong>n Vorwürfen gegen <strong>de</strong>n Ansatz <strong>de</strong>s „Social Shaping<br />
of Technology“ – gegen das einschränkte Verständnis <strong>de</strong>s reziproken Verhältnisses von Artefakten und<br />
Sozialem. So wür<strong>de</strong> zwar <strong>de</strong>r Einfluss relevanter sozialer Gruppen auf die technologische Entwicklung<br />
untersucht, nicht aber umgekehrt, wie I<strong>de</strong>ntät und soziale Gruppen durch technologische Prozesse gebil<strong>de</strong>t<br />
und aufrechterhalten wer<strong>de</strong>n. Die Frage nach <strong>de</strong>r Konstituierung von Gruppenzugehörigkeit und<br />
I<strong>de</strong>ntität durch Technologie gilt zwar als Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rat in <strong>de</strong>r feministischen Forschung (vgl. etwa<br />
Winker 2005), jedoch stehen diese Prozesse nicht im Fokus <strong>de</strong>r Untersuchungen dieser Arbeit, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung von Technologien liegt.<br />
101 Vgl. hierzu die Kontroverse zwischen Nick Clayton 2002a, 2002b und Wiebe Bijker & Trevor Pinch<br />
2002 in „Technology and Culture“, die auf <strong>de</strong>n Unterschied zwischen tatsächlichen und potentiellen NutzerInnen<br />
hinweist: Dort kritisierte Clayton die bei<strong>de</strong>n Autoren <strong>de</strong>r Fahrradstudie auf <strong>de</strong>r Basis historischer<br />
Daten, dass Frauen zu dieser Zeit nicht Fahrrad gefahren seien und <strong>de</strong>shalb keine relevante soziale<br />
Gruppe darstellen wür<strong>de</strong>n. Pinch und Bijker entgegneten, dass Frauen damals durchaus über das Hochrad<br />
geurteilt, <strong>de</strong>n Wunsch nach Radfahren gehegt und sich die Fahrradingenieure um die Konstruktion<br />
„frauentauglicher“ Fahrradtypen bemüht hätten. Sie seien <strong>de</strong>shalb sehr wohl relevant gewesen.<br />
46
je<strong>de</strong>r Stufe <strong>de</strong>s Lebenszyklus (Konzeption, Entwurf, Produktion, Vertrieb, Marketing,<br />
Werbung, Benutzung und Wartung) aufzeigen. Die Technikforscherinnen arbeiteten<br />
dabei ferner heraus, dass das äußere Design <strong>de</strong>r Mikrowelle im Laufe <strong>de</strong>r Zeit einem<br />
„Geschlechtswechsel“ unterzogen wur<strong>de</strong>. Denn das Artefakt zählte zunächst zu <strong>de</strong>n so<br />
genannten „brown goods“, die vorwiegend in <strong>de</strong>n hoch gewerteten und männlich<br />
konnotierten Entertainment-Bereichen <strong>de</strong>r Elektroabteilungen zu fin<strong>de</strong>n waren. Später<br />
wur<strong>de</strong> es als „white good“ konzipiert, womit es zusammen mit Waschmaschinen und<br />
Kühlschränken in <strong>de</strong>m eher weiblich konnotierten Bereich <strong>de</strong>r Hausarbeit verortet<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>m SCOT-Ansatz legten feministische Technikforscherinnen also<br />
reichhaltige Studien vor, die ein breites Spektrum aufzeigten, auf welchen Ebenen und<br />
in welcher Hinsicht Technologien vergeschlechtlicht sein können. Die insbeson<strong>de</strong>re<br />
von Feministinnen vorgebrachte Kritik an <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Berücksichtigung <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen wur<strong>de</strong> mittlerweile von Vertretern <strong>de</strong>s SCOT-Ansatzes konstruktiv aufgenommen<br />
(vgl. etwa Kline/ Pinch 1996, Bijker/ Bijsterveld 2000). Viele <strong>de</strong>r neueren<br />
Studien <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung stellen NutzerInnen nun in <strong>de</strong>n<br />
Vor<strong>de</strong>rgrund und untersuchen <strong>de</strong>ren Beiträge zur Gestaltung <strong>einer</strong> Technologie (vgl.<br />
etwa Oudshoorn/ Pinch 2003, Rohracher 2005, Rohracher 2006). Darunter fin<strong>de</strong>n<br />
häufig auch Studien Berücksichtigung, welche die Kategorie Geschlecht zum Ausgangspunkt<br />
haben. Eine zu <strong>de</strong>r Mikrowellenstudie vergleichbar umfassen<strong>de</strong> Untersuchung<br />
zum Gen<strong>de</strong>ring von Informationstechnologien liegt bisher jedoch nicht vor.<br />
Die ursprüngliche feministische Kritik, dass SCOT die Geschlechterverhältnisse<br />
ausblen<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>, bezog sich jedoch nicht nur auf <strong>de</strong>n primären Untersuchungsgegenstand<br />
<strong>de</strong>r Entwicklungslabore (im Gegensatz zum Nutzungskontext), son<strong>de</strong>rn<br />
auch auf die Unterbewertung „unqualifizierter“, unsichtbar gemachter Tätigkeiten,<br />
welche häufig gera<strong>de</strong> von Frauen ausgeübt wer<strong>de</strong>n. Dadurch wür<strong>de</strong>n Frauen als<br />
soziale Gruppe und ihre vermeintlich spezifischen Zugänge von <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung nicht berücksichtigt, in Winners provokativen Worten<br />
gelten sie als „irrelevante Gruppe“ (vgl. Winner 1993). Dies hätte zur Folge, dass Geschlecht<br />
in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung nicht als eine grundlegen<strong>de</strong><br />
Strukturkategorie verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>. Das Programm sozialwissenschaftlicher Technikforschung<br />
„seems to imply that as long as women do not appear as important actors or<br />
relevant social group, gen<strong>de</strong>r is not a relevant category“ (Berg/ Lie 1995, 344,<br />
Hervorhebung im Orig.). Feministische ForscherInnen hätten immer wie<strong>de</strong>r neu<br />
herausgearbeitet, dass Geschlechterbeziehungen als soziale Konstruktionen in die<br />
Technikgestaltung einfließen und durch sie erzeugt wer<strong>de</strong>n. SCOT erfasse solche<br />
Konstruktionsleistungen jedoch nicht adäquat, wenn Gen<strong>de</strong>r nur als Frauenthema und<br />
nicht als Strukturkategorie behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>, wie Haraway reklamiert: „The effect of the<br />
missing analysis is to treat race and gen<strong>de</strong>r, at best, as a question of empirical,<br />
preformed beings who are present or absent at the scene of action but are not generically<br />
constituted in the practices choreographed in the new theatres of persuasion.<br />
This is a strange aberration, to say at least, in a community of scholars who play<br />
games of epistemological chicken 102 trying to beat each other in the game of showing<br />
102 Unter <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>s „epistemological chicken“ wur<strong>de</strong> 1992 eine Grundsatz<strong>de</strong>batte zwischen VertreterInnen<br />
<strong>de</strong>r Pariser Schule von ANT (Callon/ Latour 1992) und <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Soziologie <strong>de</strong>s<br />
47
how all entities in technoscience are constituted in the action of knowledge production,<br />
not before the action starts” (Haraway 1997, 29).<br />
Dieses Argument konkretisiert die zweite vorgebrachte Kritik, dass Machtstrukturen<br />
von SCOT nicht ausreichend analysiert wür<strong>de</strong>n. Wenn aber Hierarchie- und Herrschaftsverhältnisse<br />
in Bezug auf die Kategorie Geschlecht in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung nicht reflektiert wer<strong>de</strong>n, wür<strong>de</strong> – wie Judy Wajcman treffend<br />
bemerkt – <strong>de</strong>r SCOT-Ansatz zur sozialen Konstruktion von Technologie als “männliche<br />
Kultur” beitragen, anstatt <strong>de</strong>r tradtionellen strukturell-symbolischen Verknüpfung von<br />
Technik mit Männlichkeit entgegenzuwirken (vgl. Wajcman 1994 [1991]).<br />
Feministische ForscherInnen for<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>shalb ein, die Rolle von Technologien bei<br />
<strong>de</strong>r Herstellung von Männlichkeit bzw. von <strong>de</strong>m binären System <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit<br />
genauer zu untersuchen, d.h. neben <strong>de</strong>m „science and technology in the<br />
making“ auch das „gen<strong>de</strong>r in the making“ <strong>einer</strong> sorgfältigen Analyse zu unterziehen.<br />
Jedoch wirft die Verbindung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Perspektiven prinzipielle Probleme auf. So<br />
konstatieren Maria Lohan und Nina Degele, dass grundlegen<strong>de</strong> Differenzen zwischen<br />
konstruktivistischer und feministischer Technikforschung bestehen, die sie in <strong>de</strong>r<br />
Wissenschaftskultur und im politischen Anspruch begrün<strong>de</strong>t sehen. Der herkömmliche<br />
Konstruktivismus vernachlässige die sozialen Konsequenzen von Technologien und<br />
das Machtungleichgewicht von sozialen Gruppen. Berg und Lie (1995) bezeichneten<br />
ihn <strong>de</strong>shalb als politisch abstinent und inhärent konservativ. Feministische<br />
Technikforschung dagegen operiere mit Konzepten von Macht und Herrschaft, wie<br />
etwa die Studien Cynthia Cockburns vorgeführt hätten. Sie gehe von <strong>einer</strong> Asymmetrie<br />
zwischen <strong>de</strong>n Geschlechtern aus und interessiere sich für die Erklärung ihrer<br />
(technisch vermittelten) Kontinuität statt für technischen Wan<strong>de</strong>l (vgl. Degele 2002,<br />
105; Lohan 2000, 905f).<br />
Feministische Technikforscherinnen, die mit SCOT arbeiten, um empirische Studien<br />
zum Gen<strong>de</strong>ring technischer Artefakte zu erstellen, ignorierten jedoch häufig diesen Wi<strong>de</strong>rspruch.<br />
Um diese Problematik zu umgehen, schlägt Lohan einen “methodischen<br />
Pluralismus” vor: „In contrast to substantive or ontological relativism, structural meanings<br />
may enter the <strong>de</strong>bate, but not in a way in which […] the dice are already loa<strong>de</strong>d.<br />
In this way, structures such as patriarchy are not seen as <strong>de</strong>termining the outset“ (Lohan<br />
2000, 906). Es sei a priori keine spezifische Form <strong>de</strong>r Geschlechterdichotomie<br />
bzw. -hierarchie anzunehmen. Die analytische Kategorie Geschlecht könne so als ein<br />
Ausgangpunkt <strong>de</strong>r Untersuchung dienen, wobei die konkrete Gestalt <strong>de</strong>r Geschlechterdifferenz<br />
eine empirische Frage bliebe. Voraussetzung eines solches Ansatzes sei es,<br />
Geschlecht nicht als feststehend zu begreifen, son<strong>de</strong>rn als Ergebnis eines sozialen<br />
Konstruktionsprozesses, <strong>de</strong>r offen für Verän<strong>de</strong>rung, Variation und Neuverhandlung ist<br />
(vgl. Lohan 2000, 905f).<br />
Ein solcher Zugang entspricht zwar im Wesentlichen <strong>de</strong>n aktuellen Ansätzen <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung. Dennoch bleibt er aus wissenschaftstheoretischer Perspektive<br />
unbefriedigend, solange die Seite <strong>de</strong>r Technologie bzw. <strong>de</strong>s Verhältnisses von Technischem<br />
und Sozialem nicht ebenso als konstruiert angenommen wer<strong>de</strong>n. Das<br />
Konzept <strong>de</strong>r interpretativen Flexibilität und <strong>de</strong>r SCOT-Ansatz im Allgemeinen haben in<br />
wissenschaftlichen Wissens (Collins/ Yearley 1992) <strong>de</strong>r anglo-amerikanischen Tradition geführt, in <strong>de</strong>r<br />
gegensätzliche Auffassungen vornehmlich epistemologisch und ontologisch gewen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n.<br />
48
dieser Hinsicht wesentliche Beiträge geleistet. Allerdings stellen sie – im Gegensatz<br />
zum nachfolgend vorgestellten Ansatz <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie – die Grenzziehung<br />
zwischen Technologie und Gesellschaft nicht ausreichend in Frage. Sie gehen<br />
vielmehr grundsätzlich von zwei mehr o<strong>de</strong>r weniger voneinan<strong>de</strong>r getrennten Sphären<br />
aus. Die Herstellung <strong>de</strong>r Trennung zwischen Technischem und Sozialem sowie die<br />
(möglicherweise wi<strong>de</strong>rständige) Materialität <strong>de</strong>s Artefaktes selbst ist bei SCOT nicht<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r Untersuchung <strong>de</strong>r sozialen Konstruktion von Technologie. Insgesamt<br />
sind ausgehend von <strong>de</strong>m Ansatz <strong>de</strong>r „Social Construction of Technology“ produktive<br />
Fallstudien zum Gen<strong>de</strong>ring von Technologien entstan<strong>de</strong>n und relevante Beiträge zur<br />
Theoriebildung über <strong>de</strong>n Zusammenhang von Technik und Geschlecht geleistet<br />
wor<strong>de</strong>n. Dennoch lässt er grundlegen<strong>de</strong> Fragen, die für dieses Kapitel relevant sind,<br />
weiterhin offen und ungelöst.<br />
Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) ist ein Ansatz, <strong>de</strong>r versucht, die<br />
epistemologischen und ontologischen Einseitigkeiten an<strong>de</strong>rer Erklärungsmo<strong>de</strong>lle<br />
technischen Wan<strong>de</strong>ls und <strong>de</strong>s Verhältnisses von Technik und Gesellschaft zu vermei<strong>de</strong>n.<br />
103 Für die Fragestellung dieses Kapitels, das Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten theoretisch<br />
zu fundieren, lässt sich die Akteur-Netzwerk-Theorie dahingehend würdigen,<br />
dass diese die sozial- und technik<strong>de</strong>terministischen Verkürzungen <strong>de</strong>r Wirkungsforschung,<br />
<strong>de</strong>s „Social Shaping of Technology“ sowie <strong>de</strong>s „Social Construction of<br />
Technology“-Ansatzes zu überwin<strong>de</strong>n sucht. In<strong>de</strong>m bei ANT die Materialität <strong>de</strong>r Dinge<br />
stärker in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund gerückt wird, lässt sie sich als ein post-konstruktivistischer<br />
bzw. „post-sozialer“ Ansatz (vgl. Degele 2002) bezeichnen. Dabei wird die<br />
Wi<strong>de</strong>rständigkeit <strong>de</strong>r Artefakte jedoch nicht einseitig als ‚das Soziale bestimmen<strong>de</strong>r<br />
Faktor’ betrachtet.<br />
ANT will insgesamt we<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Fakten/Artefakten, noch <strong>de</strong>r sozialen Macht o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />
Diskursen <strong>de</strong>n Vorrang geben, d.h. sich nicht auf das Reale/die Dinge, das Soziale<br />
o<strong>de</strong>r Narrative reduzieren lassen. Statt<strong>de</strong>ssen sollen technische Artefakte, Gesellschaft,<br />
Natur und Diskurse als komplexe, heterogene Netzwerke begriffen wer<strong>de</strong>n.<br />
Bruno Latour erläutert dies am Beispiel <strong>de</strong>s Ozonlochs: „Das Ozonloch ist zu sozial<br />
und narrativ, um wirklich Natur zu sein, die Strategie von Firmen und Staatschefs ist zu<br />
sehr angewiesen auf chemische Reaktionen, um allein auf Macht und Interessen<br />
reduziert zu wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Diskurs <strong>de</strong>r Ökosphäre ist zu real und sozial, um ganz in<br />
Be<strong>de</strong>utungseffekten aufzugehen. Ist es unser Fehler, wenn die Netze gleichzeitig real<br />
wie die Natur, erzählt wie <strong>de</strong>r Diskurs, kollektiv wie die Gesellschaft sind?“ (Latour<br />
1998 [1991], 14, Hervorhebung im Orig.) Was für ein Phänomen gilt, das gemeinhin als<br />
Teil <strong>de</strong>r Natur zählt, wird zugleich für das Technische angenommen. Es geht in bei<strong>de</strong>n<br />
Fällen darum, <strong>de</strong>n Fallstricken <strong>de</strong>s naiven Realismus, <strong>de</strong>s Technik- und<br />
103 ANT ist kein einheitlicher Theorieansatz, son<strong>de</strong>rn vereint unterschiedliche Zugriffe, die bestimmte<br />
Grundannahmen teilen. Ich beziehe mich hier primär auf die frühen Ausprägungen von ANT, wie sie von<br />
Bruno Latour und Michel Callon in die Diskussion gebracht wur<strong>de</strong>n. Spätere Reformulierungen, die unter<br />
<strong>de</strong>m Begriff „ANT and after“ verhan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>n (vgl. etwa Law/ Hassard 1999) wer<strong>de</strong>n in diesem Kapitel<br />
nicht genauer vorgestellt. Denn es ist hier nicht das Ziel, Theorieentwicklungen zu rekonstruieren, son<strong>de</strong>rn<br />
die Debatten <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung dafür zu nutzen, ein theoretisch fundiertes<br />
Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu entwickeln. Jene versuchen jene, die Kritiken an <strong>de</strong>n<br />
frühen Versionen zunehmend zu berücksichtigen, insbeson<strong>de</strong>re die Frage <strong>de</strong>r Verantwortlichkeit. Für eine<br />
Diskussion dieser Unterschie<strong>de</strong> aus feministischer Perspektive, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Fokussierung auf<br />
Stabilität/ Instabilität, vgl. etwa Elovaara 2007.<br />
49
Sozial<strong>de</strong>terminismus, aber auch <strong>de</strong>nen <strong>einer</strong> reduktionistischen Auffassung von<br />
Repräsentation, ohne äußere Referenz und ohne SprecherIn zu entkommen. 104<br />
ANT ist aus so genannten Laborstudien <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen (Natur-<br />
)Wissenschaftsforschung hervorgegangen. Dort hatten – allen voraus – Karin Knorr-<br />
Cetina (1984 [1981]) und Bruno Latour (1987) eingefor<strong>de</strong>rt, dass die Konstruktion<br />
naturwissenschaftlichen Wissens an <strong>de</strong>n Ort <strong>de</strong>s Entstehens zurückverfolgt wer<strong>de</strong>n<br />
muss, um die „Fabrikation <strong>de</strong>r Erkenntnis“ (Knorr-Cetina 1994 [1991]) verstehen zu<br />
können. Die Arbeit von NaturwissenschaftlerInnen solle auf <strong>de</strong>r Basis ethnografischer<br />
Metho<strong>de</strong>n untersucht wer<strong>de</strong>n, die auf <strong>de</strong>m Leitsatz „Follow the actors and the action“<br />
grün<strong>de</strong>n. Laborstudien fokussieren damit – soziologisch gesprochen – auf die<br />
Mikroebene <strong>de</strong>r Erzeugung von wissenschaftlichen „Fakten“ bzw. technischen<br />
Artefakten, die in ihren Entstehungsprozessen untersucht wer<strong>de</strong>n sollen. 105 Zugleich<br />
wird von ANT auch die Makroebene in die Analyse einbezogen. Aus bei<strong>de</strong>n Perspektiven<br />
lautet die grundlegen<strong>de</strong> Frage, welche Mechanismen zu <strong>einer</strong> Schließung<br />
wissenschaftlicher Kontroversen o<strong>de</strong>r heterogener Vorstellungen über ein technisches<br />
Artefakt führen. An<strong>de</strong>rs ausgedrückt soll untersucht wer<strong>de</strong>n, wie technowissenschaftliche<br />
Artefakte zum Han<strong>de</strong>ln gebracht wer<strong>de</strong>n. Dabei wird die Möglichkeit <strong>einer</strong><br />
Trennung von Technischem und Sozialem bzw. von Natur und Gesellschaft<br />
grundsätzlich hinterfragt, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Konstruktionsprozess, <strong>de</strong>r diese Bereiche <strong>de</strong>finiert<br />
und als getrennte hervorbringt, herausgearbeitet wird. Grenzziehungen wie die<br />
zwischen Technik und Gesellschaft sind <strong>de</strong>mnach nicht Voraussetzung und<br />
Ausgangspunkt <strong>de</strong>r Analyse, son<strong>de</strong>rn wer<strong>de</strong>n als <strong>de</strong>ren Ergebnis verstan<strong>de</strong>n.<br />
In dieser Hinsicht lassen sich starke Parallelen zur Theoriebildung in <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung i<strong>de</strong>ntifizieren, in <strong>de</strong>r Anfang <strong>de</strong>r 1990er Jahre die Geschlechterdichotomie,<br />
d.h. die dichotome Zweigeschlechtlichkeit „an sich“ in Frage gestellt<br />
wur<strong>de</strong>. So stellte etwa Judith Butler die biologische Unterscheidung in Frauen und<br />
Männer, d.h. „Natur“ als Ergebnis von Diskurs vor (vgl. Butler 1991 [1990]). Gleichzeitig<br />
verwiesen insbeson<strong>de</strong>re Philosoph_innen darauf, dass viele grundlegen<strong>de</strong> Dichotomien<br />
wie Natur-Kultur, Körper-Geist, Gefühl-Vernunft, Passivität-Aktivität auf <strong>einer</strong><br />
symbolischen Ebene zutiefst geschlechtskonnotiert sind (vgl. Gatens 1991, Klinger<br />
1995). Im Zuge <strong>de</strong>r Dekonstruktion solcher „großen Trennungen“, die mit <strong>de</strong>m Trend<br />
zu poststrukturalistischen Theorien in <strong>de</strong>n 1990er Jahren einherging, wur<strong>de</strong> aus<br />
Geschlechterforschungsperspektive versucht, Geschlechtersymbolisierungen subversiv<br />
umzu<strong>de</strong>uten, aber auch Zwischenräume und Alternativen zu Binarität und<br />
Zweigeschlechtlichkeit auszuloten<br />
Im Fokus <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Perspektive stehen dagegen die Gegenüberstellungen<br />
von Natur und Gesellschaft sowie von Mensch und Artefakt. 106 Anstelle von<br />
Dichotomien wer<strong>de</strong>n in ANT Netzwerke analysiert, zu <strong>de</strong>nen so heterogene Elemente<br />
wie physische Materialien (z.B. Bäume, Moleküle o<strong>de</strong>r Brücken), Texte (z.B. Publikatio-<br />
104 Die provokative These, Technologien mit Hilfe <strong>de</strong>r Metapher <strong>de</strong>r „Maschine als Text“ zu begreifen,<br />
hatte Steve Woolgar in die Diskussion in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung gebracht (vgl.<br />
Woolgar 1991b). Latour wen<strong>de</strong>t sich explizit gegen eine solche reduktionistisch-<strong>de</strong>konstruktivistische<br />
Perspektive, die auf Sprachspiele beschränkt ist und Technik letztendlich in Text auflöst (vgl. Latour 1998<br />
[1991], 12).<br />
105 Vgl. hierzu genauer die Ausführungen in Kapitel 5.5.<br />
106 Eine gemeinsame Kritikperspektive von ANT und feministischen Ansätzen ist die erkenntnistheoretische<br />
Unterscheidung in ein aktives Subjekt und ein passives, zu untersuchen<strong>de</strong>s Objekt. Vgl. hierzu die<br />
Ausführungen in Kapitel 3.5.<br />
50
nen), Menschen (ForscherInnen, Regierungen) o<strong>de</strong>r Infrastrukturen und Ökonomien<br />
gehören können. Das methodische Vorgehen besteht darin, die jeweils unterschiedlichen<br />
AkteurInnen in und durch die Netzwerke zu verfolgen. Dabei wird nicht<br />
vorausgesetzt, wo die Grenzlinien zwischen Natur, Technologie und Gesellschaft o<strong>de</strong>r<br />
zwischen Mensch und Maschine genau verlaufen. Vielmehr soll rekonstruiert wer<strong>de</strong>n,<br />
wie <strong>de</strong>ren Zusammenspiel funktioniert und verteilt ist und wie dichotome Trennungen<br />
diskursiv hervorgebracht wer<strong>de</strong>n.<br />
Heike Wiesner (2002) fasst bekannte Studien aus <strong>de</strong>r Wissenschaftsforschung 107<br />
zusammen, anhand <strong>de</strong>rer sie <strong>de</strong>tailliert herausarbeitet, dass Labor- und Netzwerkanalysen<br />
trotz ihres elaborierten Anspruchs häufig auf drei Ebenen „geschlechtsblind“ sind.<br />
Erstens wür<strong>de</strong>n die menschlichen AkteurInnen geschlechtsneutral analysiert. Dies<br />
hätte zur Folge, dass geschlechtsrelevante Aspekte in <strong>de</strong>m beobachteten Produktionsprozess<br />
von Wissen und Artefakten nicht erkannt wer<strong>de</strong>n können. Dazu gehöre beispielsweise<br />
die häufig nachweisbare Ten<strong>de</strong>nz, wissenschaftliche Erfolge von Frauen<br />
bereits in <strong>de</strong>n Laboratorien herunterzuspielen o<strong>de</strong>r gar zu verleugnen, mit entsprechen<strong>de</strong>m<br />
Effekt auf ihre Nennung in Publikationen. Zweitens grenze ein netzwerkanalytischer<br />
Zugriff, <strong>de</strong>r auf die Analysekategorie Geschlecht verzichtet, die Forschungsbeiträge<br />
von Frauen häufig aus, da weibliche Wissenschaftlerinnen seltener in <strong>de</strong>n als<br />
relevant erachteten Netzwerken integriert sind. Wiesner veranschaulicht dies anhand<br />
<strong>de</strong>s von Keller (1995 [1983]) aufgearbeiteten Ent<strong>de</strong>ckungsprozesses <strong>de</strong>r „springen<strong>de</strong>n<br />
Gene“ durch Barbara McClintock, für <strong>de</strong>n sie erst 30 Jahre später <strong>de</strong>n Nobelpreis erhielt.<br />
„[D]er Forschungsverlauf <strong>de</strong>r Arbeiten McClintocks wäre für Latour als Forschungsgegenstand<br />
nicht infrage gekommen bzw. wäre für seinen Netzwerkansatz<br />
irrelevant, da er wenig ‚Science in Action’ beinhaltet, keine Kooperation o<strong>de</strong>r Kontroverse<br />
enthielt, noch <strong>de</strong>r Logik <strong>de</strong>r Anerkennungszyklen folgte. Er dokumentiert dagegen<br />
das immer wie<strong>de</strong>r von Arbeitslosigkeit bedrohte Leben <strong>einer</strong> Naturwissenschaftlerin,<br />
die 30 Jahre lang eine biologische Revolution mit sich herumtrug, für die sich lange<br />
Zeit keine ‚scientific community’ interessierte“ (Wiesner 2002, 145). Eine späte Anerkennung<br />
ihrer Leistungen wie im Fall McClintocks wur<strong>de</strong> Rosalind Franklin, die zusammen<br />
mit <strong>de</strong>n Nobelpreisträgern Crick und Watson an <strong>de</strong>r Entschlüsselung <strong>de</strong>r<br />
DNA-Doppelhelix gearbeitet hatte, nicht zuteil. An ihrem Beispiel zeigt Wiesner einen<br />
dritten Aspekt <strong>de</strong>r Geschlechtsblindheit <strong>de</strong>r Labor- und Netzwerkanalysen auf. Es wür<strong>de</strong><br />
ausschließlich die Kommunikation im Labor, nicht aber <strong>de</strong>ren metaphorischer<br />
Gehalt betrachtet. Wiesner resümiert: „Die Akribie, mit welcher die von mir analysierten<br />
AutorInnen <strong>de</strong>n Konstitutionscharakter wissenschaftlicher Forschungen nachgezeichnet<br />
haben, steht damit im krassen Gegensatz zum Grad <strong>de</strong>r Vernachlässigung <strong>de</strong>r<br />
Kategorie gen<strong>de</strong>r innerhalb dieses Konstitutionsprozesses“ (Wiesner 2002, 181). 108<br />
Insgesamt zeigen Wiesners Studien konkret auf, welchen Beitrag die Geschlechterforschung<br />
leisten kann, um die bereits beim SCOT-Ansatz ausführlich diskutierte mangeln<strong>de</strong><br />
gesellschaftstheoretische Perspektive von ANT in die Netzwerk- und<br />
107 U.a. Knorr-Cetina 1984 [1981] und Latour 1987<br />
108 In ähnlicher Weise argumentiert Gabriele Winker für die techniksoziologische Forschung, allerdings<br />
ohne dass sie konkrete Belege anführt. Geschlechterverhältnisse erhielte dort keine Aufmerksamkeit, da<br />
nur Männer als Entwickler und Projektleiter wahrgenommen wür<strong>de</strong>n. Darüber hinaus fielen Artefakte aus<br />
<strong>de</strong>m techniksoziologischen Fokus, wenn diese nicht als hoch technisiert gelten o<strong>de</strong>r sie diese Zuschreibungen<br />
verlieren wür<strong>de</strong>n und damit nicht mehr so stark mit Männlichkeit verknüpft wären, vgl. Winker<br />
2005, 58.<br />
51
Laborstudien doch noch einzubringen: menschliche AkteurInnen seien vor <strong>de</strong>m Hintergrund<br />
<strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n strukturellen Geschlechterverhältnisse als Frauen und<br />
Männern zu betrachten, es seien spezielle Studien zu <strong>de</strong>n Forschungsbeiträgen von<br />
Frauen durchzuführen sowie die Metaphern, welche die Kommunikation in <strong>de</strong>n Forschungslaboren<br />
durchdringen, aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive zu interpretieren.<br />
Die skizzierten Verkürzungen sind jedoch nicht <strong>de</strong>r einzige Gegenstand <strong>de</strong>r Kritik an<br />
ANT. Häufig entzün<strong>de</strong>n sich die Diskussionen an Latours Konzept <strong>de</strong>r „symmetrischen<br />
Anthropologie“ (Latour 1998 [1991]), welches auf <strong>einer</strong> analytischen Ebene menschlichen<br />
und nicht-menschlichen AkteurInnen <strong>de</strong>nselben Status zuspricht. 109 Dabei wird<br />
die Handlungsmacht nicht <strong>einer</strong> einzelnen (menschlichen) AkteurIn zugeschrieben,<br />
son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n spezifischen Verbindungen innerhalb dieser Netzwerke. Innerhalb <strong>de</strong>r<br />
hybri<strong>de</strong>n Gebil<strong>de</strong> versuchen die AkteurInnen gemeinsame Definitionen und Be<strong>de</strong>utungen<br />
herstellen und die Interessen an<strong>de</strong>rer AkteurInnen in die eigenen zu übersetzen.<br />
Gelingt die Übersetzung, so können bestimmte AkteurInnen an<strong>de</strong>re für die eigenen<br />
Ziele arbeiten lassen.<br />
Diese Grundgedanken von ANT wur<strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>rs umstritten durch eine Fallstudie<br />
Michel Callons vorgeführt, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>m Symmetriekonzept ausgehend Jakobsmuscheln<br />
als Entitäten <strong>de</strong>finierte, mit <strong>de</strong>nen die Fischer auf verschie<strong>de</strong>nen Ebenen ‘verhan<strong>de</strong>ln’<br />
müssten, um sie letztendlich als Beute davontragen zu können. 110 Die Annahme,<br />
dass die Objekte, hier die Jakobsmuscheln, die Fischer anwerben, rief heftige<br />
Kritiken hervor. Einer <strong>de</strong>r Vorwürfe besteht darin, dass ANT <strong>de</strong>n nicht-menschlichen<br />
AkteurInnen, <strong>de</strong>n so genannten Aktanten die Fähigkeit zu intentionalem, zielgerichteten<br />
Han<strong>de</strong>ln unterstellt. 111 Callons Mitstreiter Latour <strong>de</strong>mentierte diese Interpretation<br />
jedoch als ein grundlegen<strong>de</strong>s Missverständnis. Der Begriff <strong>de</strong>s Aktanten sei vielmehr<br />
semiotisch aufzufassen. 112 Ein Aktant rufe lediglich Handlungsaktivität hervor o<strong>de</strong>r ihm<br />
wer<strong>de</strong> Handlungsfähigkeit durch an<strong>de</strong>re zugewiesen. „An actant in ANT is a semiotic<br />
<strong>de</strong>finition that is something that acts or to which is activity granted by others. […] An<br />
actant can literally be anything provi<strong>de</strong>d it is granted to be the source of an action”<br />
(Latour 1996b, 373).<br />
Latour erklärt seine Gedanken über die Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Artefakte anhand<br />
eines plausibler anmuten<strong>de</strong>n Beispiels als Callon. Er fragt für <strong>de</strong>n Fall <strong>de</strong>s Tötens mit<br />
<strong>einer</strong> Schusswaffe: Wer ist die AkteurIn: die SchützIn o<strong>de</strong>r die Waffe? Die materialistische<br />
bzw. objektivistische Antwort sei, dass Feuerwaffen töten. Die Waffe tue selbst<br />
etwas aufgrund ihrer materiellen Bestandteile, die sich nicht auf soziale Eigenschaften<br />
<strong>de</strong>r SchützIn reduzieren lasse. Sie mache aus <strong>de</strong>r unschuldigen BürgerIn eine TäterIn.<br />
Die an<strong>de</strong>re verbreitete, soziologische bzw. subjektivistische Position sei, dass die<br />
Menschen töten und nicht die Waffe. Damit wäre letztere nur ein Werkzeug, ein<br />
Medium, ein ganz neutraler Träger für einen dahinter stehen<strong>de</strong>n menschlichen<br />
109<br />
Die Debatte um die Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Technik ist zugleich für das Konzept <strong>de</strong>r „Hybridobjekte“<br />
relevant, mit <strong>de</strong>m informatische Artefakte in <strong>de</strong>r Einleitung eingeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
110<br />
„If the scallops are to be enrolled, they must first be willing to anchor themselves to the collectors” (Callon<br />
1986, 211, zitiert nach Singer 2005, 133).<br />
111<br />
Vgl. etwa Collins/ Yearley 1992<br />
112<br />
Wiesner verweist jedoch darauf, dass dieser „Schulterschluss zur Semiotik“ neue theoretische Probleme<br />
aufwirft. Denn wenn Dinge als Text verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n und umgekehrt, wer<strong>de</strong> die Unterscheidung zwischen<br />
<strong>de</strong>r Repräsentation <strong>de</strong>r Dinge und <strong>de</strong>n Dingen selbst für obsolet erklärt. Dies setzt zugleich die<br />
Trennung zwischen BeobachterIn und beoachteten Objekt und letztendlich die Trennung von Beschreibung<br />
und Erklärung außer Kraft.<br />
52
Willen. 113 Er selbst dagegen behauptet, dass die AkteurIn we<strong>de</strong>r die Waffe, noch die<br />
BürgerIn ist, son<strong>de</strong>rn eine Hybrid-AkteurIn (Aktant), „eine Bürger-Waffe, ein Waffen-<br />
Bürger“ (Latour 2002 [1999], 218) und begrün<strong>de</strong>t dies folgen<strong>de</strong>rmaßen: „Mit <strong>de</strong>r Waffe<br />
in <strong>de</strong>r Hand bist du jemand an<strong>de</strong>res, und auch die Waffe in <strong>de</strong>iner Hand ist nicht mehr<br />
dieselbe […] Nicht länger han<strong>de</strong>lt es sich um die Waffe-im-Arsenal o<strong>de</strong>r die Waffe-in<strong>de</strong>r-Schubla<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r die Waffe-in-<strong>de</strong>r-Tasche, nein, jetzt ist es die Waffe-in-<strong>de</strong>iner-<br />
Hand, gerichtet auf jeman<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r um sein Leben schreit. Was für das Subjekt gilt, gilt<br />
auch für das Objekt, was für <strong>de</strong>n Schützen, auch für die zielen<strong>de</strong> Waffe. Der gute Bürger<br />
wird zum Schurken, <strong>de</strong>r Gangster zum Killer, <strong>de</strong>r stumme Revolver zum gebrauchten,<br />
das Sportgerät zum Tötungsinstrument. Die Materialisten wie die Soziologen begehen<br />
<strong>de</strong>nselben Fehler: Sie gehen aus von Wesenseinheiten, <strong>de</strong>m Wesen von Subjekten<br />
o<strong>de</strong>r von Objekten“ (ebd.).<br />
We<strong>de</strong>r Menschen noch Waffen töteten, vielmehr entstehe etwas Drittes. In <strong>de</strong>r<br />
Terminologie <strong>de</strong>r ANT fin<strong>de</strong>t hier eine Übersetzung statt, „eine Verschiebung o<strong>de</strong>r<br />
Versetzung, eine Abweichung, Erfindung o<strong>de</strong>r Vermittlung, die Schöpfung <strong>einer</strong><br />
Verbindung, die in dieser Form vorher nicht da war und in einem bestimmten Maße<br />
zwei Elemente o<strong>de</strong>r Agenten modifiziert“ (Latour 1998 [1991], 34). Menschliche wie<br />
nicht-menschliche AkteurInnen können jeweils eigene Absichten (so genannte Handlungsprogramme)<br />
haben – Ingenieure bezeichneten diese auch als Funktionen. In<br />
ihrer Verbindung entstehe jedoch ein neues Ziel. 114 Handlungen seien damit nicht<br />
durch das Vermögen von Menschen bestimmt, son<strong>de</strong>rn durch das Vermögen <strong>einer</strong><br />
Verbindung von Aktanten. Demzufolge sei auch die Verantwortung für eine Handlung<br />
<strong>de</strong>m Aktanten-Netzwerk zuzuschreiben.<br />
Während die Grundi<strong>de</strong>e, dass Han<strong>de</strong>ln und Funktionalität in <strong>de</strong>r heutigen Technowissenschaftskultur<br />
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen AkteurInnen in<br />
komplexer Weise verteilt ist, anhand von Latours Beispiel überzeugend dargelegt ist,<br />
sehen feministische und gesellschaftstheoretisch argumentieren<strong>de</strong> KritikerInnen in <strong>de</strong>r<br />
Verantwortungs- bzw. Machtfrage sowie in <strong>de</strong>r Zuschreibung von Handlungsfähigkeit<br />
an Artefakte ein wesentliches Problem <strong>de</strong>s Latourschen Ansatzes. So plädiert etwa die<br />
feministische Wissenschaftstheoretikerin Mona Singer (2005, 134f) dafür, eine emanzipatorisch<br />
orientierte Epistemologie von <strong>de</strong>r so genannten symmetrischen Anthropologie<br />
<strong>de</strong>zidiert abzugrenzen. Denn diese Sicht, die <strong>de</strong>n Akteurstatus nicht länger an<br />
einen mo<strong>de</strong>rnen Subjektstatus bin<strong>de</strong>t und ein „Parlament <strong>de</strong>r Dinge“ (Latour 2001<br />
[1999]) propagiert, entlasse die Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Subjekte und damit vor allem<br />
ihre Verantwortlichkeit in Netzwerke, in <strong>de</strong>nen niemand mehr zur Rechenschaft gezogen<br />
wer<strong>de</strong>n könne.<br />
Singer verweist dabei auf ein weiteres vielfach angesprochenes Problem, das<br />
speziell durch Latours Gedankenexperiment eines „Parlaments <strong>de</strong>r Dinge“ hervorgerufen<br />
wer<strong>de</strong>. Dort sollen zwar <strong>de</strong>njenigen, die sonst keine Stimme haben, <strong>de</strong>n<br />
Hybri<strong>de</strong>n und nicht-menschlichen Teilen <strong>de</strong>r Netzwerke, Gehör verschafft wer<strong>de</strong>n.<br />
Allerdings stellt sich – Singer zufolge – die Frage, wer für die Objekte wissenschaft-<br />
113 Latour weist darauf hin, dass die National Rifle Association in <strong>de</strong>n USA die soziologische, eher typisch<br />
linke Position vertreten hatte – vermutlich auch <strong>de</strong>shalb, weil er humorvoll auf die Schwierigkeit, einen moralischen<br />
Standpunkt zu beziehen, aufmerksam machen will.<br />
114 Diese Verschiebung hin zu einem ungewissen Ziel wird in <strong>de</strong>r ANT-Terminologie als „Translation“ be-<br />
zeichnet.<br />
53
licher Erkenntnis und technowissenschaftlicher Produktion stellvertretend sprechen<br />
kann, wenn es nicht die Wissenschafterlnnen selbst sind. „[W]ir können uns we<strong>de</strong>r in<br />
die Position <strong>einer</strong> Wasserlilie, <strong>einer</strong> Jakobsmuschel, eines Eisbären, <strong>einer</strong> Onkomaus<br />
o<strong>de</strong>r eines Wurm-Roboters versetzen. Und in diesem Sinne bleiben wir vom<br />
Standpunkt <strong>de</strong>s wissenschaftlichen Klassifizierens, Feststellens und Urteilens letztlich<br />
immer unter uns.“ (Singer 2005, 139).<br />
Trotz dieses grundlegen<strong>de</strong>n Einwands hat die Frage <strong>de</strong>r „Agency“ <strong>de</strong>r Artefakte<br />
mittlerweile umfangreiche Debatten in Gang gesetzt, die insbeson<strong>de</strong>re von aktuellen<br />
Entwicklungen innerhalb <strong>de</strong>r Informatik immer wie<strong>de</strong>r neu angeheizt wer<strong>de</strong>n. Die<br />
Techniksoziologen Werner Rammert und Ingo Schultz-Schaeffer (2002) etwa stellen<br />
die Frage: „Können Maschinen han<strong>de</strong>ln?“ erneut und legen einen Sammelband vor, in<br />
<strong>de</strong>m Handlungsfähigkeit von Informationstechnologie anhand von interaktiven Computerspielen,<br />
Multiagentensystemen und fußballspielen<strong>de</strong>n Robotern diskutiert wird. Die<br />
bei<strong>de</strong>n Herausgeber schlagen darin einen graduell nach Kausalität, Kontingenz und<br />
Intentionalität differenzieren<strong>de</strong>n Handlungsbegriff vor, um die neuen Artefakte empirisch<br />
und soziologisch zu untersuchen und dabei zugleich die Probleme, die <strong>de</strong>r ANT-<br />
Ansatz aufgeworfen hat, umgehen zu können (vgl. Rammert/ Schulz-Schaeffer<br />
2002b). 115<br />
Auch <strong>de</strong>r Soziologin und feministischen Technikforscherin Gabriele Winker (2005)<br />
erscheint die Aufhebung <strong>de</strong>r Grenze zwischen Menschen und Artefakten nachvollziehbar.<br />
Dazu führt sie Beispiele aus <strong>de</strong>m alltäglichen Umgang mit <strong>de</strong>m Internet an. Sowohl<br />
bei <strong>de</strong>r Nutzung wie bei <strong>de</strong>r permanenten Weiterentwicklung informationstechnischer<br />
Suchmaschinen bil<strong>de</strong>ten Mensch, Computer und ein Softwareprogramm wie<br />
Google eine Handlungseinheit. Deutlicher noch wiesen ‚persönliche Agenten’, die im<br />
Auftrag von WissenschaftlerInnen neue Fundstellen im Netz suchen, darauf hin, dass<br />
die Unterschie<strong>de</strong> zur menschlichen Suchtätigkeit nicht mehr klar zu bestimmen seien.<br />
Das gelte vor allem dann, wenn sich diese Programme untereinan<strong>de</strong>r absprechen sowie<br />
mit ihren AuftraggeberInnen kooperieren (vgl. Winker 2005, 58). Insofern sei <strong>de</strong>r<br />
analytische Wert <strong>de</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r Trennung zwischen Mensch und Maschine nicht<br />
zu unterschätzen. Sie ermögliche es erst, unterschiedliche Formen und Gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Mithan<strong>de</strong>lns abhängig von <strong>de</strong>r Situation und <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren menschlichen und nichtmenschlichen<br />
Mitspielen<strong>de</strong>n systematisch und empirisch zu erforschen.<br />
Diese Argumente weisen darauf hin, dass ANT reformuliert wer<strong>de</strong>n muss , um die<br />
Verhältnisse von Mensch und Maschine, insbeson<strong>de</strong>re die Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte zu begreifen. Angesichts technowissenschaftlicher Entwicklungen<br />
erscheint es notwendig, in Fragen <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Artefakte eine<br />
differenzierte Position zu beziehen. Speziell die feministischen Kritiken an ANT warnen<br />
davor, <strong>de</strong>n Ansatz unhinterfragt zu übernehmen. Aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive<br />
ist vielmehr zu überlegen, wie ANT gesellschafts<strong>kritisch</strong> und feministisch<br />
gedacht und reformuliert wer<strong>de</strong>n kann.<br />
In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n drei Kapiteln 3.4.-3.6. wird die bis hierher skizzierte Konzeption<br />
von ANT zunächst mit Hilfe <strong>de</strong>r Ansätze <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n feministischen Theoretikerinnen<br />
Donna Haraway und Karen Barad weiter entwickelt. Dabei stehen Problematiken <strong>de</strong>r<br />
115 Zur verteilten Handlungsfähigkeit in <strong>de</strong>r Robotik vgl. auch Wiesner 2004, zu <strong>de</strong>r von anthropomorphen<br />
Softwareagenten vgl. Krummheuer 2007<br />
54
Macht- und Geschlechterblindheit ebenso im Mittelpunkt wie die <strong>de</strong>r<br />
Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Artefakte und die <strong>de</strong>r Verantwortlichkeit. Anschließend wer<strong>de</strong>n<br />
diese Fortführungen vermittelt durch die Arbeiten <strong>de</strong>r Anthropologin und Technikforscherin<br />
Lucy Suchman auf die Informatik angewen<strong>de</strong>t. Diese Ausführungen liefern<br />
insgesamt einen theoretischen Rahmen, <strong>de</strong>r eine Grundlage für das darauf folgend<br />
vorgestellte Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring infomatischer Artefakte darstellt.<br />
3.4. Fa<strong>de</strong>nspiele: Feministische Ansätze, Technowissenschaften und<br />
Gesellschaftskritik<br />
„Cat’s Cradle is about patterns and knots; the game takes great skill and<br />
can result in some serious surprises. One person can build up a large<br />
repertoire of string figures in a single pair of hands, but the cat’s cradle<br />
figures can be passed back and forth on the hands of several players,<br />
who add new moves in the building of complex patterns.” (Haraway 1997,<br />
268).<br />
Übersetzungen zwischen <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie und <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
wur<strong>de</strong>n erstmals von Donna Haraway (1995f [1994]) produktiv gemacht. Anhand von<br />
Studien zur Primatologie und Verhaltensbiologie sowie zum Immunsystem (Haraway<br />
1989, 1995e [1986], 1995h [1989]) arbeitete sie mit ihrer eigenen Netzwerktheorie, die<br />
sie als Fa<strong>de</strong>nspiel beschreibt, heraus, welchen Einfluss die vorherrschen<strong>de</strong>strukturellsymbolische<br />
Geschlechterordnung, aber auch geschlechter<strong>kritisch</strong>e gesellschaftliche<br />
Strömungen und feministische VertreterInnen innerhalb <strong>de</strong>r Biologie auf das<br />
genommen haben, was als jeweiliges Fachwissen verhan<strong>de</strong>lt wird.<br />
Haraways Denken wur<strong>de</strong> in Auszügen bereits im zweiten Kapitel vorgestellt. Hervorgehoben<br />
wur<strong>de</strong> dabei ihr Versuch, „mo<strong>de</strong>rne“ Dichotomien wie Natur vs. Kultur,<br />
Belebtes vs. Unbelebtes, Organisches vs. Technisches, die häufig stark vergeschlechtlicht<br />
sind, zu überwin<strong>de</strong>n. Dort wur<strong>de</strong> ihr Ansatz im Kontext feministischer Technikkritiken<br />
ge<strong>de</strong>utet, die sich häufig zwischen euphorischer Begrüßung und kulturpessimistischer<br />
Ablehnung bewegten. Hier dagegen stellt sich die Frage, wie sie das Verhältnis<br />
von Mensch und Maschine, von Technik und Gesellschaft konzipiert und was sie über<br />
die bisher beschriebene sozialwissenschaftliche Techniktheorie hinausgehend beitragen<br />
kann, um theoretische Konzeptionen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte zu entwickeln.<br />
In ihren Schriften befasst sich Haraway mit <strong>de</strong>r Frage, wie sich „Natur“ im Zeitalter<br />
<strong>de</strong>r Technowissenschaften fassen lässt. 116 Da sie diese als materiell-semiotisch und<br />
damit letztendlich zugleich als technisch fasst, lassen sich ihre gesellschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
Positionen und ihre Kritikstrategien prinzipiell auf die Informatik übertragen. Für das<br />
Vorhaben, das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte theoretisch zu fundieren, erscheint<br />
vor allem ihre Kritik am „eurozentristischen Anthropozentrismus“ (Haraway 1995g<br />
[1992], 15), am Rationalismus, am Naturalismus und <strong>de</strong>m zugehörigen Humanismus,<br />
die allesamt <strong>de</strong>r Aufklärung und <strong>de</strong>m kapitalistischen Produktionsparadigma verpflich-<br />
116 So trägt etwa ihr erstes bekannt gewor<strong>de</strong>nes Buch <strong>de</strong>n Titel „The Reinvention of Nature“ (1991). Vgl.<br />
dazu auch die Dissertation von Jutta Weber (Weber 2003a), die speziell Naturkonzepte bei Haraway und<br />
in <strong>de</strong>n Technowissenschaften untersucht.<br />
55
tet seien, sinnvoll. 117 In<strong>de</strong>m sie <strong>einer</strong>seits aufzeigt, dass die genannten Ansätze theoretisch<br />
fragwürdig und mit <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n asymmetrischen Geschlechterordnung<br />
eng verbun<strong>de</strong>n sind, und an<strong>de</strong>rseits in ihren Untersuchungen Epistemologie eng mit<br />
Gesellschaftstheorie verbin<strong>de</strong>t, geht sie über die Zugänge <strong>de</strong>r ANT hinaus und gibt<br />
diesen eine politische Wendung.<br />
Haraway teilt viele <strong>de</strong>r Annahmen <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie. 118 Mit <strong>de</strong>m Begriff<br />
<strong>de</strong>r Technoscience setzt sie beispielsweise voraus, dass sich Technologie analytisch<br />
nicht von Gesellschaft, von sozialen, politischen o<strong>de</strong>r ökonomischen Aspekten trennen<br />
lässt. Sie geht davon aus, „dass das, was als menschlich bzw. nicht-menschlich gilt,<br />
nicht per <strong>de</strong>finitionem, son<strong>de</strong>rn nur relational gegeben ist, durch das Engagement in<br />
verorteten, innerweltlichen Begegnungen, wo Grenzen sich herausbil<strong>de</strong>n und Kategorien<br />
sich sedimentieren“ (Haraway 1995f [1994], 141f). Haraway schreibt in ihren<br />
Schriften über Hybri<strong>de</strong>, die Menschliches und Nicht-Menschliches vereinen. Sie nimmt<br />
dabei mancherorts Bezug auf die ANT-Terminologie über AkteurInnen, Agenzien und<br />
Aktanten (vgl. ebd., 141), an<strong>de</strong>rnorts setzt sie <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s „Cyborgs“ ein o<strong>de</strong>r<br />
spricht von „materiell-semiotischen AkteurInnen“.<br />
Während Haraways vielschichtige Figur <strong>de</strong>r Cyborg, die nur in <strong>de</strong>r primären<br />
Deutung für Grenzüberschreitungen zwischen Mensch und Maschine steht, weithin<br />
bekannt ist, erschließt sich ihre spezifische Variante <strong>einer</strong> Netzwerktheorie nicht auf<br />
<strong>de</strong>n ersten Blick. Meines Erachtens am <strong>de</strong>utlichsten formuliert sie diese in ihrem Essay<br />
„The Cat’s Cradle“, in<strong>de</strong>m sie dafür die Metapher <strong>de</strong>s Abnehme- bzw. Fa<strong>de</strong>nspiels<br />
heranzieht. Bei einem solchen Spiel wird üblicherweise ein kreisförmig geschlossener<br />
Fa<strong>de</strong>n um die Finger <strong>einer</strong> Person gelegt, um bestimmte Muster herzustellen. Die MitspielerInnen<br />
haben die Aufgabe, <strong>de</strong>n Fa<strong>de</strong>n so abzunehmen, dass sich komplexe<br />
Überkreuzungen ergeben, ohne das Muster zu zerstören. Dies erfor<strong>de</strong>rt eine gewisse<br />
Kunstfertigkeit und viel Geschick. Das Fa<strong>de</strong>nspiel steht bei Haraway für eine <strong>kritisch</strong>e<br />
Erkenntnisproduktion über die komplexen Zusammenhänge von Technischem,<br />
Mythischem, Textuellem, Politischem, Organischem und Ökonomischem (vgl. Haraway<br />
1995f [1994], 141f). Insofern sei das Abnehmespiel, wie sie betont, letztendlich nichts<br />
an<strong>de</strong>res als eine Metapher für die Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. ebd., 148).<br />
Ihr Mo<strong>de</strong>ll weist dabei einige bemerkenswerte Unterschie<strong>de</strong> zur Latourschen Konzeption<br />
auf. Zum einen ver<strong>de</strong>utlicht es <strong>de</strong>n kollektiven, globalen Charakter von Wissens-<br />
und Technologieproduktion: „Cat’s cradle invites a sense of collective work, of<br />
one person not being able to make all the patterns alone. One does not win a cat’s<br />
cradle; the goal is more interesting and more open-en<strong>de</strong>d than that. It is not always<br />
possible to repeat interesting patterns, and figuring out what happened to result in<br />
117 Dies wur<strong>de</strong> im letzten Kapitel 3.3, wenngleich auf <strong>de</strong>r Grundlage an<strong>de</strong>rer Argumente, dargestellt. Für<br />
eine Untermauerung dieses Aspektes aus <strong>de</strong>r Perspektive feministischer Technikforschung vgl. etwa Saupe<br />
2002, insbeson<strong>de</strong>re 178ff.<br />
118 Die theoretischen Beeinflussungen zwischen Haraway und Latour sind keineswegs als einseitig zu betrachten,<br />
wie Jutta Weber und Heike Wiesner herausgearbeitet haben. Wiesner behauptet mit Verweis auf<br />
Latours frühes Werk „Science in Action“ (1987), in <strong>de</strong>m Begriffe wie „Aktant“ noch eher eine untergeordnete<br />
Rolle spielten, darauf, dass Latour Haraways Grundthesen in seinen ANT-Ansatz ‚übersetzt’, ohne jedoch<br />
auf Haraways Schriften aufmerksam zu machen (Wiesner 2002, 187, Fußnote 525). Auch Weber<br />
führt das asymmetrische Zitationsverhalten an: „Auf ihre seit über 15 Jahren geführte Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit <strong>de</strong>r Theorie Latours reagiert dieser kaum. Selbst in seinem Buch „Wir sind nie mo<strong>de</strong>rn gewesen“<br />
(1991), <strong>de</strong>m das Thema <strong>de</strong>s Hybri<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Cyborg zentral ist, belässt er es bei ein o<strong>de</strong>r zwei lapidaren<br />
Literaturverweisen. Und selbst in Pandora’s Hope, das er Donna Haraway gewidmet hat, taucht sie nicht<br />
essentiell auf bzw. gibt es keine Auseinan<strong>de</strong>rsetzung“ (Weber 1998, 710, Fußnote 2).<br />
56
intriguing patterns is an embodied analytical skill. The game is played around the<br />
worlds and can have consi<strong>de</strong>rable cultural significance. Cat’s cradle is both local and<br />
global, distributed and knotted together” (Haraway 1997, 268).<br />
Zweitens dient ihr das Fa<strong>de</strong>nspiel als Metapher für eine gesellschaftspolitisch-feministische<br />
Analyse. Im Vergleich zu Latour liest Haraway die zur Disposition gestellte<br />
Grenzziehung zwischen Mensch und Maschine stets auf <strong>de</strong>r Folie feministischer, antirassistischer,<br />
multikultureller Theorien, die heute unter <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r „Cultural Studies<br />
of Science and Technology“ 119 zusammengefasst wer<strong>de</strong>n. Denn gera<strong>de</strong> diese<br />
Ansätze hätten „gelehrt, dass es sich nicht von selbst versteht und verstehen sollte,<br />
was als ‚menschlich’ gilt. Dies Prinzip sollte auch auf Maschinen sowie auf nichtmaschinelle,<br />
nicht-menschliche Entitäten im allgemeinen zutreffen“ (Haraway 1995f<br />
[1994], 141f). Wenn also Frauen und an<strong>de</strong>re „inapproriate/d others“ (Min-ha 1986, vgl.<br />
auch Haraway 1995g [1992]) lange Zeit von <strong>de</strong>m ausgeschlossen waren, was als das<br />
Humane <strong>de</strong>finiert wur<strong>de</strong>, gelte es nun zu fragen, welche Aus- und Einschlüsse aktuelle<br />
Grenzziehungen <strong>de</strong>r Technowissenschaften zwischen Mensch und Maschine reproduzieren.<br />
Im Gegensatz zu ANT hat Haraway also die Frage nach <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r Artefakte in<br />
die <strong>de</strong>r hybri<strong>de</strong>n Netzwerke transformiert und sie in ihre Konzeption <strong>de</strong>r Analyse<br />
aktueller Technowissenschaftskultur integriert. Ein wesentlicher Unterschied zu Latours<br />
Netzwerk-Konzeption besteht darin, dass sie <strong>de</strong>n Diskurs bzw. Fa<strong>de</strong>n sozialwissenschaftlicher<br />
Technikforschung mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r „Cultural Studies“ sowie <strong>de</strong>r feministischen<br />
Theorie verknüpft (vgl. ebd., 144ff). In dieser gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Wendung grenzt<br />
sie sich explizit von Latour ab: „Shaped by feminist and left science studies, my own<br />
usage [of the term ‚technoscience] both work with and against Latour’s. In Susan Leigh<br />
Star’s terms, I believe it less epistemological, politically, and emotionally powerful to<br />
see that there are startling hybrids of the human and non-human in technoscience –<br />
although I admit to no small amount of fascination – than to ask for whom and how<br />
these hybrids work” (Haraway 1997, 280).<br />
Während Haraway von strukturellen Machtverhältnissen ausgeht, die soziotechnische<br />
Ausschlüsse produzieren, ignoriere Latour soziale Ungleichheit und Herrschaft.<br />
120 Sie wirft ihm und seinen Kollegen vor, dass sie niemals fragten, „wie die<br />
Praktiken männlicher Vorherrschaft o<strong>de</strong>r vieler an<strong>de</strong>rer Systeme struktureller Ungleichheit<br />
in Arbeitsmaschinen ein- und aus ihnen ausgebaut wer<strong>de</strong>n.[…] Ungeachtet ihrer<br />
außergewöhnlichen Schaffensfreu<strong>de</strong> haben die Vermessungen <strong>de</strong>r meisten Gelehrten<br />
<strong>de</strong>r social studies of science sich nicht auf die fruchtbaren Meeresregionen erstreckt,<br />
wo die weltlichen Praktiken <strong>de</strong>r Ungleichheit ans Ufer bran<strong>de</strong>n, in die Buchten<br />
eindringen und die Maßstäbe <strong>de</strong>r Reproduktion wissenschaftlicher Praxis, Artefakte<br />
und Erkenntnis setzen“ (Haraway 1995g [1992], 190, Fußnote 14). Genau diese<br />
119 Sie selbst bezieht sie sich dabei vor allem auf die britischen Cultural Studies, die u.a. in <strong>de</strong>r Tradition<br />
von Marxismus, Psychoanalyse, Hegemonietheorien und <strong>de</strong>r Kritischen Theorie stehen.<br />
120 Haraway geht hier noch weiter, in<strong>de</strong>m sie Latour unterstellt, er wür<strong>de</strong> durch seinen Forschungsansatz<br />
Machtstrukturen reproduzieren: „Latour wants to follow the action in science-in-the-making. Perversely,<br />
however, the structure of heroic action is only intensified in his project – both in the narrative of science<br />
and in the discourse of the science studies scholar” (Haraway 1997, 34).<br />
57
Bereiche sozialer Ungleichheit und die dort funktionieren<strong>de</strong>n Kompetenzübertragungen<br />
sollten ihres Erachtens Gegenstand verschärfter Aufmerksamkeit sein. 121<br />
Haraways Ansatz lässt sich – wie Angelika Saupe hervorhebt – insgesamt als eine<br />
Form <strong>de</strong>r Kritik lesen, „die sich explizit um eine gesellschaftspolitische Techniktheorie<br />
bemüht und einen umfassen<strong>de</strong>n Versuch <strong>de</strong>r gesellschaftstheoretischen Bestimmung<br />
<strong>de</strong>s Verhältnisses von Technik und Geschlecht anvisiert“ (Saupe 2002, 168). Obwohl<br />
dies von Haraway selbst nicht unmittelbar so formuliert wird, bietet gera<strong>de</strong> diese Ausrichtung,<br />
die auf <strong>de</strong>n Perspektiven <strong>de</strong>r feministischen Theorie, <strong>de</strong>r Cultural Studies und<br />
<strong>de</strong>r Science and Technology Studies beruht, direkten Anschluss an das Anliegen dieses<br />
Kapitels. Die Frage, wie Ungleichheitsstrukturen, insbeson<strong>de</strong>re auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r<br />
Kategorie Geschlecht, in die Technowissenschaften eingebaut sind, ist bei Haraway<br />
zentral.<br />
Haraways Ansatz versteht sich jedoch nicht allein als ein analytischer, son<strong>de</strong>rn zugleich<br />
als Vorschlag, „wie wir Schlüsseldiskurse über Technowissenschaft neu gestalten<br />
– verwen<strong>de</strong>n und verknoten – können.“ (Haraway 1995f [1994], 137). Damit wird<br />
eine Vision gesellschaftspolitischer Verän<strong>de</strong>rung angesprochen. Angesichts technowissenschaftlich<br />
konstituierter Lebenswelten, die durch die Komplexe <strong>de</strong>s Militärs, <strong>de</strong>r<br />
globalen Ökonomie, <strong>de</strong>r Umwelt und <strong>de</strong>r Medien gezeichnet sind (vgl. Haraway 1996,<br />
348f), plädiert Haraway für eine Gestaltung von „lebbaren Welten“, sei es in Bezug auf<br />
Natur o<strong>de</strong>r Technologie: „Mein kategorischer Imperativ lautet: alles, was als Natur gilt,<br />
zu verqueeren/ zu verkehren, spezifische normalisierte Kategorien zu durchkreuzen,<br />
nicht um <strong>de</strong>s leichten Schau<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r Überschreitung willen, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Hoffnung<br />
auf lebbare Welten“ (Haraway 1995f [1994], 137). Es geht ihr explizit darum, „die Welt<br />
zu verän<strong>de</strong>rn, eine Wahl zu treffen zwischen verschie<strong>de</strong>nen Lebensweisen und<br />
Weltauffassungen. Um dies zu tun, muss man han<strong>de</strong>ln, begrenzt sein, nicht<br />
transzen<strong>de</strong>nt und sauber. Wissensproduzieren<strong>de</strong> Technologien, einschließlich <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llierung von Subjektpositionen und <strong>de</strong>r Wege <strong>de</strong>r Besetzung solcher Positionen,<br />
müssen immer wie<strong>de</strong>r sichtbar und offen für <strong>kritisch</strong>e Eingriffe gemacht wer<strong>de</strong>n“<br />
(Haraway 1996, 362).<br />
Saupe bezeichnet Haraways gesellschaftspolitische Technikkritik insgesamt als ein<br />
„Projekt <strong>de</strong>r Neugestaltung“ (Saupe 1998, 178f), welches darauf zielt, die „‚Objekte <strong>de</strong>s<br />
Hyperproduktionismus, 122 <strong>de</strong>r politischen Visionen und auch <strong>de</strong>r wissenschaftlichen<br />
Kategorien“ (ebd.) umzuformen. Im Gegensatz zu Latour und seinen Kollegen, die in<br />
121 Eine Erklärung, warum ihre Kollegen sich von gesellschaftspolitischen Problematiken so übertrieben<br />
abgrenzten, liefert Haraway an dieser Stelle gleich mit. Sie neigten „dazu, solche Fragen mit <strong>de</strong>r Versicherung<br />
abzutun, sie wür<strong>de</strong>n in die schlechten alten Zeiten zurückführen, in <strong>de</strong>nen Radikale behaupteten,<br />
die Wissenschaft [und Technik, C.B.] wür<strong>de</strong> gesellschaftliche Beziehungen einfach ‚wi<strong>de</strong>rspiegeln’“ (Haraway<br />
1995g [1992], 190, Fußnote 14). Die Abgrenzung richtet sich also gegen einen latenten Humanismus<br />
und Sozial<strong>de</strong>terminismus wie er am Anfang dieses Kapitels diskutiert wur<strong>de</strong>. Haraway kritisiert, dass ANT-<br />
Vertreter in <strong>de</strong>m Versuch, sozial<strong>de</strong>terministische Techniktheorien zu überwin<strong>de</strong>n, ein „unhinterfragtes,<br />
konsistentes und <strong>de</strong>fensives Vorurteil“ (ebd.) entwickelt hätten, das zu erstaunlichen Fehl<strong>de</strong>utungen einzelner<br />
feministischer Forscherinnen und <strong>de</strong>m blin<strong>de</strong>n Fleck geführt habe, dass feministische Forschungen<br />
nicht wahrgenommen wür<strong>de</strong>n.<br />
122 Haraway beschreibt <strong>de</strong>n „Hyperproduktionismus“ als „beson<strong>de</strong>re Art eines gewaltsamen und reduktiven<br />
Artefaktizismus“ (Haraway 1995g [1992], 15). Sie hält diesen für eine gefährliche Strategie, <strong>de</strong>nn diese<br />
Position lehne die geistreiche Täterschaft aller AkteurInnnen mit Ausnahme <strong>de</strong>s Einen ab. „Das Produktionsparadigma<br />
und seine logische Folge, <strong>de</strong>r Humanismus, lassen sich in einem Satz zusammenfassen:<br />
‚Der Mensch schafft alles, einschließlich s<strong>einer</strong> selbst, aus <strong>de</strong>r Welt heraus, die lediglich Ressource und<br />
Potential für sein Projekt und sein aktives Han<strong>de</strong>ln sein kann.’ Diese Produktionsparadigma han<strong>de</strong>lt vom<br />
Menschen als Werkzeugmacher und -benutzer, <strong>de</strong>ssen höchste technische Produktion er selbst darstellt“<br />
(Haraway 1995g [1992], 16).<br />
58
ihren Schriften auf <strong>de</strong>r analytischen Ebene verbleiben und „rigorosen Wi<strong>de</strong>rstand<br />
gegen das Aufstellen starker Wissensbehauptungen“ (Haraway 1996, 362) leisten,<br />
bietet sie mit ihrer For<strong>de</strong>rung nach „lebbaren Welten“ gleichzeitig Anschlussmöglichkeiten<br />
für das hier verfolgte Anliegen <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte in <strong>de</strong>r<br />
Technikgestaltung. Während sich an<strong>de</strong>re Zugänge gegen normative Setzungen<br />
verwehren, tritt Haraway ein<strong>de</strong>utig für eine feministische Positionierung ein.<br />
Dennoch ist hier sorgfältig zu klären, inwieweit Haraways Zugang über eine grundlegen<strong>de</strong><br />
theoretische Rahmung hinausgehend für die Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte hilfreich sein kann. Das be<strong>de</strong>utet, differenzierter<br />
herauszuarbeiten, welche Form <strong>de</strong>r Gesellschaftskritik sie vertritt, welche Strategien<br />
<strong>de</strong>r Neugestaltung sie vorschlägt, auf welche Bereiche bzw. Dimensionen sie diese<br />
bezieht und wie sie jene konkret in ihrem Werk umsetzt. Dazu möchte ich feministische<br />
Rezeptionen, insbeson<strong>de</strong>re die <strong>de</strong>utschsprachige, heranziehen, in <strong>de</strong>nen Haraways<br />
Politikverständnis äußerst umstritten scheint, und <strong>kritisch</strong>e Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen mit<br />
ihren Thesen ausführlicher diskutieren. Während beispielsweise Saupe Haraways<br />
Ansatz als eine „Politik <strong>de</strong>r Dekonstruktion technologischer Rationalität“ (vgl. Saupe<br />
2002, 202ff) würdigt, <strong>de</strong>r auf einzigartige Weise Theoriebildung über die Technoscience<br />
mit <strong>einer</strong> politischen Positionierung verbin<strong>de</strong>, kritisieren an<strong>de</strong>re Geschlechterforscherinnen<br />
Wi<strong>de</strong>rsprüche und Leerstellen in ihren gesellschafts- und geschlechtertheoretischen<br />
Grundlagen. Singer wirft Haraway vor, dass sie mit wi<strong>de</strong>rsprüchlichen<br />
Begründungen für eine feministische Kritik arbeite: „Einerseits referiert sie immer wie<strong>de</strong>r<br />
auf Frauen und Geschlechterverhältnisse, an<strong>de</strong>rerseits aber auf ein Verständnis<br />
von Allianzen, das gera<strong>de</strong> diese sozialen und i<strong>de</strong>ntitären Zurechnungen wie<strong>de</strong>rum in<br />
Frage stellt. Einerseits stellte sie epistemologisch und wissenschafts<strong>kritisch</strong> <strong>de</strong>n besseren<br />
Blick von unten, Verantwortung und die Frage nach ‚cui bono’ in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund,<br />
an<strong>de</strong>rerseits aber gäbe es im Lichte <strong>de</strong>r ‚imperialisieren<strong>de</strong>n, totalisieren<strong>de</strong>n, revolutionären<br />
Subjekte vorausgegangener Marxismen und Feminismen’ keine Rückkehr mehr<br />
zu Konzepten eines wi<strong>de</strong>rständigen Kollektivsubjekts“ (Singer 2005, 207). Es bleibe im<br />
Dunkeln, wie die Bestimmung <strong>de</strong>r Marginalisierung erfolgen kann, ohne auf Analysen<br />
struktureller Ungleichheit Bezug zu nehmen und <strong>de</strong>n Blick von unten in einem spezifischen<br />
gesellschaftlichen Kontext zu verorten. 123 Genau diese Unklarheit gehört jedoch<br />
zu Haraways Programm. Sie setzt sich für partiale Perspektiven, Situierung,<br />
Mehr<strong>de</strong>utigkeit und vor allem bewegliche Positionierungen ein (vgl. Haraway 1995d<br />
[1988]).<br />
Vertreterinnen <strong>de</strong>r Hannoveraner Schule, genauer die feministischen Theoretikerinnen<br />
Regina Becker-Schmidt (1998), Gudrun-Axeli Knapp (1998) und Carmen Gransee<br />
(1998, 1999), beanstan<strong>de</strong>n weitere Elemente von Haraways Ansatz, wobei sie von <strong>de</strong>r<br />
für die Kritische Theorie paradigmatischen Kritik am instrumentellen Naturumgang<br />
ausgehen. 124 Zentral ist dabei <strong>de</strong>r Vorwurf <strong>einer</strong> fehlen<strong>de</strong>n Vermittlung <strong>de</strong>r Erkenntnistheorie<br />
mit Gesellschaftstheorie, d.h. <strong>einer</strong> mangeln<strong>de</strong>n Rückbindung ihres epistemologischen<br />
Mo<strong>de</strong>lls an eine ausgearbeitete Vorstellung gesellschaftlicher Machtverhältnisse,<br />
in <strong>de</strong>r Wissenschaft eingebettet ist (vgl. Knapp 2000, 102, Hervorhebung von<br />
123 Dies wer<strong>de</strong> insbeson<strong>de</strong>re am Beispiel von „women of color“ bzw. die <strong>einer</strong> Chicana-I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>utlich.<br />
Marginalisiertheit dieser Gruppen sei, wie VertreterInnen diese selbst formulierten, kein ausreichen<strong>de</strong>r<br />
Grund für ein feministisches Projekt.<br />
124 Für eine ausführliche Diskussion dieser Vorwürfe vgl. Saupe 2002, 228-246<br />
59
mir). Singer verteidigt Haraway gegenüber dieser Kritik jedoch entschie<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m sie<br />
konstatiert, dass die bis dato mangeln<strong>de</strong> Ausarbeitung nicht Haraway zum Vorwurf gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n könne, son<strong>de</strong>rn ein generelles Problem und ein Ausdruck <strong>de</strong>r Krise<br />
gegenwärtiger Gesellschaftskritik sei (vgl. Singer 2005, 208).<br />
Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Saupe, in<strong>de</strong>m sie vorschlägt, die Analyse<br />
<strong>de</strong>r Struktur <strong>de</strong>r Kapitalverhältnisse im Zuge Haraways gesellschaftspolitischer Technikkritik<br />
auszubauen (vgl. Saupe 2002, 245). Dabei setzt sie sich differenziert mit <strong>de</strong>n<br />
Argumentationslinien <strong>de</strong>r drei Autorinnen auseinan<strong>de</strong>r, um die Annahmen, auf <strong>de</strong>nen<br />
die Kritik <strong>einer</strong> mangeln<strong>de</strong>n gesellschaftstheoretischen Orientierung in Haraways<br />
Denken basiert, sorgfältig herauszuarbeiten. Insbeson<strong>de</strong>re Becker-Schmidts Kritik<br />
grün<strong>de</strong> etwa implizit darauf, dass Haraway keine historischen, sozialstrukturellen und<br />
empirischen Analysen vorzuweisen habe. Ausgehend von dieser Erkenntnis interpretiert<br />
Saupe die Auseinan<strong>de</strong>rsetzung als einen „Schulenstreit“, <strong>de</strong>r auf die Abwehr<br />
poststrukturalistischer Perspektiven zielt (vgl. Saupe 2002, 238f). Becker-Schmidt halte<br />
an einem Verständnis von Technik als eindimensionaler technologischer Naturaneignung<br />
fest, das eher traditionelle androzentrische Herrschafts- und Hegemonieprinzipien<br />
reproduziere als zu <strong>de</strong>ren Abschaffung beizutragen. Auf dieser Basis ziehe<br />
Becker-Schmidt die von Haraway immer wie<strong>de</strong>r stark gemachten Gestaltungsmöglichkeiten<br />
grundsätzlich in Zweifel. 125<br />
Dass Haraway technowissenschaftliche Entwicklungen zu un<strong>kritisch</strong> begrüßen<br />
wür<strong>de</strong> und zu euphorisch auf <strong>de</strong>ren Verän<strong>de</strong>rungspotential setze, ist ihr häufig<br />
vorgeworfen wor<strong>de</strong>n. Dazu scheint insbeson<strong>de</strong>re die Rezeption ihrer Schriften<br />
innerhalb <strong>de</strong>r cyberfeministischen Bewegung <strong>de</strong>r 1990er Jahre einen großen Teil<br />
beigetragen zu haben (vgl. etwa Soufoulis 2002, Adam 1997). Diese Position setzt sich<br />
bis heute und sogar in die Veröffentlichungen <strong>de</strong>r feministischen sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung fort. So rückt etwa die renommierte Techniksoziologin Judy<br />
Wajcman die Cyborgfigur in die Nähe jener Hoffnungen auf eine neue soziale<br />
Ordnung, die bereits mit vorangegangen Technologien wie <strong>de</strong>m Telefon o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Elektrizität verbun<strong>de</strong>n waren. „The narrative of technology re<strong>de</strong>fining reality is, after all,<br />
a powerful one with a long lineage. […] One is reluctant to suggest that such an astute<br />
science studies critic has fallen prey to technological <strong>de</strong>terminism, but the cyborg<br />
prescription for progressive politics does place enormous weight on technoscience as a<br />
motor of women’s liberation” (Wajcman 2004, 99). Während die Gesellschaftstheoretikerinnen<br />
<strong>de</strong>r Hannoveraner Schule Haraway eine mangeln<strong>de</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>e<br />
Fundierung kritisieren, wird von Seiten <strong>de</strong>r Technikforschung <strong>de</strong>r Vorwurf <strong>de</strong>s technologischen<br />
Determinismus in <strong>einer</strong> neuen Form vorgebracht: Neue technowissenschaftliche<br />
Artefakte könnten nicht naiv als Motor gesellschaftlicher und geschlechterpolitischer<br />
Verän<strong>de</strong>rungsprozesse verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Auch wenn diese Lesart eher<br />
als ein Missverständnis von Haraways Schriften verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n muss, wie<br />
125 Saupe versteht Becker-Schmidts Intervention vor <strong>de</strong>m Hintergrund ihrer eigenen These <strong>de</strong>r Verlebendigung<br />
von Technik als Rettungsversuch eines weiblichen Lebendigen: „Bei aller richtigen Absicht, androzentrische<br />
Überheblichkeitsmuster zu entlarven, scheint Becker-Schmidt selbst <strong>de</strong>m Dualismus (und Mythos)<br />
eines weiblich interpretierten „Lebendigen“, welches seinem Gegenteil als männlich repräsentierten<br />
„Technischen“ konträr gegenübersteht, nicht gänzlich zu entkommen. Genau in dieser Reproduktion <strong>de</strong>r<br />
altbekannten Dichotomie von „Leben“ und „Technik“, die sich immer wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r (Voraus-)Setzung <strong>einer</strong><br />
als unhintergehbar verorteten Rationalität verirrt, liegt jedoch m.E. die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Falle. Und genau<br />
diese ist es auch, die Haraway mit ihrer (undogmatischen) Strategie konsequent vermei<strong>de</strong>t“ (Saupe 2002,<br />
241).<br />
60
nachfolgend gezeigt wird, <strong>de</strong>utet <strong>de</strong>r Vorwurf auf ein Argument, mit <strong>de</strong>m sich das in<br />
dieser Arbeit verfolgte Anliegen, ein De-Gen<strong>de</strong>ring durch entsprechend geeignete<br />
Technikgestaltungsmetho<strong>de</strong>n zu erreichen, grundlegend auseinan<strong>de</strong>rsetzen sollte. Es<br />
warnt vor <strong>einer</strong> Sichtweise, Technologien unabhängig von <strong>de</strong>ren gesellschaftlicher<br />
Einbettung und Nutzung als „geschlechter<strong>kritisch</strong>“ o<strong>de</strong>r „emanzipatorisch“ konstruieren<br />
zu können. 126<br />
Haraway ist eine <strong>de</strong>rartig utopische Interpretation ihrer Thesen jedoch nicht<br />
notwendigerweise selbst anzulasten, da sie komplexer argumentiert und neben ihrem<br />
Verweis auf emanzipatorische Potentiale stets auf strukturelle Kontinuitäten von Macht<br />
und Herrschaft in <strong>de</strong>r und durch die Technoscience hingewiesen hat. Im Text<br />
„Anspruchsloser_Zeuge@Zweites_Jahrtausend“ beispielsweise weist sie explizit auf<br />
die „Apparate <strong>de</strong>r kulturellen Produktion“ hin, die im Schoße <strong>de</strong>r Technoscience herangereift<br />
seien: Militär, globale Ökonomie, Umwelt und Medien (vgl. Haraway 1997, 12f),<br />
<strong>de</strong>ren „illegitime Nachkommen“ Cyborgs seien. Dabei wen<strong>de</strong>t sie sich explizit gegen<br />
eine technikeuphorische Deutung, zugleich aber auch gegen kulturpessimistische<br />
Positionen: „Dieser Aufsatz, wie mein ganzes Schreiben, ist viel eher besorgt als<br />
optimistisch. Dennoch könnte es von Vorteil sein zu lernen, unseren Ängsten vor <strong>de</strong>m<br />
Unheil und <strong>de</strong>r Gewissheit, daß es kommen wird, ebenso wie unseren Träumen zu<br />
mißtrauen“ (Haraway 1996, 368f).<br />
Nicht<strong>de</strong>stotrotz <strong>de</strong>utet das verbreitete Missverständnis, das <strong>de</strong>r euphorischen<br />
Rezeption von Haraways Werk zugrun<strong>de</strong> liegt, womöglich auf eine Leerstelle in ihren<br />
politischen Handlungsstrategien hin. Denn es stellt sich die Frage, welche Konzepte<br />
sie vorschlägt, um <strong>de</strong>n angestrebten alternativen Ort lebbarer Welten erreichen und<br />
auch gestalten zu können. Haraway ruft zwar Feministinnen in ihrem Cyborg-Manifest<br />
dazu auf, Verantwortung bei <strong>de</strong>r Neukonstruktion <strong>de</strong>stabilisierter Grenzen zu<br />
übernehmen (vgl. Haraway 1995c [1985], 35ff) und plädiert insofern für eine feministisch-<strong>kritisch</strong>e<br />
Einmischung in die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie.<br />
Jedoch beschränkt sie sich in <strong>de</strong>r Praxis primär auf die Strategie <strong>de</strong>s Geschichten-<br />
Erzählens, die sie <strong>einer</strong>seits <strong>de</strong>r Verfestigung gesellschaftlicher Strukturen, an<strong>de</strong>rseits<br />
<strong>de</strong>r begrüßen<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r ablehnen<strong>de</strong>n Vorverurteilung von Technologien entgegensetzt.<br />
„Es gibt keinen Ausweg aus <strong>de</strong>n Geschichten, aber es gibt viele Möglichkeiten, eine<br />
Erzählung zu gestalten […] Deshalb besteht die Arbeit vor allem darin, die Geschichten<br />
zu än<strong>de</strong>rn“ (Haraway 1996, 369). Deutlicher noch wird dieser Vorschlag anhand ihrer<br />
Motivation: „Wie könnten bewohnbare Narrationen über Wissenschaft und Natur<br />
erzählt wer<strong>de</strong>n, ohne die Zerstörungen zu leugnen, die aus <strong>de</strong>r Bindung von Technowissenschaft<br />
an militarisierte und strukturell ungerechte Verhältnisse von Wissenschaft<br />
und Macht entsprungen sind, und ohne die apokalyptischen Geschichten von Gut und<br />
Böse, die auf <strong>de</strong>n Bühnen von ‚Natur’ und ‚Wissenschaft’ gespielt wur<strong>de</strong>n, spiegelbildlich<br />
zu wie<strong>de</strong>rholen“ (Haraway 1995g [1992]), 93)? Alternative Geschichten über die<br />
Funktionsweise <strong>de</strong>r Technoscience sollen kein unvernünftiges Gegenmo<strong>de</strong>ll zur<br />
rationalistischen Wissenschaft und zu Technologien darstellen, son<strong>de</strong>rn die<br />
analytischen Wissenschaften verän<strong>de</strong>rn und Um<strong>de</strong>utungen provozieren (vgl. dazu<br />
Saupe 1998, 181). In diesem Sinne setzt Haraway – wie Weber herausstellt –<br />
vornehmlich auf eine aktive Erkenntnispolitik. Sie „versucht ihre politischen Intentionen,<br />
126 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Schlusskapitel 6.<br />
61
ihre Visionen und Utopien in Form von ironischen und reflektierten Erzählstrategien zu<br />
ver<strong>de</strong>utlichen, um einen Spielraum für eine öffentliche Diskussion über Natur, über<br />
das, was als Körper und Maschine gilt, zu eröffnen. Sie versteht Wissenschaftskritik<br />
und Erkenntnispolitik vor allem als <strong>kritisch</strong>e Praxis <strong>de</strong>s Geschichtenerzählens mit <strong>de</strong>r<br />
Intention, naive Repräsentationspolitiken offenzulegen und dominante Diskurse zu<br />
verschieben“ (Weber 2000a, 278). Diese Praxis birgt wesentliche Hinweise auf ein De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>njenigen Bereichen, die wie die<br />
KI-Forschung <strong>de</strong>n Naturwissenschaften nahe stehen. Allerdings reicht diese Perspektive<br />
als Handlungsstrategie in <strong>de</strong>r Informatik nicht aus, wenn es darum gehen soll,<br />
auch die technologischen Produkte (bspw. Anwendungssoftware) <strong>kritisch</strong> zu<br />
verän<strong>de</strong>rn. Insofern ist Wajcman beizupflichten, wenn sie kritisiert: „At times, Haraway<br />
loses sense of how feminists could act to change, or at least redirect technologies,<br />
rather than reconfiguring them in our writings“ (Wajcman 2004, 101).Diese Lücke,<br />
Haraways Ansatz für eine alternative Technikgestaltung konstruktiv nutzen zu können,<br />
hat Saupe zufolge Metho<strong>de</strong>. Denn Haraway vermei<strong>de</strong> es aus Prinzip, normative<br />
Konzepte für pragmatisches Han<strong>de</strong>ln zu formulieren, da diese notwendigerweise selbst<br />
wie<strong>de</strong>r Ausschlüsse produzierten, die Haraways Ansicht nach unakzeptabel wären<br />
(vgl. Saupe 2002, 244).<br />
Um Haraways Ansatz in <strong>einer</strong> Disziplin wie <strong>de</strong>r Informatik, die mit <strong>de</strong>r (auf ihre Art<br />
materiell-semiotischen) Gestaltung von technischen Artefakten und <strong>de</strong>r zugehörigen<br />
Wissensproduktion befasst ist, <strong>de</strong>nnoch umsetzen zu können, ist diese Übersetzungsschwierigkeit<br />
zu lösen und – womöglich auch gegen ihren Anspruch – eine<br />
Konkretisierung ihrer Konzepte für die Informatik vorzunehmen.<br />
Ein weiterer Punkt, <strong>de</strong>r die Inanspruchnahme Haraways für <strong>de</strong>n Zweck dieser Arbeit<br />
erschwert, ist, dass sie sich primär mit biowissenschaftlichen Entwicklungen auseinan<strong>de</strong>rsetzt.<br />
Dieser Fokus ist zwar nicht exklusiv. Im Gegenteil betont sie bereits in ihrem<br />
Cyborg-Manifest stets das Zusammenwirken von biotechnologischen mit informationstechnologischen<br />
Entwicklungen. Ihre bekanntesten Fallstudien jedoch nehmen die Primatologie,<br />
das Immunsystem, und die Soziobiologie in die Kritik. Das macht Haraways<br />
Schriften aus <strong>einer</strong> allgemeinen Geschlechterforschungsperspektive zwar interessant,<br />
sind es doch geschlechtsmarkierte Körper und Mensch-Tier-Überschreitungen, die traditionell<br />
immer wie<strong>de</strong>r dazu dienen mussten, Ordnung erhalten<strong>de</strong>, hierarchische Geschlechtszuschreibungen<br />
zu legitimieren. Jedoch stellt sich die Frage, inwieweit ihre<br />
Herangehensweise, insbeson<strong>de</strong>re da sie bewusst keine pragmatische Metho<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r<br />
Vorgehensweise beschreibt, auf die Informatik anwendbar ist.<br />
So stellt etwa Katherine Hayles heraus, dass sich Informationstechnologien seit <strong>de</strong>r<br />
Veröffentlichung von Haraways Cyborg-Manifest grundlegend verän<strong>de</strong>rt hätten: „In the<br />
years since, new technologies have sprung from the same nexus of forces that gave<br />
birth to the cyborg, most notably the internet and the world-wi<strong>de</strong>-web, along with a host<br />
of networked information <strong>de</strong>vices, including cell phones, sensor networks (including<br />
‚smart dust‘), yielding real-time data flows, RFID (Radio Frequency I<strong>de</strong>ntification) tags,<br />
GPS networks and nana technologies” (Hayles 2006, 159). Für diejenigen, die an <strong>de</strong>r<br />
Analyse dieser Entwicklungen interessiert seien, könne die Cyborg-Figur nicht mehr<br />
dasselbe aufregen<strong>de</strong> Gemisch aus Wi<strong>de</strong>rstand und Ko-Option bieten wie 1986. Hayles<br />
betont, dass die Cyborg-Metapher zwar weiterhin ihren Wert für die Untersuchung<br />
jener materiell-semiotisch Verän<strong>de</strong>rungen habe, die <strong>de</strong>n menschlichen Körper<br />
62
modifizieren und transformieren. Da sie als individuelle Figur verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n muss,<br />
sei die Cyborg jedoch keine angemessene Metapher, um die vernetzte, interkonnektive<br />
Komplexität aktueller Informationstechnologien zu begreifen, die das bislang als<br />
menschlich und individuell verstan<strong>de</strong>ne Kognitive radikal transformiere. Hayles bezeichnet<br />
Haraway Arbeit <strong>de</strong>shalb als „unvollen<strong>de</strong>t“. 127 Meines Erachtens greift Hayles<br />
Kritik hier zu kurz, da sie Haraways Konzept <strong>de</strong>s Fa<strong>de</strong>nspiels ignoriert, das gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>n<br />
kollektiven, global vernetzten Charakter von Erkenntnis- und Technologieproduktion<br />
betont. Vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Einwän<strong>de</strong> Hayles erweist sich das oben eingeführte<br />
Fa<strong>de</strong>nspiel letztendlich als die bessere Metapher, um die dynamische Relationalität<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte und menschlicher Akteur_innen theoretisch zu fassen.<br />
Was die Anschlussfähigkeit von Haraways Schriften an die Informatik aber<br />
problematisch macht, ist ihr radikaler Sprachstil, <strong>de</strong>r ihren persönlichen Standpunkt<br />
stets bewusst betont und distanziert-objektivistische Ansprüche <strong>de</strong>r Beschreibung weit<br />
hinter sich lässt. Entsprechend ihrer erkenntnistheoretischen Position überschreitet sie<br />
in ihrer Art <strong>de</strong>s Schreibens traditionelle Trennungen zwischen politischen und Fakten,<br />
Ethik und Wissenschaft, Emotion und Rationalität. Unterschiedliche, auch wi<strong>de</strong>rsprüchliche<br />
Lesarten ihrer Schriften sind beabsichtigt. „Haraways Beschreibungsform unterschei<strong>de</strong>t<br />
sich hierbei eklatant von gewohnten, vor allem sog. (natur-)wissenschaftlichen<br />
Weltbeschreibungen. Denn sie entwickelt eine eigene und oft sehr eigenwillige<br />
Terminologie, die teilweise überzeichnend, die konventionellen Begrifflichkeiten<br />
umformuliert“ (Saupe 2002, 171). Wajcman weist auch darauf hin, dass ihr Schreibstil<br />
tief in <strong>de</strong>r nordamerikanischen Kultur verankert sei und auf ein spezifisches kulturelles<br />
Kapital rekurriere.: “[H]er rhetorical method and eclectic reference points, ranging from<br />
scientific texts to advertisement, paintings, science fiction plots, and her own<br />
experiences, assumes a rea<strong>de</strong>r who is familiar with North American culture. While such<br />
rea<strong>de</strong>rs often find Haraway’s lyrical, irreverent, freely associative ironic style inspiring,<br />
rea<strong>de</strong>rs without the appropriate cultural capital are likely to find it infuriatingly obscure<br />
and impenetrable” (Wajcman 2004, 98). Sie kritisiert damit, dass Haraways Rhetorik<br />
neue Ausschlüsse produziert, die ihrem politischen Anliegen eigentlich entgegenlaufen<br />
müssten. Dieser Feststellung ist ergänzend hinzuzufügen, dass insbeson<strong>de</strong>re auch<br />
LeserInnen <strong>de</strong>rjenigen disziplinären Kulturen, die sich primär natur- und technikwissenschaftlich<br />
exakten Vorgehensweisen zuordnen, in <strong>de</strong>r Regel nicht über das von<br />
Haraway vorausgesetzte kulturelle Wissen verfügen o<strong>de</strong>r es einsetzen wollen. Dies<br />
erschwert nicht nur ein Verständnis Haraways von Seiten <strong>de</strong>r Informatik, son<strong>de</strong>rn<br />
macht eine Umsetzung ihrer Utopien in eine Welt, in <strong>de</strong>r es nicht nur darum geht, neue<br />
Geschichten über die Natur zu erzählen, son<strong>de</strong>rn Artefakte zu konstruieren, <strong>de</strong>ren<br />
Konzeption eine „exakte“ Definitionen und explizite Beschreibungen ihrer<br />
Funktionsweise erfor<strong>de</strong>rt, äußerst schwierig.<br />
Haraway liefert insgesamt einen grundlegen<strong>de</strong>n theoretischen Rahmen, <strong>de</strong>r für die<br />
Untersuchung <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
insbeson<strong>de</strong>re dort, wo in <strong>de</strong>r Informatik bereits traditionelle Dichotomien überschritten<br />
wer<strong>de</strong>n, hilfreich erscheint. Denn im Vergleich zur Akteur-Netzwerk-Theorie, in <strong>de</strong>r<br />
Grenzen zwischen Mensch und Maschine nicht in Bezug auf ihre hierarchisieren<strong>de</strong><br />
Effekten betrachtet wer<strong>de</strong>n, bringt sie die Politik <strong>de</strong>r Netzwerke in die Diskussion<br />
127 „Unfinished Work“ lautet <strong>de</strong>r Titel ihres Beitrags.<br />
63
zurück, bezieht explizit eine gesellschaftstheoretische Position und wen<strong>de</strong>t diese<br />
erkenntnis<strong>kritisch</strong>. Trotz <strong>de</strong>r angeführten Kritikpunkte am Politik- und Technikverständnis<br />
und <strong>de</strong>r Schwierigkeit, ihre Ansätze von <strong>de</strong>n Biowissenschaften auf<br />
Informationtechnologien zu übertragen, wer<strong>de</strong> ich ihrer grundsätzlichen Ausrichtung<br />
netzwerktheoretischen Denkens und politisch-erkenntnis<strong>kritisch</strong>er Intention im Kontext<br />
dieser Arbeit folgen. Ein fundiertes Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte,<br />
das für die Umsetzung von De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
offen ist, bedarf jedoch <strong>einer</strong> theoretischen Grundlage, die auch positive Aussagen<br />
zulässt, ohne in einen Positivismus o<strong>de</strong>r Naturalismus zurückzufallen. Eine solche<br />
Konzeption hat stärker zwischen Haraways postmo<strong>de</strong>rn-<strong>de</strong>konstruktivistischer Theorie<br />
und Rhetorik, einschließlich ihrer „Nichtmethodik“, und politisch-erkenntnis<strong>kritisch</strong>en<br />
Ansprüchen zu vermitteln. Zu<strong>de</strong>m sind zugleich realistische Positionen und materielle<br />
Prozesse, die für die Entwicklung von Technologien unvermeidlich sind, zu integrieren.<br />
3.5. „Materiality matters“: Asymmetrie und Verantwortung<br />
Im Vergleich zu Haraways Werk erscheint <strong>de</strong>r Ansatz <strong>de</strong>r Physikerin und Wissenschaftstheoretikerin<br />
Karen Barad leichter für das hier verfolgte Vorhaben, Geschlechterforschung<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Informatik zu fundieren, einsetzbar. Er ist nicht nur <strong>de</strong>shalb<br />
besser anschlussfähig, weil Barad Materie, speziell die physikalische Materialität ins<br />
Spiel bringt, son<strong>de</strong>rn vor allem, weil sie das Wi<strong>de</strong>rständige, das sich <strong>de</strong>r einfachen Logik<br />
von Kausalität, traditionellen Grenzziehungen etc. sperrt, in <strong>de</strong>r Welt <strong>de</strong>r Naturwissenschaften<br />
selbst verortet.<br />
Eine wesentliche Leistung Barads besteht darin, ein realistisches Verständnis <strong>de</strong>r<br />
Funktionsweise mo<strong>de</strong>rner Wissenschaften zu entwickeln, das mit konstruktivistischen<br />
Annahmen <strong>de</strong>r Situiertheit von Wissen (auch im Sinne Haraways) vereinbar ist. Dazu<br />
arbeitet sie das Rahmenkonzept „Agential Realism“ (Barad 1996a, 1996b, 2003) aus,<br />
welches sich erkenntnistheoretisch darstellt als „a form of social constructivism that is<br />
not relativist, does not reduce knowledge to power plays or language, and does not reject<br />
objectivity” (Barad 1996b, 186). Dieses Konzept ist durch vier zentrale Thesen<br />
charakterisiert: Erstens grün<strong>de</strong>t und situiert es Wissen in lokaler Erfahrung. Objektivität<br />
wird verkörpert verstan<strong>de</strong>n. Zweitens wird we<strong>de</strong>r das Materielle noch das Kulturelle<br />
bevorzugt. „Agential Reality“ sei im Anschluss an Haraway materiell-kulturell bzw.<br />
materiell-semiotisch zu <strong>de</strong>nken. Der Ansatz erfor<strong>de</strong>rt drittens ein Hinterfragen von<br />
Grenzziehungen und <strong>kritisch</strong>er Reflexivität und er betont viertens die Notwendigkeit<br />
<strong>einer</strong> Ethik <strong>de</strong>r Wissensproduktion (vgl. Barad 1996b, 179).<br />
Barads Konzept <strong>de</strong>s agentialen bzw. akteurzentrierten Realismus lässt <strong>de</strong>utliche<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen und Übereinstimmungen mit Haraways Ansatz erkennen. 128<br />
Bei<strong>de</strong> Autorinnen untersuchen technowissenschaftliche Praktiken, <strong>de</strong>ren Phänomene<br />
bzw. Apparate Materialität und Diskursivität untrennbar vereinen. „[M]ateriality is<br />
discursive (i.e., material phenomena are inseparable from the apparatuses of bodily<br />
production: matter emerges out of and inclu<strong>de</strong>s as part of its being the ongoing<br />
configuration of boundaries), just as discursive practices are always already material<br />
128<br />
Die theoretischen Beeinflussungen zwischen Haraway und Barad sind wechselseitig, vgl. etwa<br />
Haraway 1997, 116ff, Barad 2003, 803 und 808.<br />
64
(i.e., they are ongoing material (re)configurations of the world)“ (Barad 2003, 822).<br />
Barad und Haraway teilen bestimmte theoretische Grundverständnisse wie die<br />
Anerkennung von Hybri<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>s Posthumanen gegenüber anthropozentrischen<br />
Positionen sowie das gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Anliegen, traditionelle Grenzziehungen zwischen<br />
Natur und Kultur, zwischen Mensch und Maschine, Subjekt und Objekt zu<br />
rekonfigurieren. Darüber hinaus verbin<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong> Autorinnen gesellschafts<strong>kritisch</strong>feministische<br />
Ansätze mit Erkenntnistheorie. Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschie<strong>de</strong><br />
zu Haraways Ansatz, lassen sich an <strong>de</strong>r nachfolgen<strong>de</strong>n, sicherlich unvollständigen<br />
Liste ablesen, auf die Barad rekurriert: „Agential realism is an account of technoscientific<br />
and other practices that takes feminist, antiracist, poststructuralist, queer,<br />
Marxist, science studies and scientific insights seriously, building specifically on<br />
important insights from Niels Bohr, Judith Butler, Michel Foucault, Donna Haraway,<br />
Vicky Kirby, Joseph Rouse, and others” (Barad 2003, 810f). Gegenüber Haraway<br />
wer<strong>de</strong>n in diesen Bezügen insbeson<strong>de</strong>re Verschiebungen zu <strong>de</strong>n Queer Studies und<br />
<strong>de</strong>n Theorien <strong>de</strong>r Macht- und Wissensproduktion von Michel Foucault, aber auch hin<br />
zur Reflektion <strong>de</strong>r immanenten Logik <strong>de</strong>r Naturwissenschaften <strong>de</strong>utlich. Barad hat zwar<br />
ebenso wenig wie Haraway eine „ausformulierte“ Gesellschaftstheorie anzubieten,<br />
doch entwickelt sie mit Hilfe von Foucault und Butler ein konkretes Konzept <strong>de</strong>r<br />
Materialisierung von Materie, das zum Verständnis <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von<br />
Technologien äußerst hilfreich erscheint. 129 Darüber hinaus arbeitet sie nicht an <strong>de</strong>r<br />
Grenze von Mensch und Organismus o<strong>de</strong>r über die umstrittenen Biotechnologien,<br />
son<strong>de</strong>rn entwickelt eine Variante <strong>de</strong>s Post-Realismus, die die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s<br />
Materiellen stärker in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund rückt als es beispielsweise Haraway tut.<br />
Barad schließt an die physikalisch-philosophischen Überlegungen <strong>de</strong>s Physikers<br />
Niels Bohrs zur Quantentheorie an, welche die objektivistischen, <strong>de</strong>terministischen<br />
Auffassungen, die die klassische Newtonsche Physik prägten, hinter sich lasse. Bohr<br />
überwin<strong>de</strong> insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Cartesianischen Schnitt, <strong>de</strong>r Subjekt und Objekt wissenschaftlicher<br />
Untersuchungen klar voneinan<strong>de</strong>r trenne, und verstehe die Objekte und<br />
die Subjekte (bzw. AkteurInnen o<strong>de</strong>r Apparate) wissenschaftlicher Beobachtung als<br />
eine nicht-dualistische Einheit. Das naturwissenschaftliche Experiment sei ein diskontinuierlicher<br />
Prozess, <strong>de</strong>r es nicht ermögliche, zwischen <strong>de</strong>m Objekt und <strong>de</strong>n –<br />
menschlichen o<strong>de</strong>r nicht-menschlichen – Akteur_innen <strong>de</strong>r Beobachtung immanent zu<br />
unterschei<strong>de</strong>n. Der Schnitt zwischen Objekt und <strong>de</strong>n am Beobachtungsprozess aktiv<br />
Beteiligten sei vielmehr hergestellt, agentiell positioniert, beweglich und lokal, mithin<br />
ein „agential cut“ (Barad 1996b: 171, Barad 2003: 815, Barad 2007: 140). Die<br />
Verwicklung von konzeptuellen und physikalischen Aspekten <strong>de</strong>s Messprozesses<br />
erscheint als zentraler Aspekt von Bohrs Erkenntnistheorie. Die physikalischen<br />
Apparate markierten die konzeptuelle Subjekt-Objekt-Trennung und die beschreiben<strong>de</strong>n<br />
Konzepte erhielten ihre Be<strong>de</strong>utung durch <strong>de</strong>n Bezug auf einen spezifischen<br />
physikalischen Apparat. Beobachtete Werte bzw. Messergebnisse seien <strong>de</strong>mzufolge<br />
we<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Objekt selbst zuzuschreiben, noch <strong>de</strong>m Messinstrument, d.h. sie sind<br />
we<strong>de</strong>r Ausdruck <strong>einer</strong> beobachtungsunabhängigen Realität, noch ausschließlich durch<br />
die Instrumente und die BeoachterInnen hergestellt und konstruiert. Vielmehr gingen<br />
129 Auf ihre konkrete Konzeption von „Materialisierung“ wer<strong>de</strong> ich Kapitel 3.8. genauer zu sprechen kom-<br />
men.<br />
65
Messapparaturen und beobachtete Objekte/Materie untrennbare Verbindungen ein.<br />
Demzufolge ließen sich Erkenntnistheorie und Ontologiebzw. Wissen und Sein nicht<br />
klar voneinan<strong>de</strong>r trennen. „Reality is not composed of things-in-themselves or thingsbehind-phenomena,<br />
but things-in-phenomena […] phenomena constitute a nondualistic<br />
whole” (Barad 1996b, 176).<br />
Zentral für Barads Ansatz ist die Untrennbarkeit von Sein und Wissen. „Agential<br />
Realism“ ist damit zugleich Epistemologie und Ontologie, in ihren eigenen Worten also<br />
ein „epistem-onto-logischer“ Rahmen (vgl. Barad 1998, 120, Fußnote 1) bzw. eine<br />
„Onto-epistemology – the study of practices of knowing in being“ (Barad 2003, 829).<br />
Agentiale Realität sei jedoch keine feststehen<strong>de</strong> Ontologie, unabhängig von menschlicher<br />
Praxis, son<strong>de</strong>rn kontinuierlich rekonstituiert durch unsere materiell-diskursiven<br />
Interaktionen mit Objekten und Beobachtungstätigkeiten.<br />
Inspiriert von Bohrs epistemologischen Thesen führt Barad <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r “Intra-aktion”<br />
ein – zunächst um festzuhalten, dass gemessene Werte auf Phänomene verwiesen,<br />
die als physikalisch-konzeptuelle Verbindungen zu verstehen sind: „I introduce the<br />
neologism ‚intra-action‘ to signify the inseparability of ‚objects‘ and ‚agencies of observation‘<br />
(in contrast to ‚interaction‘,which reincribes the contested dichotomy)” (Barad<br />
1998, 96). Sie überträgt dieses Konzept <strong>de</strong>r Intra-aktion von <strong>de</strong>r Quantenphysik auf die<br />
Technowissenschaften und ihre sozio-kulturellen Zusammenhänge allgemein, um<br />
fragwürdige dichotome Annahmen über Natur und Kultur bzw. über Subjekt und Objekt<br />
bereits terminologisch zu vermei<strong>de</strong>n und auf Instabilitäten bzw. Handlungsspielräume<br />
hinzuweisen. Dabei begreift sie Handlungsfähigkeit über das mo<strong>de</strong>rne Verständnis<br />
hinausgehend, das diese mit Subjektivität o<strong>de</strong>r Intentionalität verknüpfte, nicht als als<br />
etwas, das man hat, son<strong>de</strong>rn als „enactment“ (Barad 1998, 112). Auf dieser Grundlage<br />
erscheint es ihr nicht nur angemessen, son<strong>de</strong>rn notwendig, neben menschlichen auch<br />
nicht-menschliche und cyborgisierte Formen von Handlungsfähigkeit anzuerkennen<br />
(Barad 1996a, 8).<br />
Barad konzipiert das Verhältnis von menschlichen und nicht-menschlichen<br />
AkteurInnen jedoch nicht im Sinne <strong>einer</strong> symmetrischen Anthropologie Latours, <strong>de</strong>r<br />
darin Haraway im Wesentlichen folgt, 130 son<strong>de</strong>rn begreift die hybri<strong>de</strong>n Verhältnisse als<br />
eine ontologische Asymmetrie. Die Intra-aKtion zwischen menschlichen und nichtmenschlichen<br />
AkteurInnen könne nicht gleichrangig sein, da <strong>de</strong>ren Repräsentation<br />
stets <strong>de</strong>r menschlichen AutorInnenschaft bedürfe: „Agential realism acknowledges the<br />
agency of both subjects and objects without pretending that there is some utopian<br />
symmetrical wholesome dialogue, outsi<strong>de</strong> of human represention.“ (Barad 1996b, 188).<br />
Diese Asymmetrie ist für <strong>de</strong>n Kontext dieser Arbeit <strong>de</strong>r wesentliche Aspekt, <strong>de</strong>r Barads<br />
Ansatz von ANT, aber auch von Haraway unterschei<strong>de</strong>t. Letztere beharrt zwar stets<br />
auf <strong>de</strong>r Anerkennung von Differenz, 131 stellt jedoch nicht in <strong>de</strong>mselben Maße wie Barad<br />
die Gleichrangigkeit von Menschen und materiellen Objekten in Frage. „Nature has<br />
130 Es wäre die These zu überprüfen, ob sich <strong>de</strong>r Unterschied, dass Haraway an <strong>de</strong>r symmetrischen Anthropologie<br />
Latours festhält, während Barad und Suchman (siehe das nächste Kapitel 3.6) sich eher für<br />
ein asymmetrisches Verständnis von Natur und Mensch bzw. Technik und Mensch aussprechen, womöglich<br />
aus <strong>de</strong>n jeweils betrachteten Gegenstandsbereichen (Biologie vs. ingenieurwissenschaftliche Artefakte<br />
o<strong>de</strong>r physikalisiche Phänomene) erklärt.<br />
131 Beispielsweise untersucht Haraway in “The companion species manifesto” die Differenz zwischen Maschinellem<br />
und Tierischem: „[T]he differences between even the most politically correct cyborg and an<br />
ordinary dog matter“ (Haraway 2003, 4).<br />
66
agency, but it does not speak itself to the patient, unobstrusive observer listening for its<br />
cries – there is an important asymmetry with respect to agency: we do the representing<br />
and yet nature is not a passive blank slate awaiting our inscriptions, and to privilege the<br />
material or discursive is to forget the inseparability that characterizes phenomena”<br />
(Barad 1996, 181).<br />
Eine asymmetrische Intra-aktion be<strong>de</strong>utet ihr zufolge nicht, dass die AutorInnenschaft<br />
ausschließlich in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Menschen liegt. Die Welt selbst sei vielmehr<br />
wi<strong>de</strong>rständig: „the world kicks back“ (Barad 1998, 112). Ebenso wenig sei die Wissensproduktion<br />
selbst eine unschuldige Repräsentation <strong>einer</strong> unabhängigen Welt, son<strong>de</strong>rn<br />
äußerst folgenreich. Agentialer Realismus konzentriere sich <strong>de</strong>shalb auf die realen<br />
Konzequenzen, Interventionen, kreativen Möglichkeiten und “responsibilities of<br />
interacting with the world” (Barad 1996a, 8). Denn Realität wer<strong>de</strong> in <strong>de</strong>m Prozess, die<br />
Welt verständlich und fassbar zu machen, sedimentiert. Und dieser Prozess schließe<br />
bestimmte Praktiken ein und an<strong>de</strong>re nicht. Deshalb seien wir nicht nur verantwortlich<br />
für das Wissen, das wir suchen, son<strong>de</strong>rn zum Teil auch für das, was existiert (vgl.<br />
Barad 1998, 105). Damit insistiert Barad auf einem Begriff von Verantwortung, <strong>de</strong>r sich<br />
auf die Materialität und Be<strong>de</strong>utung naturwissenschaftlicher Phänomene bezieht. Die<br />
Entstehung, Repräsentation und die materiellen Folgen <strong>de</strong>r Phänomene (bzw. Hybri<strong>de</strong><br />
o<strong>de</strong>r Netzwerke) seien(zumin<strong>de</strong>st in Teilen) menschlich gemacht. 132 Damit wer<strong>de</strong>n<br />
explizit politisch-ethische Fragen <strong>de</strong>r Verantwortlichkeit von WissenschaftlerInnen<br />
aufgeworfen. „Agential Realism […] provi<strong>de</strong>s an un<strong>de</strong>rstanding of the nature of<br />
scientific practices which recognizes that objectivity and agency are bound with issues<br />
of responsibility and accountability. We are responsible for what exists, not because it<br />
is an arbitrary construction of choosing, but because agential reality is sedimented out<br />
of particular practices that we have a role in shaping.“ (Barad 1996a, 7)<br />
Dieses Verständnis menschlicher, speziell wissenschaftlicher Verpflichtung, die<br />
materielle Welt verantwortungsvoll zu gestalten, teilt Barad mit <strong>de</strong>n zuvor dargestellten<br />
Ansätzen. Während jedoch Latour Moral auf das Gedankenexperiment eines „Parlaments<br />
<strong>de</strong>r Dinge“ verlegt und sich Haraway darauf konzentriert, die Geschichten, die<br />
wir über die Natur erzählen, (diskursiv) umzuschreiben, fokussiert Barad auf die<br />
Materialität <strong>de</strong>r Dinge und for<strong>de</strong>rt in dieser Hinsicht die Übernahme von Verantwortung<br />
von Seiten <strong>de</strong>r WissenschaftlerInnen ein. Das Potential <strong>kritisch</strong>er Verän<strong>de</strong>rung wird<br />
also nicht anhand <strong>einer</strong> vielschichtig, utopisch-ambivalenten Figur <strong>de</strong>s/<strong>de</strong>r Cyborg o<strong>de</strong>r<br />
eines post-animalistischen Hun<strong>de</strong>s (vgl. Haraway 2003) erklärt, son<strong>de</strong>rn mittels physikalischer,<br />
beobachtbarer Phänomene. Das be<strong>de</strong>utet, dass das Politische, das als<br />
Ansatzpunkt gesellschafts<strong>kritisch</strong>er Intervention gewählt wird, bereits in wissenschaftlichen<br />
Interpretationen über die materielle Natur <strong>de</strong>r Dinge selbst begrün<strong>de</strong>t wird. 133 Es<br />
sind gera<strong>de</strong> diese bei<strong>de</strong>n Aspekte – <strong>de</strong>r Fokus auf die materielle Welt und die Auffor<strong>de</strong>rung,<br />
sie verantwortungsvoll zu gestalten – die ihren Ansatz für das Vorhaben,<br />
Gen<strong>de</strong>ringprozesse in und durch die Informatik theoretisch zu fassen, beson<strong>de</strong>rs attraktiv<br />
machen. Die bisherige Diskussion in diesem Kapitel hat gezeigt, dass sich die<br />
132 Singer fasst treffend zusammen: „WissenschaftlerInnen sind we<strong>de</strong>r das neutrale Sprachrohr <strong>de</strong>r Gesetze<br />
<strong>de</strong>r Natur noch <strong>de</strong>r Gesellschaft, son<strong>de</strong>rn AgentInnen in <strong>de</strong>r Koproduktion von Wissenschaft, Gesellschaft<br />
und Natur“ (Singer 2004, 87).<br />
133 Diese Bezugnahme spiegelt sich auch in einem Schreibstil wi<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r angelehnt an traditionell-philosophische<br />
Diskurse argumentiert und nicht – wie Haraway – mit Science Fiction liebäugelt und von Ironie<br />
durchdrungen ist.<br />
67
Politik materieller Artefakte nicht so simpel wie in Winners Brückenbeispiel vorgestellt<br />
<strong>de</strong>nken lässt, insbeson<strong>de</strong>re wenn technowissenschaftliche Artefakte <strong>de</strong>r Informatik<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n sollen, die – wie fußballspielen<strong>de</strong> Roboter, Suchmaschinen o<strong>de</strong>r<br />
Softwareagenten – traditionelle Grenzziehungen zwischen Mensch und Maschine<br />
überschritten haben. 134<br />
An<strong>de</strong>rerseits wird gera<strong>de</strong> von Seiten <strong>kritisch</strong>er InformatikerInnen immer wie<strong>de</strong>r eine<br />
verantwortliche Wissenschafts- und Technologieentwicklung eingefor<strong>de</strong>rt. Informationstechnologien<br />
sollen auf <strong>de</strong>r Basis gesellschaftstheoretischer o<strong>de</strong>r auch feministischer<br />
Ansätze reflektiert und zu gestaltet wer<strong>de</strong>n. Auch in dieser Hinsicht muss festgehalten<br />
wer<strong>de</strong>n, dass allein eine politisch-emanzipatorische Intention <strong>de</strong>r TechnologiegestalterInnen<br />
nicht genügt, um Ungleichheitsstrukturen nicht weiter festzuschreiben.<br />
Für bei<strong>de</strong> Problematiken, die <strong>de</strong>r Materialität und die <strong>de</strong>r Verantwortung, bietet Barad<br />
einen konsistenten Theorierahmen an, <strong>de</strong>r das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
einzuschließen vermag.<br />
Der Wert ihrer Theorie für die Fragestellung dieser Arbeit geht jedoch noch darüber<br />
hinaus. Denn Barad entwickelt einen Ansatz, Prozesse <strong>de</strong>r Materialisierung <strong>de</strong>s<br />
Materiellen zu <strong>de</strong>nken, <strong>de</strong>r für das Verständnis <strong>de</strong>r Einschreibung von Geschlecht und<br />
Sozialem in Technologien produktiv ist. Sie liest dazu Judith Butlers Konzept <strong>de</strong>r<br />
Performativität mit ihrem eigenen Ansatz <strong>de</strong>s „Agential Realism“ gegen und reformuliert<br />
dieses Konzept dabei, in<strong>de</strong>m sie Butlers auf biologische Körper bezogenen Ansatz<br />
auf Materie erweitert. Auf Barads Vorschlag, die technowissenschaftlichen Praktiken<br />
<strong>de</strong>r Produktion von (physikalischen) Phänomenen in einem performativen Sinne zu<br />
verstehen, wer<strong>de</strong> ich weiter unten in <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>r Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und<br />
<strong>de</strong>r Materialisierung von technischen Artefakten zurückkommen.<br />
3.6. Mensch-Maschine-Rekonfigurationen: 135 Politik und Neuverteilung von<br />
Handlungsfähigkeit<br />
Die Anthropologin und feministische Technikforscherin Lucy Suchman, <strong>de</strong>ren Ansatz<br />
im Folgen<strong>de</strong>n rezipiert wird, versucht, die Ansätze Latours, Haraways und Barads für<br />
das Verständnis <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Beziehungen und speziell für die Technologieentwicklung<br />
in <strong>de</strong>r Informatik produktiv zu machen. Dabei lautet die Leitfrage, die ihre<br />
Texte weitgehend durchzieht, „how capacities for action and associated responsibilities<br />
are currently figured at the machine interface, and how they might be imaginatively and<br />
materially reconfigured“ (Suchman 2004, 2). Im Vergleich zu <strong>de</strong>r materiellen Welt physikalischer<br />
Objekte und Apparate Barads und <strong>de</strong>n harmlos anmuten<strong>de</strong>n Objekten ingenieurwissenschaftlicher<br />
Kreativität Latours, wen<strong>de</strong>t sich Suchman <strong>de</strong>m Feld <strong>de</strong>r umstrittenen<br />
intelligenten Artefakte und interaktiven Interfaces zu: angefangen von so<br />
genannt intelligenten Fotokopierern <strong>de</strong>r 1980er Jahre bis hin zu aktuellen Ausprägungen<br />
technowissenschaftlicher Artefakte wie Softwareagenten, ‚Wearables‘, ‚smarten‘<br />
Umgebungen, situierter Robotik, ‚Affective Computing‘ und sozialen Maschinen.<br />
Gegenstand ihrer Untersuchung sind solche informatischen Artefakte, <strong>de</strong>nen bislang<br />
ausschließlich als menschlich gelten<strong>de</strong> Eigenschaften wie Intelligenz, Emotion und<br />
134 Vgl. hierzu auch die Diskussion zur Handlungsfährigkeit von Artefakten in Kapitel 3.3.<br />
135 In Anlehnung an <strong>de</strong>n Titel „Human-Machine Reconfiguations“ (Suchman 2007).<br />
68
soziale Interaktionfähigkeiten zugeschrieben wer<strong>de</strong>n. Sie fokussiert auf ein technowissenschaftliches<br />
Feld, in <strong>de</strong>m traditionelle Grenzziehungen zwischen Mensch und<br />
Maschinen zur Disposition stehen. Ihre Arbeiten können <strong>de</strong>shalb als Pendant zu <strong>de</strong>n<br />
von Haraway untersuchten Grenzziehungen zwischen Mensch und Organismus verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n (vgl. etwa Haraway 1995c [1985], 2008). Die betrachteten<br />
Forschungen und Konstruktionen menschenähnlicher Maschinen erscheinen meines<br />
Erachtens gegenwärtig ebenso provokant wie die von Haraway in ihren frühen Schriften<br />
aufgezeigten Eingriffe in <strong>de</strong>n menschlichen Körper.<br />
Suchman interessiert sich ebenso wie Barad für immanent technowissenschaftliche<br />
Argumentationen. Latour, Haraway und an<strong>de</strong>re Wissenschafts- und TechnikforscherInnen<br />
wollten mit <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rung, die Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Dinge in <strong>de</strong>n Blick zu<br />
nehmen, auf Forschungslücken in <strong>de</strong>n Sozialwissenschaften aufmerksam machen, die<br />
Rammert mit „Technikvergessenheit <strong>de</strong>r Soziologie“ (Rammert 1998) bezeichnet hat.<br />
Demgegenüber betont Suchman, dass ihre Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit Fragen <strong>de</strong>r<br />
„agency“ im Kontext <strong>de</strong>r Technoscience und <strong>de</strong>r Ingenieurwissenschaften beginnt, wo<br />
in Bezug auf wesentliche Aspekte die umgekehrte Situation <strong>de</strong>s ten<strong>de</strong>nziellen<br />
Ausschlusses <strong>de</strong>s Sozialen vorläge: „Far from being exclu<strong>de</strong>d, ‚the technical‘ in<br />
regimes of research and <strong>de</strong>velopment [is] centered, whereas ‚the social‘ is separated<br />
out and relegated to the margins. It is the privileged machine in this context that<br />
creates its marginalized human others“ (Suchman 2007, 269f). Trotz dieses Unterschieds<br />
stellt Suchman eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen mo<strong>de</strong>rnen<br />
Auffassungen von Handlungsfähigkeit, die im Zentrum <strong>de</strong>r Kritik <strong>de</strong>r Science Studies<br />
stehen, und entsprechen<strong>de</strong>n Vorstellungen bei <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen fest.<br />
Humanistische wie technowissenschaftliche Bestimmungen von „agency“ setzten<br />
unabhängige, singuläre, in sich abgeschlossene Entitäten – seien es Menschen o<strong>de</strong>r<br />
Maschinen – voraus. Es wer<strong>de</strong> in bei<strong>de</strong>n Fällen unterstellt, dass handlungsfähige<br />
Personen und Artefakte eigenständige Individuen seien. Für Suchman liegt das<br />
Problem „intelligenter Artefakte“ und „interaktiver Interfaces“ <strong>de</strong>shalb nicht – wie<br />
insbeson<strong>de</strong>re von <strong>kritisch</strong>en InformatikerInnen immer wie<strong>de</strong>r problematisiert – auf <strong>einer</strong><br />
sprachlichen Ebene, über die <strong>de</strong>n Maschinen Handlungsfähigkeit zugeschrieben<br />
wird, 136 son<strong>de</strong>rn vielmehr auf <strong>de</strong>r konzeptuellen Ebene, die Menschen und Artefakte<br />
als diskrete autonome Entitäten voraussetzt.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re die Projekte zu künstlicher Intelligenz und menschenähnlichen<br />
Maschinen stün<strong>de</strong>n in <strong>einer</strong> Tradition, die Abgrenzung, Trennung und Autonomie statt<br />
Beziehungen und Verbindungen als grundlegen<strong>de</strong> Merkmale <strong>de</strong>s Humanen verstehen.<br />
Der Reiz <strong>de</strong>r Konstruktion menschenähnlicher Maschinen wür<strong>de</strong> damit gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Kontinuität <strong>de</strong>r traditionellen dichotomen Auffassungen von Mensch und Maschinen<br />
liegen. „Somewhat paradoxically, these analyses suggest that in this respect it is<br />
precisely the persistence of the mo<strong>de</strong>rnist human/machine divi<strong>de</strong> within the discourse<br />
of intelligent artefacts that makes machine agency so compelling“ (Suchman 2002c, 5).<br />
Suchman bleibt jedoch nicht bei <strong>einer</strong> geisteswissenschaftlichen Kritik <strong>de</strong>r<br />
analysierten informatischen Projekte stehen, son<strong>de</strong>rn bin<strong>de</strong>t diese an die Frage <strong>de</strong>r<br />
Politik <strong>de</strong>r Artefakte einschließlich <strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse zurück. Sie<br />
136 Vgl. etwa Weizenbaum 1994 [1976], Turkle 1998 [1995], Reeves/ Nass 1996 sowie in Bezug auf Chat-<br />
bots Braun 2003.<br />
69
interpretiert die aktuellen technowissenschaftlichen Bemühungen um menschenähnliche<br />
Maschinen als Diskurs über Serviceleistungen in <strong>de</strong>r globalen Dienstleistungsökonomie<br />
(vgl. Suchman 2003, 2007, 206ff) und arbeitet <strong>de</strong>ssen politische<br />
Voraussetzungen heraus. „Although the ‚we‘ who will benefit from smart technologies<br />
may be cast as a universal subject, the very particular locations of those who speak<br />
and those who are (at least implicitly) spoken of inevitably entails marks of class and<br />
gen<strong>de</strong>r and attendant i<strong>de</strong>ntifications. Moreover, the smart machine’s presentation of<br />
itself as the always obliging labor-saving <strong>de</strong>vice erases any evi<strong>de</strong>nce of labor involved<br />
in its production and operation“ (Suchman 2007, 221). Suchman betont damit, dass <strong>de</strong>r<br />
zugrun<strong>de</strong> gelegte Servicegedanke von <strong>de</strong>n Imaginationen eines männlich, weiß und<br />
heterosexuell konnotierten autonomen Subjekts sowie von klassenspezifischen Annahmen<br />
eines Oben und Unten durchdrungen ist. Ferner zeigt sie auf, dass das Konzept<br />
<strong>de</strong>r Dienstleistungstechnologien auf <strong>de</strong>r Ignoranz körperlich-materieller Arbeit grün<strong>de</strong>t,<br />
die vor <strong>de</strong>m Hintergrund gegenwärtig vorherrschen<strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse<br />
vorwiegend von Frauen und zu<strong>de</strong>m global höchstunterschiedlich verteilt ausgeübt<br />
wird.. Deshalb seien die technischen Projekte autonomer Softwareagenten, persönlicher<br />
virtueller Assistenten, Serviceroboter und „Wearables“ als Fortsetzungen sozialer<br />
Ungleichheit einschließlich <strong>de</strong>r hierarchischen Geschlechterordnung zu verstehen.<br />
Suchman ist jedoch nicht nur an <strong>einer</strong> solchen generellen politischen Kritik, wie sich<br />
Menschen und Maschinen konstituieren, interessiert, son<strong>de</strong>rn zugleich an empirischen<br />
Analysen. Was ihren Ansatz gegenüber <strong>de</strong>nen von Haraway und Barad auszeichnet,<br />
die methodische Konzepte vermei<strong>de</strong>n bzw. philosophisch argumentieren, ist, dass sie<br />
mit ihrem empirisch-ethnografischen Zugang auf <strong>de</strong>r Ebene von Metho<strong>de</strong>n implizit<br />
Vorschläge macht, wie Untersuchungen von Mensch-Maschine-Rekonfiguration<br />
erfolgen können. Ihre Studien zur gegenseitigen Konstituiertheit von Menschen und<br />
Artefakten beschreiben zumeist konkrete Interaktionen von NutzerInnen und<br />
informatischen Artefakten. Am bekanntesten sind ihre Vi<strong>de</strong>oanalysen von <strong>de</strong>r<br />
Bedienung „intelligenter“ Kopierer durch Kollegen bei Xerox PARC, die sie in <strong>de</strong>n<br />
1980er Jahren durchgeführt hat (vgl. Suchman 1987). Spätere Studien fokussieren<br />
stärker auf Arbeitsanalysen bestimmter Bereiche, in <strong>de</strong>nen IT eingesetzt wird, wie die<br />
Datenbank <strong>einer</strong> Rechtsanwaltskanzelei (vgl. Suchman 2002a) und das CAD-System<br />
<strong>einer</strong> Bauingenieurin (vgl. Suchman 2000). Suchman nimmt darin auf die theoretischen<br />
Vorgängeransätze von ANT, die mikrosoziologisch orientierte Wissenschaftsforschung<br />
und die Laborstudien Bezug, erweitert diese jedoch um so genannte „work place<br />
studies“ 137 .<br />
Eine empirische Herangehensweise erscheint im Bereich <strong>de</strong>r Informationstechnologien<br />
notwendig, um angesichts <strong>de</strong>r Vielfalt und Diversität <strong>de</strong>r Artefakte ein Verständnis<br />
aktueller „Agencies at the Interface“ von Mensch und Maschine zu gewinnen. Diese<br />
Untersuchungsperspektive kann wichtige Hinweise auf die Ko-Konstruktion von<br />
informatischen Artefakten und Geschlecht liefern und damit für die Analyse <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring, wie im nächsten Kapitel 4 aufgezeigt wird.<br />
Ein weiterer Aspekt, <strong>de</strong>r Suchmans Ansatz für die Fragestellung dieser Arbeit<br />
wertvoll macht, ist ihr Interesse an <strong>de</strong>r Frage, wie Alternativen zu <strong>de</strong>n i<strong>de</strong>ntifizierten<br />
137 Diese Forschungsrichtung untersucht Arbeit, Technologie und Interaktionen in komplexen Organisationen<br />
an <strong>de</strong>r Schnittstelle von Informatik (u.a. HCI und CSCW) und Soziologie (u.a. Interaktionsanalysen<br />
und Ethnographie); vgl. etwa Luff et al. 2000.<br />
70
estehen<strong>de</strong>n Festschreibungen aussehen können. Es geht ihr explizit um eine<br />
Intervention in gegenwärtige Entwicklungspraktiken und Nutzungsweisen neuer Technologien.<br />
Sie fragt, „how they might be figured and configured differently“ (Suchman<br />
2004, 2). In ihrem Buch „Human-Machine Reconfigurations“ (2007) verweist sie auf<br />
„new resources for thinking about, and acting within, the interface of persons and<br />
things“ (Suchman 2007, 259), in<strong>de</strong>m sie Ansätze aus <strong>de</strong>r Wissenschaftsforschung und<br />
Kunst vorstellt, die im Gegensatz zum Projekt <strong>de</strong>r autonomen, intelligenten Maschinen<br />
einen relationalen, performativen Zugang zu soziomateriellen Phänomenen entwickeln.<br />
Dazu führt sie die Konzepte <strong>de</strong>s „heterogeneous engineering“ (Law 1987), <strong>de</strong>r „ontological<br />
choreographies“ (Cussins 1998), <strong>de</strong>r „artful integration“ (Suchman 2002a) und<br />
<strong>de</strong>s „<strong>de</strong>sign of configurations“ (Aanestad 2003) an, die sie zum Teil anhand<br />
empirischer Untersuchungen veranschaulicht. Diese Konzepte möchte ich genauer in<br />
<strong>de</strong>n Blick nehmen, da sie die von ANT, Haraway und Barad vorgeschlagene, zwischen<br />
Menschen und Maschine neu verteilte, situiert variieren<strong>de</strong> Form <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit<br />
aufzeigen. Der Begriff <strong>de</strong>r heterogenen Ingenieurstätigkeit (vgl. Law 1987)<br />
verweist darauf, dass IngenieurInnen nur dann erfolgreich sind, wenn sie Technologien<br />
nicht nur als solche funktional konstruieren, son<strong>de</strong>rn diese Entwicklungen mit<br />
unterschiedlichen AkteurInnen, Deutungen und Normen in Verbindung bringen. Dazu<br />
können ästhetische Orientierungen gehören, <strong>de</strong>r Wunsch nach Reputation o<strong>de</strong>r auch<br />
altruistische Interessen, die Lebenswelt zu verbessern.<br />
Das zweite Konzept, auf das sich Suchman bezieht, ist das <strong>de</strong>r ‚ontological choreographies‘<br />
(Cussins 1998), mit <strong>de</strong>m sich Charis Cussins gegen die im frühen Feminismus<br />
verbreitete Sicht <strong>de</strong>r Entfremdung <strong>de</strong>s Körpers durch Technologien wen<strong>de</strong>t. Sie<br />
zeichnet am Beispiel <strong>einer</strong> empirischen Untersuchung zur Invitrofertilisation statt<strong>de</strong>ssen<br />
die Beziehungen nach, die Frauen zu <strong>de</strong>n Teilen ihres Körpers, <strong>de</strong>ren Transformation<br />
und Re-Integration im Laufe <strong>de</strong>s Befruchtungsprozesses entwickeln, und<br />
damit auch ihr Verständnis <strong>de</strong>s Selbst. Haraway beschreibt Cussins Vorgehen und<br />
Konzept folgen<strong>de</strong>rmaßen: „As an ethnographer Karis has a won<strong>de</strong>rful ear for hearing<br />
the way people narrate their relationship to variously distributed parts that are and are<br />
not parts of themselves. She talks about ontological choreography, the dance of being<br />
as a verb, a verb that is ireducibly historically specific and semiotically material. It is not<br />
all the time everywhere. It is about these relationalities as they constitute the actors in<br />
their very action, so that the actors are a product of the relationality, and don’t simply<br />
enter into relationships with boundaries more or less intact at the end of the day.“<br />
(Haraway 2000, o.S.). Die Patientinnen bleiben <strong>de</strong>mzufolge in einem relationalen Sinne<br />
weiterhin handlungsfähig.<br />
Als weiteren Beleg dafür, dass das Verhältnis von Menschen und Maschinen an<strong>de</strong>rs<br />
als nach <strong>de</strong>m Prinzip autonomer Personen bzw. autonomer Maschinen zu konzipieren<br />
ist, führt Suchman eine unveröffentlichte Studie von Rachel Prentice über die Technologie<br />
<strong>de</strong>r minimal invasiven Operation an. Dabei zeigte sich beispielsweise, dass die<br />
operieren<strong>de</strong>n ÄrztInnen in <strong>de</strong>m komplexen Netzwerk von PatientIn, Vi<strong>de</strong>okamera, Monitor<br />
und vielen an<strong>de</strong>ren AkteurInnen entwe<strong>de</strong>r disorientiert sein o<strong>de</strong>r aber die technischen<br />
Instrumente als inkorporierte Erweiterungen ihres eigenen Körpers empfan<strong>de</strong>n<br />
(vgl. Suchman 2007, 265f). Ferner stellt Suchman eine Studie von Margunn Aanestad<br />
(2003) über eine Installation von Lehr-Operationssälen vor, die Teleübertragungen und<br />
Kommunikation mit räumlich entfernten Lernen<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Experten ermöglichen solle<br />
71
und von <strong>de</strong>n beteiligten TechnikerInnen und Krankenschwestern offene, evolutionäre<br />
Strategien – statt kontrollorientierter, spezifikationsgetriebenen Vorgehensweisen –<br />
erfor<strong>de</strong>rten, die darauf zielten, Verbün<strong>de</strong>te zu engagieren. Auf dieser Basis plädiert<br />
Aanestad dafür, Technikgestaltung als „<strong>de</strong>sign of configurations“ zu verstehen: „the<br />
creation of a well-working mix of people, practices and artefacts“ (Aanestad 2003, 1).<br />
Ein an<strong>de</strong>res Beispiel, das Suchman anführt, ist ihre eigene Studie über die Arbeit<br />
<strong>einer</strong> Bauingenieurin, die „through the interface“ (Bødker 1991) erfolgt. „Although<br />
CAD 138 might be held up as an exemplar of the abstract representation of concrete<br />
things, for the practicing engineer the story is more complex. Rather than stand in<br />
place of the specific locales – roadways, natural features, built environments, people<br />
and politics – of a project, the CAD system connects the experienced engineer sitting<br />
at her worktable to those things, at the same time that they exceed the system’s representational<br />
capacities. […] Immersed in her work, the CAD interface becomes for the<br />
engineer a simulacrum of the site, not in the sense of a substitute, but rather a place of<br />
work with its own specific materialities“ (Suchman 2007, 279).<br />
Weiter führt sie Projekte im Bereich <strong>de</strong>r digitalen Medien an, die sie als kunstvolle<br />
Integrationen („artful integration“ 139 ) von Personen, Objekten, Räumen, Fantasien,<br />
erinnerten Erfahrungen und Technologien beschreibt, in <strong>de</strong>nen Begegnungen evoziert<br />
und erkun<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n können, ohne zu versuchen, zwischenmenschliche Interaktion zu<br />
replizieren. Dazu wer<strong>de</strong>n die virtuellen Figuren als sich entwickeln<strong>de</strong> Charaktere mit<br />
verän<strong>de</strong>rlichen Biografien, kulturell und materiell spezifischen Erfahrungen, Beziehungen<br />
und Möglichkeiten dargestellt. Mit Hilfe dieser künstlerischen Strategien setzt<br />
Suchman Praktiken <strong>de</strong>r „artful integration“ gegen die vorherrschen<strong>de</strong> Sicht technologischer<br />
Entitäten als einem jeweils homogenen, feststehen<strong>de</strong>n System ab.<br />
Suchman begreift die von ihr vorgestellten Projekte als Gegenmo<strong>de</strong>lle zu <strong>de</strong>m<br />
Konzept <strong>de</strong>s autonomen, rationalen Subjekts, das insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n menschenähnlichen<br />
Maschinen <strong>de</strong>r künstlichen Intelligenzforschung (aber auch an<strong>de</strong>ren Ansätzen<br />
<strong>de</strong>r Informatik) zugrun<strong>de</strong> gelegt ist und mit Männlichkeit, Weißsein, Oberschichtzugehörigkeit<br />
etc. assoziiert wird, wie Feministinnen aufgezeigt haben. Sie liest die<br />
skizzierten Projekte aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Technikforschung, Computer Supported<br />
Cooperative Work und Medienkunst auf <strong>de</strong>r Folie von Barads Ansatz als Beispiele<br />
eines neuen Verständnisses <strong>de</strong>r Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine: „‚[T]he<br />
interface‘ becomes a name for a category of contingently enacted cuts always occurring<br />
within sociomaterial practices, that effect ‚person‘ and ‚machine‘ as different<br />
entities, and that in turn enable particular forms of subject-object intra-actions. At the<br />
same time, the singularity of ‚the interface‘ explo<strong>de</strong>s into a multiplicity of more or less<br />
closely aligned, dynamically configured moments of encounter within sociomaterial<br />
configurations, objectified as persons and machines“ (Suchman 2007, 268)<br />
Für Suchman ist entschei<strong>de</strong>nd, wo diese Schnitte in <strong>de</strong>n soziomateriellen Praktiken<br />
jeweils verlaufen, die Menschen und Maschinen als unterschiedlich betreffen, bzw. wo<br />
Grenzen im konkreten Fall gezogen wer<strong>de</strong>n. Denn sie begreift diese Grenzziehungen<br />
als Orte, an <strong>de</strong>nen eine Kritik von Seiten <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung,<br />
ansetzen kann. Meines Erachtens kann hier ebenso eine alternative Technikgestaltung<br />
138<br />
CAD be<strong>de</strong>utet Computer Ai<strong>de</strong>d Design. Unter diesem Begriff wer<strong>de</strong>n Programme gefasst, die das technische<br />
Zeichnen unterstützen.<br />
139<br />
Vgl. hierzu auch ihre Ausführungen in Suchman 2002a.<br />
72
anschließen. „This work of cutting the network is […] a foundational move in the<br />
creation of sociomaterial assemblages as objects of analysis or intervention“ (ebd.,<br />
283). In <strong>de</strong>n Fällen von Robotern, autonomen Maschinen o<strong>de</strong>r individueller Menschen,<br />
wo die Schranken eng gesetzt wer<strong>de</strong>n, gelte es, <strong>de</strong>n Rahmen zu erweitern: „Our task<br />
as analyst is then to extend then frame, to metaphorically zoom out to a wi<strong>de</strong>r view that<br />
at once acknowledges the magic of effects while explicating the hid<strong>de</strong>n labors and<br />
unruly contingentcies that exceed its bounds.“ (ebd., 283f). Gleichzeitig seien die<br />
Entitäten, Zusammenhänge und Momente ihrer Wirksamkeit historisch und räumlich in<br />
ihren Verbindungen und Netzwerken zu lokalisieren. Um ein gegebenes Arrangement<br />
von Menschen und Artefakten zu verstehen, müssten also die Konfigurationen in<br />
gemeinsamen Geschichte(n) und in <strong>de</strong>n individuellen Biografien <strong>de</strong>r Personen und<br />
Dinge ebenso verortet wer<strong>de</strong>n wie in <strong>de</strong>m erweiterten Netzwerk, das beliebig – aber<br />
sinnvoll – durchschnitten wer<strong>de</strong>n solle in einem praktischen und analytischen Akt <strong>de</strong>r<br />
Grenzziehung, <strong>de</strong>r letztendlich ein höchst politischer ist.<br />
Trennungen seien zwar notwendig, um Be<strong>de</strong>utungen herzustellen, aber – wie Barad<br />
und Haraway betonen – niemals unschuldig. „Because the cuts implied in boundary<br />
work are always agentially positioned rather than naturally occurring, and because<br />
boundaries have real consequences, ‚accountablity is mandotory‘. The accountability<br />
involved is not, however a matter of i<strong>de</strong>ntifying authorship in any simple sense but<br />
rather a problem of un<strong>de</strong>rstanding the effects of particular assemblages and assessing<br />
distributions, for better or worse, that they perform“ (Suchman 2007, 285).<br />
In „Human-Machine Reconfigurations“ (2007) wen<strong>de</strong>t Suchman zwar Barads For<strong>de</strong>rung,<br />
menschliche AutorInnenschaft bei <strong>de</strong>r Entstehung von Messwerten über die<br />
Natur in asymmetrischer Weise anzuerkennen, primär auf ihre eigene wissenschaftliche<br />
Position als Wissenschafts- und Technikforscherin an. 140 Jedoch ist dies aufgrund<br />
<strong>de</strong>r breiten Rezeption ihres frühen Ansatzes in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung<br />
eher als eine Verschiebung zu verstehen, die ein von ihrer Seite zusätzliches Anliegen<br />
ausdrückt. Auch ihr langjähriges Engagements für die Entwicklung <strong>de</strong>r Bereiche<br />
„Computer Supported Cooperative Work“ und „Participatory Design“ innerhalb <strong>de</strong>r<br />
Informatik zeigt, dass sie Verantwortung nicht nur bei <strong>de</strong>njenigen verortet, die die<br />
Analysen <strong>de</strong>r hybri<strong>de</strong>n menschlich-nichtmenschlichen Netzwerke durchführen, d.h. bei<br />
<strong>de</strong>n sozialwissenschaftlichen Wissenschafts- und TechnikforscherInnen, son<strong>de</strong>rn<br />
ebenfalls bei <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen. In diesem Sinne lässt sich ihr Ansatz<br />
direkt für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte in Anspruch nehmen, das für eine an<strong>de</strong>re<br />
materielle Gestaltung von Technologien plädiert und damit einen Zugang zur<br />
Konstruktion <strong>de</strong>r Artefakte erfor<strong>de</strong>rt. Zugleich gibt Suchman wertvolle Hinweise für die<br />
Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte, die eine notwendige Voraussetzung<br />
<strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring darstellt. Für die Untersuchung <strong>de</strong>r Prozesse, wie Ungleichheit in<br />
Artefakte eingeschrieben wird, die im nächsten Kapitel Gegenstand sind, können wir<br />
140 In <strong>de</strong>r Einleitung ihres Buch legt sie offen, dass die Neuauflage auf eine LeserInnenschaft aus <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Wissenschafts- und Technikforschung gerichtet ist und sie dort die primäre Zielgruppe<br />
<strong>de</strong>s Buches sieht: „Somewhat ironically, my location at PARC and the marketing of the original text<br />
as a contribution in computer science have meant that the book [her first book: Plans and Situated Actions<br />
(1987), Anm. C.B.] received much greater visibility in computing – particularly HCI – and in cognitive<br />
science than either in anthropology or STS. Although I am <strong>de</strong>eply appreciative of that rea<strong>de</strong>rship and the<br />
friends from whom I have learned within those communities, it is as a contribution to science and technology<br />
studies that the present volume is most <strong>de</strong>liberately <strong>de</strong>signed” (Suchman 2007, 7).<br />
73
von ihrem Zugang lernen, dass Trennlinien bei <strong>de</strong>r Analyse von Netzwerken sorgfältig<br />
und verantwortungsvoll zu ziehen sind. Als Geschlechterforscherin in <strong>de</strong>r Informatik<br />
käme es <strong>de</strong>mzufolge nicht nur darauf an, die Wie<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>r immergleich erscheinen<strong>de</strong>n<br />
Festschreibung <strong>de</strong>s Geschlechtlichen (o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren Ungleichheitsstruktur)<br />
herauszuarbeiten. Vielmehr sind auch die Grenzziehungen für die Analyse so<br />
vorzunehmen, dass Ambivalenzen und Überschreitungen traditioneller Grenzziehungen<br />
sichtbar und somit Wege zu <strong>einer</strong> alternativen Nutzung und Gestaltung von<br />
Technologien aufgezeigt und offen gehalten wer<strong>de</strong>n können.<br />
Wie Barad legt Suchman Wert darauf, dass diese Brüche und Auflösungen in <strong>de</strong>n<br />
Artefakten und <strong>de</strong>n Technowissenschaften selbst i<strong>de</strong>ntifiziert wer<strong>de</strong>n. Sie wen<strong>de</strong>t sich<br />
damit gegen die in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung verbreitete<br />
Ten<strong>de</strong>nz, bei <strong>de</strong>r Analyse stehen zu bleiben, statt beispielsweise dadurch zu intervenieren,<br />
dass <strong>kritisch</strong>e Stimmen innerhalb <strong>de</strong>s untersuchten Bereichs hervorgehoben<br />
und auf diese Weise gestärkt wer<strong>de</strong>n. 141 In <strong>de</strong>n von ihr untersuchten Fel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r KI<br />
und Informatik zeigten die skizzierten Fallstudien Alternativen zu <strong>de</strong>n üblichen<br />
Vorgehensweisen auf. Zu diesen Neukonzeptionen gehört es, die Beson<strong>de</strong>rheit von<br />
Menschen, Körpern und Artefakten zu berücksichtigen sowie <strong>de</strong>n kulturell-historischen<br />
Praktiken, durch die die Grenze zwischen Mensch und Maschine wie<strong>de</strong>rholt gezogen<br />
wird, nachzugehen, aber auch die Möglichkeiten und die Politik <strong>de</strong>r Neuverteilung<br />
entlang <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Grenze anzuerkennen. Die Erkundung <strong>de</strong>r Möglichkeiten<br />
<strong>einer</strong> solchen Neuverteilung setzt voraus, nicht bei kategorialen Debatten um<br />
nicht-menschliche Handlungsfähigkeit stehen zu bleiben, da diese Rekonfigurationen<br />
stets soziale Folgen haben. Suchman plädiert dafür, die konkreten Praktiken, durch<br />
welche die Kategorien <strong>de</strong>s Menschlichen und Nichtmenschlichen mobilisiert wer<strong>de</strong>n<br />
und sich ausformen, genauer zu untersuchen. Nicht die Differenz o<strong>de</strong>r Ähnlichkeit von<br />
Mensch und Maschine stehe zur Debatte, son<strong>de</strong>rn die Frage, welche Unterschie<strong>de</strong> in<br />
welcher Situation von Be<strong>de</strong>utung sind: „[W]hen [do] the categories of the human or<br />
machine become relevant, how [are] relations of sameness or difference between them<br />
enacted on particular occasions, and with what discursive and material consequences?“<br />
(Suchman 2007, 2)<br />
Die Politik <strong>de</strong>r Neuverteilung entlang <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Grenze erfor<strong>de</strong>rt<br />
Suchman zufolge auch, die theoretischen Debatten um menschliche und nichtmenschliche<br />
Handlungsfähigkeit neu zu positionieren. Suchmans Konzept von „Agency“<br />
schließt an die dargestellten Ansätze Wissenschafts- und TechnikforscherInnen an<br />
und lässt sich als reflektierte Übersetzung von Barads asymmetrischen Verständnisses<br />
<strong>de</strong>s Mensch-Maschine-Verhältnisse auf informatische Artefakte begreifen. Sie verdient<br />
im Kontext dieses Kapitels beson<strong>de</strong>re Beachtung.<br />
Suchman geht im Anschluss an Latour, Haraway und an<strong>de</strong>ren davon aus, dass die<br />
Frage, ob Maschinen wie Menschen han<strong>de</strong>ln können, falsch gestellt sei. Denn sie<br />
setzte die Annahme „to be human is to possess agency“ (Suchman 2007, 228) voraus<br />
und wür<strong>de</strong> von dort ausgehend weiter fragen, wem o<strong>de</strong>r was diese Eigenschaften noch<br />
zugestan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n sollten. Statt jedoch zu <strong>de</strong>finieren, was Mensch und was Maschine<br />
sei, stelle sich eher die Frage, was historisch als – menschliche o<strong>de</strong>r nicht-<br />
141 Ein Beispiel für diese Strategie <strong>de</strong>r Sichtbarmachung <strong>kritisch</strong>er Ansätze habe ich in Bath 2009 am Beispiel<br />
von Emotionen in <strong>de</strong>r Softwareagenten- und Interface-Forschung ausgeführt.<br />
74
menschliche – Handlungsfähigkeit bestimmt wur<strong>de</strong> und welche Kriterien dazu bis heute<br />
herangezogen wer<strong>de</strong>n, um Menschlichkeit (in Abgrenzung zu Maschinen o<strong>de</strong>r auch<br />
Tieren) zu <strong>de</strong>finieren (vgl. Suchman 2007, 228). 142 Dazu sei das Verhältnis von<br />
Mensch und Maschine insgesamt als gegenseitige Konstituierung zu begreifen, d.h. als<br />
einen Prozess <strong>de</strong>r gleichzeitigen Verän<strong>de</strong>rung von Mensch und Maschine. Die<br />
Aussage, dass sich Mensch und Artefakte gegenseitig konstituieren, darf ihres Erachtens<br />
jedoch nicht als leere Formel stehen bleiben. Sie be<strong>de</strong>ute vielmehr, die<br />
dynamischen und multiplen Formen <strong>de</strong>r Konstituierung innerhalb spezifischer „sociomaterial<br />
assemblages“ (Suchman 2007, 283) genauer zu untersuchen, aber auch<br />
Fragen <strong>de</strong>r Differenz von Mensch und Maschine, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Asymmetrie<br />
nachzugehen. Denn Gegenseitigkeit hieße nicht notwendigerweise Symmetrie. „My<br />
own analysis 143 suggests that persons and artefacts do not constitute each other in the<br />
same way. In particular, I would argue that we need a rearticulation of symmetry, or<br />
more impartially perhaps, dissymmetry, that somehow retains the recognition of<br />
hybrids, cyborgs and quasi-objects ma<strong>de</strong> visible through science studies, while<br />
simultaneously recovering certain subject-object positionings – even or<strong>de</strong>rings –<br />
among persons and artifacts and their consequences“ (Suchman 2007, 269). Es käme<br />
darauf an, die beson<strong>de</strong>re Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>s Menschen anzuerkennen, ohne<br />
dabei die Differenz zwischen Mensch und Maschine zu essentialisieren. Handlungsfähigkeit<br />
müsse in <strong>de</strong>r Hinsicht neu konzeptualisiert wer<strong>de</strong>n, so dass die spezifische<br />
Verantwortung menschlicher AkteurInnen lokalisierbar bleibt, zugleich aber auch <strong>de</strong>ren<br />
Untrennbarkeit von <strong>de</strong>m soziomateriellen Netzwerk anerkannt wird, durch das bei<strong>de</strong><br />
Seiten konstituiert wer<strong>de</strong>n. Suchman betont, dass die beharrliche Präsenz <strong>de</strong>r<br />
Dichotomie von Designern und Usern im technowissenschaftlichen Diskurs kein<br />
wi<strong>de</strong>rständiges Überbleibsel <strong>de</strong>s Humanismus sei. Vielmehr wür<strong>de</strong> diese die anhalten<strong>de</strong><br />
Asymmetrie zwischen menschlichen und nichtmenschlichen AkteurInnen wi<strong>de</strong>rspiegeln.<br />
„[I]n the case of technological assemblages, persons are those actants who<br />
configure material-semiotic networks, however much we may be simultaneously<br />
incorporated into and through them“ (Suchman 2007, 270).<br />
Suchmans Konzeption zur Handlungsfähigkeit technischer Objekte stellt eine tragfähige<br />
Grundlage für das Vorhaben dar, das Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte theoretisch zu fassen. Denn menschliche und nichtmenschliche<br />
AkteurInnen wer<strong>de</strong>n hier – wie in <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie – in ihren vielfältigen<br />
Verbindungen gedacht, wobei jedoch die kulturell und historisch begrün<strong>de</strong>ten<br />
Differenzen zwischen diesen berücksichtigt und auch vorherrschen<strong>de</strong> Hierarchien<br />
sowie strukturell-symbolische Ordnungen menschlicher Gemeinschaften innerhalb <strong>de</strong>r<br />
je spezifischen Verbindung anerkannt wer<strong>de</strong>n. Damit <strong>de</strong>nkt sie in ihren Ausführungen<br />
zum Problem <strong>de</strong>r (Re-)Konfiguration <strong>de</strong>s Humanen durch die Technowissenschaften<br />
142 Suchman weist darauf hin, das es in <strong>de</strong>n letzten Jahren eine Verschiebung gegeben hat, das Humane<br />
nicht mehr nur in Abgrenzung zu Tieren, son<strong>de</strong>rn an <strong>de</strong>r Differenz zu Maschinen festzumachen. „Efforts to<br />
establish criteria of humanness (for example, tool use, language ability, symbolic representation) have always<br />
been contentious, challenged principally in terms of capacities of other animals, particularly nonhuman<br />
primates, to engage in various cognate behaviors. More recently the same kinds of criterial arguments<br />
have been ma<strong>de</strong> in support of human-like capabilities of artificially intelligent machines” (Suchman<br />
2007, 228).<br />
143 Damit bezieht sie sich auf ihre eigene, in <strong>de</strong>r Informatik viel rezipierte Studie „Plans and situated ac-<br />
tions“ (Suchman 1987).<br />
75
stets mit, wie sich Politik, Soziales und Geschlecht in informatischen Artefakten<br />
manifestiert. 144<br />
Das Potential ihres Ansatzes liegt meines Erachtens gera<strong>de</strong> darin, von <strong>de</strong>r<br />
komplexen Verwobenheit menschlicher und nicht-menschlicher AkteurInnen auszugehen,<br />
gleichzeitig aber – aufgrund asymmetrischer AutorInnenschaft – die spezifischen<br />
menschlichen (Teil-)Verantwortlichkeiten darin i<strong>de</strong>ntifizieren zu können. Es wird<br />
möglich, die Ansätze <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie mit ihren nützlichen Werkzeugen für<br />
die Untersuchung hybri<strong>de</strong>r Netzwerke zusammen mit Analysen strukturell-symbolischer<br />
Ungleichheit in (menschlichen) Gesellschaften einschließlich <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
Geschlechterordnung zu <strong>de</strong>nken. Dieses Vorhaben ist bereits bei Haraway angelegt,<br />
erschien allerdings in ihrer Version (wie aufgezeigt) nicht unmittelbar auf die Informatik<br />
anwendbar. Mit Suchmans Ansatz kann dagegen auf Studien, die wie Winners<br />
Brücken auf die Politik <strong>de</strong>r Artefakte verweisen, zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n, diesmal<br />
jedoch in einem reformulierten Sinne, <strong>de</strong>r um die in diesem Kapitel skizzierten Diskussionen<br />
ergänzt und bereichert wur<strong>de</strong>. Gegenüber <strong>de</strong>m Social Shaping of Technology-<br />
Ansatz und <strong>de</strong>m Social Construction of Technology-Ansatz wird diesen Einschreibungen<br />
von Ungleichheitsstrukturen und von Geschlecht jedoch ein neuer Platz<br />
zugewiesen, <strong>de</strong>r diese Politiken im Rahmen <strong>de</strong>s jeweiligen komplexen Netzwerks<br />
verortet und ihre Erklärungskraft in <strong>de</strong>r Regel konkretisiert und neu positioniert.<br />
Handlungsfähigkeit auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r feministischen Ansätze Barads und Suchmans<br />
be<strong>de</strong>utet zugleich, die Asymmetrie zwischen Menschen und Maschinen anzuerkennen<br />
und ein verantwortungsvolles Han<strong>de</strong>ln einzufor<strong>de</strong>rn.<br />
Was ist nun insgesamt bis hierher für das Vorhaben gewonnen, ein fundiertes<br />
Konzept <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu entwickeln? Welche Vorteile bringt<br />
es, die Politik <strong>de</strong>r Artefakte und ihre Vergeschlechtichung ausgehend von Winner mit<br />
Hilfe <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung, insbeson<strong>de</strong>re mit Haraway,<br />
Barad und Suchman neu zu <strong>de</strong>nken? Wie lassen sich die Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung,<br />
Macht und Verantwortung in Technikgestaltungsprozessen so konzipieren,<br />
dass sie die dargestellten Verhältnisse von Technischem und Sozialem, von Mensch<br />
und Maschine sowie von Handlungsfähigkeit reflektieren? Und wo bleiben weiterhin<br />
Leerstellen, wenn es darum geht, feministische Interventionen an <strong>de</strong>r Grenze von<br />
Mensch und Maschine auf <strong>de</strong>r analytischen Ebene sowie im Sinne <strong>einer</strong> alternativen<br />
materiellen Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte zu konzeptualisieren?<br />
Der bis hierher gewonnene Erkenntnisstand dieses Kapitels lässt sich<br />
folgen<strong>de</strong>rmaßen zusammenfassen: Mit <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie wur<strong>de</strong> ein<br />
Vorschlag gemacht, das Verhältnis von Technik und Gesellschaft in <strong>einer</strong> Weise zu<br />
<strong>de</strong>nken, die technik<strong>de</strong>terministische und sozial<strong>de</strong>terministische Ten<strong>de</strong>nzen in <strong>de</strong>r<br />
Theoriebildung zu vermei<strong>de</strong>n sucht. Allerdings ergab sich aus diesem Ansatz das<br />
weitergehen<strong>de</strong> Problem, wie das Politische in diesem Rahmen verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />
kann, da die ANT diese Frage, an <strong>de</strong>r feministische Positionen notwendigerweise<br />
festhalten müssen, nicht ausreichend löst. Anhand <strong>de</strong>r skizzierten feministischen<br />
Konzepte konnte aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, wie sich die Verantwortung von Wissenschafts-<br />
und TechnikforscherInnen auf die Bühne <strong>de</strong>r menschlichen und nichtmenschlichen<br />
144 Dies spiegelt sich – wie bereits bemerkt – auch darin wi<strong>de</strong>r, dass sie <strong>kritisch</strong>e Gestaltungsvorhaben in<br />
<strong>de</strong>r Informatik Systeme wesentlich unterstützt und insbeson<strong>de</strong>re an <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>s „Participatory<br />
Design“ und <strong>de</strong>s „Computer Supported Cooperative Work“ wesentlich mitgewirkt hat.<br />
76
AkteurInnen bringen lässt. Dabei hat sich insbeson<strong>de</strong>re Karen Barads Ansatz <strong>de</strong>s<br />
„Agential Realism“ als produktiv erwiesen, <strong>de</strong>r nicht nur die Differenz zwischen<br />
Humanem und Materiellen berücksichtigt, son<strong>de</strong>rn von <strong>einer</strong> ontologischen<br />
Asymmetrie zwischen diesen ausgeht. Suchman wie<strong>de</strong>rum hat Barads und z.T. auch<br />
Haraways Vorstellungen auf informatische Artefakte übertragen und auf dieser Basis<br />
eine Neuformulierung von Handlungsfähigkeit vorgeschlagen, die die Rolle von<br />
TechnikgestalterInnen und NutzerInnen betont, diese aber nicht überbewertet. Voraussetzung<br />
dieses Denkens ist die mit Barad vorgenommene Verschiebung hin zu <strong>einer</strong><br />
erkenntnistheoretischen Position, welche Objektivität im Sinne eines Post-Realismus<br />
versteht und mit konstruktivistischen Ansätzen verbin<strong>de</strong>t. Ein weiterer Gewinn <strong>de</strong>r Inanspruchnahme<br />
dieser feministischen Ansätze besteht darin, dass sie nicht nur eine<br />
Basis für die Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten liefern, son<strong>de</strong>rn auf ihre je<br />
spezifische Weise Vorschläge für die diskursiv-materielle Umschreibung <strong>de</strong>r<br />
bestehen<strong>de</strong>n Ungleichheitsverhältnisse machen und damit als Grundlage für die Umsetzung<br />
in ein De-Gen<strong>de</strong>ring-Vorhaben dienen können. Während Haraway primär<br />
dafür plädiert, alternative Geschichte(n) über die Natur- und Technnikwissenschaften<br />
zu erzählen, ermöglichen die Ansätze Barads und Suchmans aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik, praktisch umsetzbare Interventionsmöglichkeiten<br />
in <strong>de</strong>n Artefakten und ihrer technowissenschaftlichen Produktion selbst<br />
auszumachen. Suchman stellt darüber hinaus alternative Konzepte vor, die sich als<br />
Gegenmo<strong>de</strong>lle zu vorherrschen<strong>de</strong>n, männlich konnotierten Subjektpositionen verstehen<br />
lassen. Die Argumente <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie lieferten, reformuliert durch<br />
die Ansätze von Haraway, Barad und Suchman, ein theoretisches Konzept, das<br />
Dualismen wie Technik und Gesellschaft, Mensch und Maschine, Subjekt und Objekt<br />
sowie Konstruktivismus und Realismus überwin<strong>de</strong>t und dabei einen Raum eröffnet,<br />
Strukturen <strong>de</strong>r Ungleichheit und Macht einschließlich <strong>de</strong>r Geschlechterordnung<br />
wahrzunehmen. Zugleich wird es auf dieser Basis möglich, Verantwortlichkeit bei <strong>de</strong>r<br />
materiell-diskursiven Neugestaltung soziomaterieller Praktiken als einen wesentlichen<br />
Bestandteil aktueller Mensch-Maschine-Verhältnisse zu verstehen.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>s entwickelten theoretischen Rahmenkonzepts bleibt jedoch die Frage,<br />
wie Netzwerke, Verbindungen und Strukturen in <strong>de</strong>m Spannungsfeld von<br />
Festschreibung und Verän<strong>de</strong>rung entstehen, weiterhin offen. Insbeson<strong>de</strong>re fehlt <strong>de</strong>m<br />
bis hierher dargestellten Ansatz bislang eine Vorstellung, wie sich <strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>r<br />
Verwicklung von Technologie als materiell-diskursives Phänomen mit Ungleichheitsstrukturen<br />
und Geschlecht informatikspezifisch begreifen lässt. Um diese Lücke zu<br />
schließen, stelle ich im folgen<strong>de</strong>n Kapitel 3.7 zunächst Konzepte zur Repräsentation<br />
von NutzerInnen aus <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung vor, welche die<br />
Einschreibung <strong>de</strong>s Sozialen und von Geschlecht in Technologiegestaltungs- und -<br />
nutzungsprozessen beschreiben. Da die dort vorgestellten Skript- und Konfigurierungskonzepte<br />
jedoch nicht umfassend genug erscheinen, um Grundlagenforschung und<br />
aktuelle Informatikentwicklungen zu erfassen, bei <strong>de</strong>nen die Grenzen zwischen<br />
Mensch und Maschine zunehmend verschwimmen, wird anschließend eine weitere<br />
grundlegen<strong>de</strong> theoretische Konzeption eingeführt. Es wird dargelegt, wie mit Barads<br />
und Suchmans Konzept <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Materie/Technologie und<br />
Geschlecht, die <strong>de</strong>n Performativitätsbegriff Butlers posthumanistisch transformieren,<br />
eine Konzeptualisierung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte entwickelt<br />
77
wer<strong>de</strong>n kann, die an die in diesem Kapitel ausgeführte feministische Reformulierung<br />
hybri<strong>de</strong>r Netzwerke anschlussfähig ist und sich – inspiriert durch Suchman – auf die<br />
Informatik übertragen lässt.<br />
3.7. Wie kommt Geschlecht in technische Artefakte „hinein“?<br />
Gen<strong>de</strong>rskripte und Konfigurationen von NutzerInnen<br />
Eines <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung bekanntesten Konzepte,<br />
<strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten zu fassen, ist das <strong>de</strong>s „gen<strong>de</strong>r scripts“,<br />
welches von Ellen van Oost (1995) und Nelly Oudshoorn (1996) in die Diskussion<br />
gebracht wur<strong>de</strong> und vor allem durch Els Rommes Studie zur Digitalen Stadt<br />
Amsterdam (vgl. Rommes 2002) bekannt gewor<strong>de</strong>n ist. Dieser Begriff stellt die<br />
Verhältnisse von Gestaltung und Nutzung in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund und berücksichtigt die<br />
Materialität technologischer Artefakte. Das Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskripts basiert auf <strong>de</strong>m<br />
Begriff <strong>de</strong>s „Skripts“, <strong>de</strong>r von Ma<strong>de</strong>leine Akrich (1992, 1995) in <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-<br />
Theorie eingeführt wur<strong>de</strong>. Der Skript-Ansatz zielt darauf, zu beschreiben, wie technische<br />
Objekte „participate in building heterogeneous networks that bring together<br />
actants of all types and sizes, whether humans or nonhumans“ (Akrich 1992, 206).<br />
Dabei wird darauf fokussiert, zu verstehen, wie TechnologiegestalterInnen ihre Vorstellungen<br />
über die zukünftigen NutzerInnen und Nutzungen in die technologischen Artefakte<br />
einschreiben. Es wird von <strong>de</strong>r Annahme ausgegangen, dass sie im Laufe <strong>de</strong>s<br />
Technikgestaltungsprozesses stets eine Vielfalt von Visionen entwickeln, die sich<br />
letztendlich in <strong>de</strong>n Artefakten manifestieren. „They construct many different representtations<br />
of these users, and objectify these representations in technical choices“ (Akrich<br />
1995, 168). Diese Konstruktionen <strong>de</strong>r NutzerInnen können auf expliziten Repräsentationstechniken<br />
beruhen, wie beispielsweise auf Marktanalysen, Brauchbarkeitstests<br />
(Usability Tests) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m nachträglichen Feedback auf reale Nutzungssituationen <strong>de</strong>s<br />
technischen Produkts. Sie können allerdings auch auf impliziten Repräsentationstechniken<br />
grün<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen die ExpertInnen im Namen <strong>de</strong>r NutzerInnen sprechen.<br />
Dazu gehört beispielsweise <strong>de</strong>r Rückgriff auf persönliche Erfahrungen, bei <strong>de</strong>m die<br />
TechnologiegestalterInnen ihre professionelle Perspektive durch eine Laienperspektive<br />
eintauschen und sich selbst als VertreterIn <strong>de</strong>r NutzerInnen einsetzen (vgl. Akrich<br />
1995, 173). Auf all diesen Wegen versuchen TechnikgestalterInnen, ihre Visionen <strong>de</strong>r<br />
zukünftigen Nutzung <strong>de</strong>r Technologie „einzuschreiben“: „Designers […] <strong>de</strong>fine actors<br />
with specific tastes, competences, motives, aspirations, political prejudices, and the<br />
rest, and they assume that morality, technology, science, and economy will evolve in<br />
particular ways. A large part of the work of innovators is that of ‚inscribing‘ this vision of<br />
(or prediction about) the world in the technical content of the new object. I will call the<br />
end product of this work ‚script‘ or ‚scenario‘.“ (Akrich 1992, 208)<br />
Feministische TechnikforscherInnen erweiterten Akrichs Skript-Konzept um die Analysekategorie<br />
Geschlecht: „Given the heterogeneity of users, <strong>de</strong>signers will consciously<br />
or unconsciously privilege certain representations of users and use over others. When<br />
these representations and the resulting scripts reveal a gen<strong>de</strong>red pattern, we call them<br />
‚gen<strong>de</strong>r scripts‘“ (Rommes 2002, 17f). Ein Gen<strong>de</strong>rskript liegt also dann vor, wenn TechnologiegestalterInnen<br />
ausgehend von <strong>de</strong>r Vielfalt und Wi<strong>de</strong>rsprüchlichkeit möglicher<br />
78
Repräsentationen eine Auswahl treffen, die Geschlecht konstituieren<strong>de</strong> Muster<br />
aufweist. Diese Muster <strong>de</strong>r Geschlechtlichkeit können auf symbolischen, strukturellen<br />
o<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntitären Ebenen liegen. 145 Rommes unterschei<strong>de</strong>t dabei zwischen expliziten<br />
und impliziten Repräsentationen <strong>de</strong>r NutzerInnen, die durch bewußte bzw. unbewußte<br />
Entscheidungen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen darüber charakterisiert seien, welche NutzerInnen<br />
und Nutzungsbedingungen in die Technologie eingeschlossen o<strong>de</strong>r auch<br />
ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n. 146 An<strong>de</strong>rs formuliert kann die Kategorie Geschlecht – wie van<br />
Oost (2003) genauer ausführt – in <strong>de</strong>m Sinne ein explizites o<strong>de</strong>r implizites Element <strong>de</strong>s<br />
Technikgestaltungsprozesses sein, dass technische Artefakte zumeist entwe<strong>de</strong>r für<br />
Frauen bzw. Männer o<strong>de</strong>r „für alle“ konzipiert sind. Wer<strong>de</strong>n technische Produkte für<br />
Frauen bzw. für Männer, d.h. für eine bestimmte Zielgruppe, gestaltet, so sei das<br />
Gen<strong>de</strong>ring in <strong>de</strong>r Regel ein expliziter Prozess, durch <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r gar<br />
stereotypisierte Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit in technische Spezifikationen<br />
übersetzt wür<strong>de</strong>n, die mit <strong>de</strong>n hegemonialen kulturellen Symbolsystemen von<br />
Weiblichkeit bzw. Männlichkeit übereinstimmen. Gen<strong>de</strong>rskripte könnten aber auch aus<br />
impliziten Prozessen hervorgehen, bei <strong>de</strong>nen die Artefakte für „Je<strong>de</strong>/n“ gestaltet<br />
wer<strong>de</strong>n, ohne dass die GestalterInnen spezifische NutzerInnengruppen im Sinn haben.<br />
Feministische TechnikforscherInnen wie Els Rommes haben aufgezeigt, dass dort, wo<br />
Technologie „für alle“ entwickelt wer<strong>de</strong>n soll, die GestalterInnen häufig unbewußt<br />
einseitige männliche NutzerInnenbil<strong>de</strong>r haben und auf hegemoniale Männlichkeitsvorstellungen<br />
zurückgreifen (vgl. etwa Rommes 2002, Oudshoorn et al. 2004). Sie<br />
folgten häufig <strong>de</strong>r so genannten „I-methodology“ (vgl. Akrich 1995, 173, Rommes 2000,<br />
Oudshoorn/ Pinch 2003a), in<strong>de</strong>m sie sich selbst als potentielle NutzerInnen imaginierten<br />
und <strong>de</strong>mzufolge männlich kodierte Symbole und Kompetenzen in die Artefakte<br />
einschrieben. Darüber hinaus wür<strong>de</strong>n auch die Tests <strong>de</strong>r Produkte oft in ihrem<br />
eigenen, von Männern dominierten Umfeld durchgeführt. „In such cases, the user<br />
representation that <strong>de</strong>signers generate is one-si<strong>de</strong>d, emphasizing the characteristics of<br />
the <strong>de</strong>signers themselves and neglecting the diversity of the envisioned user group.<br />
Configuring the user as ‚everybody‘ in practice often leads to a product that is biased<br />
toward young, white, well-educated male users, reflecting the composition of the<br />
<strong>de</strong>signer’s own group“ (van Oost 2003, 196).<br />
Demnach lassen sich Technologien ausgehend von <strong>de</strong>n ANT-Ansätzen als Akteure<br />
in <strong>de</strong>r konkreten Nutzungssituation auffassen, die bestimmte Interpretationen und<br />
Be<strong>de</strong>utungszuweisungen nahe legen. Häufig führe dies dazu, dass das in <strong>de</strong>m<br />
technischen Artefakt eingeschriebene Gen<strong>de</strong>rskript durch die Nutzung aufrechterhalten<br />
und verfestigt wird. Dies be<strong>de</strong>utet jedoch nicht, dass die NutzerInnen <strong>de</strong>m Skript<br />
bedingungslos ausgeliefert sind und diesem notwendigerweise folgen müssen, um das<br />
Artefakt sinnvoll nutzen zu können. „Clearly the impact of gen<strong>de</strong>r scripts is neither<br />
<strong>de</strong>termined by the artifact nor stable. Gen<strong>de</strong>r is an analytical category, the content of<br />
which is constantly negotiated, and objects with inscribed gen<strong>de</strong>r relations are actors in<br />
these negotiation processes. Obviously, scripts cannot <strong>de</strong>termine the behaviour of<br />
145<br />
Somit greift Rommes auf die dreidimensionale Charakterisierung von Geschlecht zurück, die Sandra<br />
Harding 1990 [1986] vorgeschlagen hat.<br />
146<br />
Dieses Verständnis von Gen<strong>de</strong>rskripten Definition ermöglicht es, nicht nur vergeschlechtlichte Muster ,<br />
son<strong>de</strong>rn Ein- und Ausschlüsse aufgrund weiterer Kategorien in <strong>de</strong>n Blick zu bekommen: „Just as for<br />
gen<strong>de</strong>r, we can analyze the ‚age-scripts‘, the ‚racial scripts‘, the ‚sexual-preference-script‘, the ‚physical<br />
requirements-script‘ or the ‚educatonal-script‘ of a technology“ (Rommes 2002, 18).<br />
79
users, their attribution of meaning or the way they use the object to construct their<br />
i<strong>de</strong>ntity, as this would lead to technological <strong>de</strong>terminism. Users don’t have to accept<br />
the script, it is possible for them to reject or adapt it. Gen<strong>de</strong>r scripts do not force users<br />
to construct specific gen<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntities, but scripts surely act invitingly and/or inhibitantly“<br />
(van Oost 2003, 196).<br />
Ein Gen<strong>de</strong>rskript ist <strong>de</strong>mzufolge nicht als ein fixer Ablauf o<strong>de</strong>r eine Vorschrift,<br />
welche die I<strong>de</strong>ntitäten und Handlungen <strong>de</strong>r NutzerInnen im Detail festschreibt, zu<br />
verstehen. Vielmehr charakterisieren Skripte diejenigen Annahmen <strong>de</strong>r GestalterInnen<br />
über <strong>de</strong>n Nutzungskontext, die in <strong>de</strong>r Technologie materialisiert sind und die Nutzung<br />
vorstrukturieren. Sie grenzen damit <strong>de</strong>n Handlungsspielraum ein: „technical objects<br />
<strong>de</strong>fine a framework of action together with the actors and the space in which they are<br />
supposed to act“ (Akrich 1992, 208). Skripte schreiben <strong>de</strong>n NutzerInnen zwar<br />
spezifische Kompetenzen zu und verteilen Verantwortlichkeiten auf NutzerInnen und<br />
Artefakte. Sie sehen bestimmte Handlungsmöglichkeiten vor und ignorieren an<strong>de</strong>re.<br />
Allerdings ist damit nur die von <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen intendierte Nutzung<br />
beschrieben, <strong>de</strong>r sich die NutzerInnen auch entgegenstellen können. Letzteren wird<br />
Handlungsfähigkeit (agency) zugeschrieben, in<strong>de</strong>m sie das jeweilige Skript akzeptieren<br />
o<strong>de</strong>r auch verän<strong>de</strong>rn bzw. zurückweisen können. Insbeson<strong>de</strong>re dann, wenn die<br />
EntwicklerInnen Repräsentationen von <strong>de</strong>n NutzerInnen konzipieren, die mit <strong>de</strong>n<br />
Kompetenzen, Einstellungen, Handlungen und I<strong>de</strong>ntitätskonzeptionen <strong>de</strong>r tatsächlichen<br />
NutzerInnen nicht übereinstimmen, könnten Akzeptanzprobleme entstehen (vgl.<br />
Akrich 1992). Damit <strong>de</strong>finieren technologische Artefakte zwar die Beziehungen<br />
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen AkteurInnen, jedoch ist „this geography<br />
[…] open to question and may be resisted“ (Akrich 1992, 207). Insofern ist das<br />
Konzept <strong>de</strong>s Skriptes nicht als ein eng technik<strong>de</strong>terministisches zu verstehen, welches<br />
die TechnikgestalterInnen als aktiv und die NutzerInnen als passiv konzipiert. Vielmehr<br />
berücksichtigt es die vielfältigen, z.T. auch wi<strong>de</strong>rsprüchlichen Aneignungsprozesse von<br />
Technologien durch die NutzerInnen, die auch in von <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen nicht<br />
intendierte Formen <strong>de</strong>r Nutzung mün<strong>de</strong>n können. 147<br />
Um technik<strong>de</strong>terministische Positionen zu vermei<strong>de</strong>n, mahnt Akrich an, die<br />
Verhandlungen zwischen GestalterInnen und NutzerInnen, d.h. <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r<br />
Technologieentwicklung, genauer zu untersuchen: „if we are interested in technical<br />
objects and not in chimerae, we cannot be satisfied methodologically with the<br />
<strong>de</strong>signer’s or user’s point of view alone. Instead we have to go back and forth<br />
continually between the <strong>de</strong>signer and the user, between the <strong>de</strong>signer’s projected user<br />
and the real user, between the world inscribed in the object and the world <strong>de</strong>scribed by<br />
its displacement“ (Akrich 1992, 208f, Hervorhebung im Orig.). Um letztere zu<br />
beschreiben, führt sie <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r „<strong>de</strong>-scription“ (ebd., 205ff) ein, <strong>de</strong>r die<br />
Rekonstruktionsarbeit charakterisiert, um das kohärente Handlungsprogramm im<br />
147 Heutzutage ist es in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung verbreitet, die unintendierten Nutzungen<br />
genauer in <strong>de</strong>n Blick zu nehmen. So beschreiben Nelly Oudshoorn und Trevor Pinch in ihrer Einleitung<br />
„How Users and Non-Users Matter“: „New uses are always found for familiar technologies. Sometimes<br />
changes in use are dramatic and unexpected. Before September 11, 2001, no one foresaw that an<br />
airliner could be turned by a small number of its occupants into a giant Molotov cocktail. After the Gulf war<br />
of 1991, it was discovered that an effective way to put out oil-rig fires was to strap down captured Mig jets<br />
and blow out the fires using their exhaust. Such examples remind us that we can never take the use of a<br />
technology for granted“ (Oudshoorn/ Pinch 2003b, 1).<br />
80
technologischen Artefakt wie<strong>de</strong>rherzustellen. Diese kann durch die<br />
TechnikforscherInnen o<strong>de</strong>r NutzerInnen erfolgen, welche das jeweilige Skript lesen und<br />
interpretieren bzw. sinnvoll in ihre Interaktion mit <strong>de</strong>r Technologie einzubetten haben.<br />
Während VertreterInnen von ANT die De-Skription stärker auf Seiten <strong>de</strong>r TechnikforscherInnen<br />
verorten (vgl. etwa Akrich/ Latour 1992), versucht Rommes, Skripte als<br />
Vermittlungen zwischen <strong>de</strong>m Gestaltungskontext, in <strong>de</strong>m NutzerInnenrepräsentationen<br />
produziert wer<strong>de</strong>n, und <strong>de</strong>m Nutzungskontext, in <strong>de</strong>m ein soziotechnisches Netzwerk<br />
von (realen) NutzerInnen hergestellt wird, zu verstehen (vgl. Rommes 2002, 16).<br />
Skripte hätten <strong>de</strong>mnach Auffor<strong>de</strong>rungscharakter („affordances“), tragen also durch die<br />
Technologie ein bestimmtes Angebot an die NutzerInnen heran. Jedoch bergen sie<br />
zugleich Einschränkungen <strong>de</strong>r Nutzungsweise, die in <strong>de</strong>m Artefakt in Form technologisch<br />
eingeschränkter Wahlmöglichkeiten inkorporiert sind.<br />
Akrichs Skript-Konzept wur<strong>de</strong> kritisiert, weil es auf das Verhältnis von<br />
GestalterInnen und NutzerInnen von Technologien fokussiert und an<strong>de</strong>re AkteurInnen<br />
<strong>de</strong>s sozio-technischen Netzwerkes, z.B. EntscheidungsträgerInnen, GeldgeberInnen,<br />
JournalistInnen und soziale Bewegungen vernachlässige (vgl. Rommes 2002, 17,<br />
siehe auch Mackay et al. 2000, Oudshoorn/ Pinch 2003a, 9). Dieser Einwand muss bei<br />
<strong>de</strong>r Analyse von Gen<strong>de</strong>ringprozessen in <strong>de</strong>r Tat mitbedacht wer<strong>de</strong>n. Die Vergeschlechtlichung<br />
von Artefakten erfolgt nicht nur auf Seiten <strong>de</strong>r Technologiegestaltung,<br />
son<strong>de</strong>rn innerhalb eines umfassen<strong>de</strong>ren soziotechnischen Netzwerkes, in das auch<br />
NutzerInnen und verschie<strong>de</strong>nste weitere AkteurInnen eingebettet sind. Es ist jedoch<br />
genau <strong>de</strong>r Schwerpunkt Akrichs, <strong>de</strong>n Gestaltungsprozessen von Technologie<br />
nachzugehen, <strong>de</strong>r ihren Ansatz für das hier verfolgte Vorhaben, <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Artefakte im Kontext <strong>de</strong>r Informatik zu begreifen, attraktiv<br />
macht. Um einen handlungstheoretischen Ansatz für die Informatik zu entwickeln, <strong>de</strong>r<br />
nicht nur auf die Analyse <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>ringprozesse, son<strong>de</strong>rn auch auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>de</strong>r Artefakte zielt, ist es notwendig, die Analyse auf die Technikgestaltungsprozesse<br />
zu konzentrieren, ohne aber die Beteiligung und Wirkmächtigkeit an<strong>de</strong>rer AkteurInnen<br />
<strong>de</strong>s sozio-materiellen Netzwerkes zu negieren.<br />
Das Skriptkonzept wur<strong>de</strong> darüber hinaus von feministischer Seite dahingehend kritisiert,<br />
dass es die konkreten Prozesse, durch die Technologien akzeptiert, verän<strong>de</strong>rt<br />
o<strong>de</strong>r abgelehnt wer<strong>de</strong>n, nicht genügend <strong>de</strong>tailliert herausarbeiten wür<strong>de</strong> (vgl. Rommes<br />
2002, 17). So legten implizite, <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess durchdringen<strong>de</strong> Skripte, welche<br />
die Vorlieben, Kompetenzen und Interessen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen spiegeln, zwar<br />
nahe, dass bestimmte soziale Gruppen (z.B. Ältere, Frauen, Menschen an<strong>de</strong>rer kultureller<br />
o<strong>de</strong>r sozialer Herkunft als die <strong>de</strong>r GestalterInnen) davon abgehalten wer<strong>de</strong>n, die<br />
entsprechen<strong>de</strong> Technologie zu nutzen. Allerdings wür<strong>de</strong>n die spezifischen Mechanismen,<br />
die zu Einschlüssen und Ausschlüssen bestimmter NutzerInnen führten, von<br />
Akrich selbst nicht ausreichend beachtet. Ferner wirft Rommes <strong>de</strong>m Skript-Konzept ein<br />
Blackboxing potentieller Anwen<strong>de</strong>rInnen <strong>de</strong>r Technologie vor. Denn Akrich ginge zwar<br />
von komplexen, vielseitigen NutzerInnen aus, die sich in <strong>einer</strong> heterogenen Vielfalt von<br />
Beziehungen bewegten (vgl. Akrich 1995, 167), jedoch beschreibe sie nicht die Folgen<br />
dieser jeweiligen Verortungen. Die Grün<strong>de</strong> und Konsequenzen für NutzerInnen und<br />
Nicht-NutzerInnen seien sorgfältig zu analysieren. Gera<strong>de</strong> aufgrund <strong>de</strong>r angenommenen<br />
Diversität <strong>de</strong>r NutzerInnen stelle sich die Frage, welche sozialen Gruppen eine<br />
Technologie so annehmen, wie sie von <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen intendiert war,<br />
81
und welche diese neu formen, sich an<strong>de</strong>rs aneignen o<strong>de</strong>r auch ablehnen. Akrichs<br />
Ansatz ignoriere jedoch , dass bestimmte Technologien von <strong>einer</strong> großen Gruppe<br />
potentieller NutzerInnen nicht akzeptiert und genutzt wer<strong>de</strong>. Das Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskripts<br />
beansprucht, dieser Kritik Rechnung zu tragen (vgl. Rommes 2002, 17).<br />
Rommes ist sich <strong>de</strong>r Gefahr <strong>de</strong>r Reproduktion von Geschlechterdifferenz durchaus<br />
bewusst, wenn sie sich auf soziologische Konzepte wie Connells Begriff <strong>de</strong>r „hegemonialen<br />
Männlichkeit“ (Connell 1987) bezieht: “[A] gen<strong>de</strong>r script will rarely be the result<br />
of conscious attempts of <strong>de</strong>signers to exclu<strong>de</strong> certain users. Rather, it will be the result<br />
of unconscious repetitions and reiterations of the hegemonic masculine norm” (Rommes<br />
2002, 19). Sie nutzt diesen Ansatz, um geschlechtliche Konnotationen <strong>de</strong>s Wissens,<br />
<strong>de</strong>r Vorlieben, Fähigkeiten und Bedürfnisse, die in <strong>de</strong>r Technologie normalisiert<br />
sind, zu beschreiben. Dabei geht sie davon aus, dass TechnikgestalterInnen zu solchen<br />
Skripten tendieren, die hegemoniale Männlichkeit repräsentieren, während sie<br />
ihres Erachtens nicht dazu neigten, Weiblichkeit o<strong>de</strong>r untergeordnete, alternative Formen<br />
von Männlichkeit in die Artefakte einzuschreiben. Das heiße jedoch nicht, dass<br />
Frauen als Gruppe o<strong>de</strong>r bestimmte Gruppen von Frauen aufgrund <strong>de</strong>ssen tatsächlich<br />
von <strong>de</strong>r Nutzung ausgeschlossen seien. „More likely, it means that some women have<br />
to adjust more, have to work har<strong>de</strong>r, in or<strong>de</strong>r to be able to use a certain technology in<br />
present society. A gen<strong>de</strong>r script analysis can thus be specified as a study of ‚mechanisms<br />
of adjustment‘ or the failure to adjust between the technology and a potential<br />
user. It is about who has to ‚adjust‘ more, who has to pay the price for not fitting the<br />
norm that is reproduced in the artifact“ (Rommes 2002, 19). Das be<strong>de</strong>utet, dass<br />
menschliche AkteurInnen, die hegemonial-männlichen Normennicht entsprechen, mehr<br />
Arbeit leisten müssen, um sich an die Bedingungen anzupassen, die die Nutzung <strong>de</strong>r<br />
Technologie erfor<strong>de</strong>rt. Eine Analyse von Gen<strong>de</strong>rskripten ziele <strong>de</strong>mnach auf die<br />
Untersuchung <strong>de</strong>r „Mechanismen <strong>de</strong>r Anpassung“ (Akrich 1992, 207). Um das Konzept<br />
<strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskriptes in <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>r bis hierher geführten Diskussion <strong>de</strong>s Kapitels<br />
einzuordnen, lässt sich zusammenfassen:<br />
Es geht bei <strong>de</strong>n Gen<strong>de</strong>rskripten nicht, wie in <strong>de</strong>n am Anfang dieses Kapitels<br />
dargestellten gängigen Interpretationen von Winners Brückenbeispiel, darum, dass ein<br />
sozialer Ausschluss absichtsvoll produziert wer<strong>de</strong>n soll, son<strong>de</strong>rn um einen impliziten<br />
Gen<strong>de</strong>ringprozess. Ebenso wenig wird dieses Skriptals ein zwangsläufig zu befolgen<strong>de</strong>r<br />
Ablauf gedacht In<strong>de</strong>m das Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskripts die Handlungsfähigkeit von<br />
NutzerInnen in <strong>de</strong>n Blick nimmt, betont es, dass sie das Skript variieren können – sei<br />
es im Sinne <strong>einer</strong> Anpassung, Ablehnung o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> modifizierten Aneignung. Damit<br />
wird <strong>de</strong>r Annahme, dass sich die expliziten o<strong>de</strong>r implizierten Gestaltungsziele eins-zueins<br />
in Auswirkungen <strong>de</strong>r Technologie umsetzen, entgegen getreten. We<strong>de</strong>r die<br />
Technologie noch die ausgegrenzte soziale Gruppe (z.B. bestimmte Gruppen von<br />
Männern o<strong>de</strong>r Frauen) wird essentialisiert. Das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept richtet sich somit<br />
gegen Vorstellungen <strong>einer</strong> intentionalen Einschreibung von Ungleichheit in<br />
Technologie durch die TechnikgestalterInnen, die sich wie die Diskussion um Winners<br />
Thesen zeigte, als Verkürzungen erwiesen haben.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>s Spektrums von Ansätzen sozialwissenschaftlicher Technikforschung,<br />
welche die Verhältnisse zwischen Technologien und Gesellschaft zu fassen suchen,<br />
lässt sich das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept aufgrund <strong>de</strong>s Rekurses auf das Skript-Konzept<br />
Akrichs im Rahmen <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie verorten. Mit <strong>de</strong>r expliziten Zielse-<br />
82
tzung, die Ein- und Ausschlüsse zu analysieren, welche eine Technologie hervorbringt,<br />
schließt es jedoch eher an feministische Ansätze, die für eine Verantwortlichkeit <strong>de</strong>r<br />
TechnikforscherInnen wie auch <strong>de</strong>r TechnologiegestalterInnen plädieren, als an ANT<br />
selbst an. Die Konsequenzen von Einschreibungsprozessen wer<strong>de</strong>n als politische<br />
verstan<strong>de</strong>n, da sie Verhaltensweisen normalisieren und die Zuständigkeiten von NutzerInnen<br />
und technischen Objekten neu verteilen. Akrich (1992) bezeichnet diese bei<strong>de</strong>n<br />
Aspekte als „moral <strong>de</strong>legation“ an die Technologie und als „geography of responsibilities“<br />
(Akrich 1992, 207). Ein weiterer Aspekt <strong>de</strong>s Politischen <strong>de</strong>r Artefakte bzw.<br />
Netzwerke wird integriert, in<strong>de</strong>m das Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskripts auch die Nichtnutzung<br />
als eine politische Konsequenz von Technologien versteht und diejenigen, die<br />
(implizit) ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n, in das Blickfeld <strong>de</strong>r Analyse rückt. Das Gen<strong>de</strong>rskript-<br />
Konzept bezieht zwar nicht explizit Position in <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r symmetrischen Anthropologie.<br />
Da es jedoch <strong>de</strong>n Fokus auf die Nutzungssituationen und die Agency <strong>de</strong>r Nutzer-<br />
Innen legt, lässt sich das Konzept allerdings im Sinne <strong>einer</strong> asymmetrischen Sicht auf<br />
das Verhältnis zwischen Menschen und Artefakten (um)<strong>de</strong>uten, so wie es Barad und<br />
Suchman vorgeschlagen haben.<br />
Technologien wer<strong>de</strong>n im Gen<strong>de</strong>rskript-Ansatz als politische Projekte angesehen.<br />
Denn bereits Akrich hielt fest, dass die Prozesse <strong>de</strong>r Einschreibung zu <strong>de</strong>m Ergebnis<br />
führten, dass technische Artefakte Skripte enthalten, welche Strukturen <strong>de</strong>r Ungleichheit<br />
zementieren und unsichtbar machen o<strong>de</strong>r auch aufbrechen können: „It makes<br />
sense that technical objects have political strength. They may change social relations,<br />
but they also stabilize, naturalize and <strong>de</strong>politicize, and translate them into other media.<br />
After the event, the processes involved in building up technical objects are concealed.<br />
The causal links they established are naturalized“ (Akrich 1992, 222). Akrich betont<br />
hier <strong>einer</strong>seits <strong>de</strong>n festschreiben<strong>de</strong>n Charakter eines technologischen Skripts, <strong>de</strong>r<br />
primär durch die Unsichtbarmachung bzw. Naturalisierung eingeschriebener gesellschaftlicher<br />
Strukturen zustan<strong>de</strong> kommt. An<strong>de</strong>rerseits weist sie aber auch auf die<br />
Möglichkeit <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung sozialer Beziehungen in diesem Prozess hin.<br />
Einschreibungen können damit einem normativen, emanzipatorischen Anspruch<br />
folgen. Genau dieser Doppelcharakter, die Festschreibung <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht<br />
durch Technologien analysieren zu können und zugleich für eine potentielle<br />
Umgestaltung offen zu sein, macht <strong>de</strong>n Ansatz für die Konzeptualisierung von<br />
Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozessen attraktiv.<br />
Soweit betrachtet sprechen viele Argumente dafür, im Rahmen dieser Arbeit <strong>de</strong>r<br />
Analyse von Gen<strong>de</strong>ringprozessen <strong>informatischer</strong> Artefakte sowie ihrem De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept zugrun<strong>de</strong> zu legen. Denn es setzte wesentliche Aspekte, die<br />
bislang als theoretische Voraussetzung herausgearbeitet wur<strong>de</strong>n, konzeptuell um.<br />
Dass es bereits in Fallstudien über Informationstechnologien, speziell Digitaler Stadtinformationssysteme<br />
(vgl. etwa Rommes 2002), eingesetzt wur<strong>de</strong>, zeigt, dass sich das<br />
Konzept für dieses Vorhaben eignet. Dennoch birgt das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept drei<br />
wesentliche Probleme. Erstens wird <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Skripts an sich, d.h. ohne <strong>de</strong>n<br />
differenzierten Theoriebezug, auf <strong>de</strong>n er aufbaut, häufig naiv als Prozess <strong>de</strong>r<br />
Einschreibung <strong>de</strong>s Sozialen (bzw. von Geschlecht) in Technik missverstan<strong>de</strong>n.<br />
Zweitens bleiben Fallstudien, die mit <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept arbeiten, häufig hinter<br />
<strong>de</strong>n theoretischen Ansprüchen <strong>de</strong>s Konzeptes zurück. Und drittens ist das Konzept<br />
stark auf solche informatische Artefakte beschränkt, die für <strong>de</strong>n direkten Anwendungs-<br />
83
kontext entwickelt wer<strong>de</strong>n, so dass es Gen<strong>de</strong>ringprozesse, die nicht im Nutzungszusammenhang<br />
entstehen, nicht in <strong>de</strong>n Blick zu nehmen vermag. Diese Probleme<br />
wer<strong>de</strong>n weiter unten ausführlich diskutiert.<br />
Das erste Problem tritt insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Informatik auf, wo <strong>de</strong>r Skriptbegriff eine<br />
wohl<strong>de</strong>finierte Be<strong>de</strong>utung erhalten hat. Dort bezeichnen Skripte kleine Programme, die<br />
ein striktes Protokoll darstellen, bei <strong>de</strong>m je<strong>de</strong>r noch so kleine Schritt <strong>de</strong>s technischen<br />
Systems sowie <strong>de</strong>r Bedienung <strong>de</strong>r Technologie im Vorhinein festgelegt wird. Deshalb<br />
ist zu vermuten, dass <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>rskripts in <strong>de</strong>r Informatik eher in <strong>de</strong>m Sinne<br />
verstan<strong>de</strong>n wird, dass ein männlicher Entwickler seine persönliche Absicht <strong>de</strong>r<br />
Geschlechtsfestlegung o<strong>de</strong>r -diskrimierung mehr o<strong>de</strong>r weniger bewusst in das Artefakt<br />
einschreibt – ganz wie dies auch bei Winners Brücken angenommen wur<strong>de</strong>. O<strong>de</strong>r sie<br />
nehmen an, dass <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichungsprozess, <strong>de</strong>r durch ein Gen<strong>de</strong>rskript<br />
beschrieben wird, allein auf die Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>rjenigen, die die Technologie<br />
gestalten, zurückzuführen ist. Trotz aller Bemühungen Akrichs, <strong>de</strong>n Interpretationen<br />
absichtsvoller o<strong>de</strong>r essentialistischer Einschreibung entgegenzuwirken, wird <strong>de</strong>r Skript-<br />
Begriff auch im allgemeinen Verständnis oft eher technik<strong>de</strong>terministisch gelesen.<br />
Gegen seine Deutung als ein striktes Protokoll hat auch ihr expliziter Vergleich mit<br />
einem Drehbuch für einen Film, das mehr o<strong>de</strong>r weniger genau von <strong>de</strong>n Akteuren<br />
ausgeführt wird, wenig ausrichten können: „like a film script, technical objects <strong>de</strong>fine a<br />
framework of action together with the actors and the space in which they are supposed<br />
to act“ (Akrich 1992, 208).<br />
Soziologische TechnikforscherInnen wie Gabriele Winker kritisieren tatsächlich<br />
einen latenten Essentialismus <strong>de</strong>s Skript- bzw. Gen<strong>de</strong>rskriptkonzepts. So wer<strong>de</strong> in<br />
diesen vorausgesetzt, was es aus <strong>einer</strong> konstruktivistischen Position heraus erst zu<br />
untersuchen gelte: „Artefakte, die unhinterfragt als Technik bezeichnet wer<strong>de</strong>n.“ (Winker<br />
2005, 56). Es bliebe unklar, „was konkret in sozialen Interaktionen geschieht, in<br />
<strong>de</strong>nen es zur Herausbildung von Geschlechtsi<strong>de</strong>ntitäten über die Konstruktion von<br />
Technik und zur Produktion vergeschlechtlichter Technik kommt“ (ebd., 57). Das Wie<br />
<strong>de</strong>r Konstruktionsprozesse von Geschlecht gelte es zukünftig zu bearbeiten. Sie sieht<br />
darin jedoch ein Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rat, das sich in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung zeige.<br />
Während sich damit die Kritik an <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Konzeptualisierung <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichungsprozesse relativiert, bliebe <strong>de</strong>r Vorwurf <strong>de</strong>s Technik<strong>de</strong>terminismus<br />
und -essentialismus weiterhin bestehen.<br />
Läge das Problem nur auf <strong>einer</strong> terminologischen Ebene, so ließe sich, um Missverständnisse<br />
zu vermei<strong>de</strong>n, ein an<strong>de</strong>rer Terminus verwen<strong>de</strong>n. Dazu bieten sich die Begriffe<br />
<strong>de</strong>r „Konfiguration“ o<strong>de</strong>r – wie Suchman vorschlägt – <strong>de</strong>r „Re-Konfiguration“ an.<br />
Tatsächlich hat <strong>de</strong>r Technikforscher Steve Woolgar mit <strong>de</strong>m „Configuring the User“<br />
(Woolgar 1991b) ein ähnliches Konzept wie Akrich vorgestellt, das auf Vorgehensweisen,<br />
die technologische Artefakte <strong>de</strong>n NutzerInnen nahe legen, fokussiert: „[B]y<br />
setting parameters for the user’s actions, the evolving machine effectively attempts to<br />
configure the user“ (Woolgar 1991b, 61). Das Konzept <strong>de</strong>r Konfigurierung <strong>de</strong>r Nutzer-<br />
Innen ist aus seinen Untersuchungen zur Metapher „Maschine als Text“ hervorgegangen,<br />
die auf die Dekonstruktion von Maschinen als Objekten zielen. „The i<strong>de</strong>a is to begin<br />
with the supposition that the nature and capacity of the machine is, at least in principle,<br />
interpretatively flexible. This then sets the frame for an examination of the processes<br />
of construction (writing) and use (reading) of the machine; the relation between<br />
84
ea<strong>de</strong>rs and writers is un<strong>de</strong>rstood as mediated by the machine and by interpretations of<br />
what the machine is, what it’s for, what it can do. To suggest that machines are texts is,<br />
of course, to <strong>de</strong>construct <strong>de</strong>finitive versions of what machines can do“ (Woolgar 1991b,<br />
60).<br />
Woolgar geht damit von einem semiotischen Ansatz aus, <strong>de</strong>r die Untersuchung <strong>de</strong>r<br />
Herstellung von Be<strong>de</strong>utungen von Zeichen auf technische Objekte überträgt. NutzerIn<br />
wer<strong>de</strong>n als LeserInnen konzipiert, die versuchen, <strong>de</strong>n Text zu <strong>de</strong>kodieren, <strong>de</strong>n<br />
TechnikgestalterInnen <strong>de</strong>r Technologie eingeschrieben, d.h. kodiert haben.<br />
Technologie (Text) stellt <strong>de</strong>mzufolge – wie auch in vielen medienwissenschaftlichen<br />
Ansätzen – eine wesentliche Funktion <strong>de</strong>r Verknüpfung von GestalterInnen (AutorInnen)<br />
und NutzerInnen (LeserInnen) dar. Woolgars Verständnis <strong>de</strong>r NutzerInnen betont<br />
die interpretative Flexibilität <strong>de</strong>r Artefakte und fragt nach Prozessen <strong>de</strong>r Schließung<br />
und <strong>de</strong>r Stabilisierung von Technologie – eine Perspektive, die die VertreterInnen <strong>de</strong>s<br />
SCOT-Ansatzes bereits konzeptuell in die sozialwissenschaftliche Technikforschung<br />
eingebracht hatten. Während SCOT jedoch die Aushandlungen zwischen sozial<br />
relevanten Gruppen in <strong>de</strong>n Mittelpunkt stellt, fokussiert Woolgar auf Prozesse <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung, welche die interpretative Flexibilität <strong>de</strong>r Technologie beschränken.<br />
NutzerInnen wür<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>m Sinne konfiguriert, dass ihre Möglichkeit Maschinen zu „lesen“<br />
durch die jeweilige Konzeption, Entwicklung und Gestaltung <strong>de</strong>r Technologie<br />
gelenkt wer<strong>de</strong>n. Die Konfiguration <strong>de</strong>r NutzerInnen umfasse „<strong>de</strong>fining the i<strong>de</strong>ntity of<br />
the putative users, and setting constraints upon their likely future actions“ (Woolgar<br />
1991b, 59). Damit wird Technikgestaltung als ein Prozess <strong>de</strong>r sozialen Konstruktion<br />
von NutzerInnen begriffen, <strong>de</strong>r zugleich das Ausmaß <strong>de</strong>rjenigen Handlungen festlegt,<br />
die die Maschine zulässt, und damit die Grenzen zwischen NutzerInnen und<br />
Maschinen bestimmt.<br />
Woolgar entwickelte das Konzept <strong>de</strong>r Konfigurierung von NutzerInnen in <strong>de</strong>n 1980er<br />
Jahren anhand von ethnografischen Studien bei einem Hersteller von Personalcomputern<br />
über <strong>de</strong>ren Untersuchungen zur Gebrauchstauglichkeit. In diesen zeigte<br />
sich, dass verschie<strong>de</strong>ne Gruppen und Individuen an <strong>de</strong>r sozialen Konstruktion <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen beteiligt waren, wie etwa Hardware-IngenieurInnen, ProduktingenieurInnen,<br />
ProjektmanagerInnen, Verkaufspersonal, technischer Support, Finanz- und<br />
Controlling- sowie Rechtsabteilungen, die jeweils unterschiedliche und zeitlich variieren<strong>de</strong><br />
Vorstellungen davon hatten „what the user is like“ (ebd., 81). Das Wissen über<br />
die NutzerInnen war in <strong>de</strong>r Firma ungleich verteilt. Diejenigen, <strong>de</strong>ren Tätigkeit stärker<br />
auf die NutzerInnen ausgerichtet war (beispielsweise technische RedakteurInnen, die<br />
die technische Dokumentation erstellten, o<strong>de</strong>r die MitarbeiterInnen <strong>de</strong>s technischen<br />
Supports), beklagten ein mangeln<strong>de</strong>s Wissen über die NutzerInnen auf Seiten<br />
ingenieurwissenschaftlicher Abteilungen. Letztere dagegen warnten davor, die Sichtweisen<br />
<strong>de</strong>r NutzerInnen zu ernst zu nehmen, da sie die Technologie nicht verstün<strong>de</strong>n<br />
und <strong>de</strong>shalb nicht wüssten, was sie sich von <strong>de</strong>m Artefakt wünschten und erwarteten.<br />
Die Technologie solle besser an <strong>de</strong>n Entwicklungen <strong>de</strong>s Marktes und an <strong>de</strong>r Zukunft<br />
<strong>de</strong>r Informationstechnologien ausgerichtet wer<strong>de</strong>n. NutzerInnen wur<strong>de</strong>n innerhalb <strong>de</strong>r<br />
Firma also nicht als eine kohärente Gruppe bestimmt. Daraus zog Woolgar <strong>de</strong>n<br />
Schluss, dass die Geschichte von Technologieentwicklungsprojekten eher als<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung innerhalb eines soziotechnischen Netzwerkes zu lesen sei,<br />
welches die NutzerInnen konfiguriere (d.h. <strong>de</strong>finiere, befähige und beschränke).<br />
85
Auf <strong>de</strong>n ersten Blick scheint <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>r Konfigurierung von NutzerInnen für <strong>de</strong>n<br />
Zweck, die Geschlecht festschreiben<strong>de</strong> Wirkung von Artefakten zu charakterisieren,<br />
gut geeignet. Er legt essentialistische o<strong>de</strong>r technik<strong>de</strong>terministische Mißinterpretationen<br />
weniger nahe als Akrichs Skriptbegriff. Die Vorstellung <strong>einer</strong> „Konfigurierung <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen“ führt nicht so leicht dazu, einen absichtsvollen Vorgang <strong>de</strong>r Einschreibung<br />
von Ungleichheit in die technischen Artefakte anzunehmen. Allerdings wird <strong>de</strong>m<br />
Konzept vorgeworfen, dass es die Konfigurierung <strong>de</strong>r NutzerInnen als einen einseitigen<br />
Prozess verstehe (vgl. Mackay et al. 2000, Oudshoorn/ Pinch 2003a). Es sei symmetrisch<br />
zu berücksichtigen, dass auch die NutzerInnen Arbeit <strong>de</strong>r Dekodierung (<strong>de</strong>s Textes,<br />
<strong>de</strong>r Maschine) leisteten, und außer<strong>de</strong>m anzuerkennen, dass nicht nur NutzerInnen,<br />
son<strong>de</strong>rn umgekehrt auch die TechnikgestalterInnen – durch die NutzerInnen wie<br />
durch die Organisation, für die sie arbeiten – konfiguriert wür<strong>de</strong>n. 148 Im Vergleich dazu<br />
beschreibt das Skript-Konzept sowohl TechnikgestalterInnen wie NutzerInnen als aktiv<br />
Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>.<br />
Der für <strong>de</strong>n Kontext hier entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Vorteil <strong>de</strong>s Skript-Konzepts gegenüber <strong>de</strong>r<br />
„Konfigurierung von NutzerInnen“ liegt darüber hinaus darin, dass es bereits umfangreich<br />
für die Gen<strong>de</strong>ranalyse eingesetzt wur<strong>de</strong>, während das von Woolgar vorgeschlagene<br />
Analyseverfahren bislang nicht intensiv für die Untersuchung von Prozessen <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring und De-Gen<strong>de</strong>ring genutzt wird. Um in dieser Arbeit von <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r<br />
Konfigurierung von NutzerInnen ausgehen zu können, muss zunächst die Frage<br />
beantwortet wer<strong>de</strong>n, wie Geschlecht darin gefasst wer<strong>de</strong>n kann. Aufgrund dieser<br />
bisherigen Leerstelle erscheint <strong>de</strong>r Skript- bzw. Gen<strong>de</strong>rskript-Begriff für diese Arbeit<br />
besser geeignet als <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Konfigurierung, auch wenn bei<strong>de</strong> Ansätze konzeptuell<br />
starke Ähnlichkeiten aufweisen.<br />
Mit ihrem Begriff <strong>de</strong>r „Mensch-Maschine-Rekonfigurationen“ geht Suchman davon<br />
aus, dass die Verhältnisse von Mensch und Maschine gegenwärtig in einem<br />
umfassen<strong>de</strong>ren Sinne gestaltet wer<strong>de</strong>n als von Woolgar angenommen, <strong>de</strong>r<br />
ausschließlich auf die Konfigurierung <strong>de</strong>r NutzerInnen fokussiert. Sie zielt zugleich<br />
darauf, <strong>de</strong>n Prozess als Rekonfiguration, d.h. Umgestaltung zu begreifen, die sie<br />
<strong>einer</strong>seits analytisch, an<strong>de</strong>rerseits visionär-<strong>kritisch</strong> fasst. „My aim […] is to rethink the<br />
intracate, and increasingly intimate, configurations of the human and the machine“<br />
(Suchman 2007, 1). Für das Ziel <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit, auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r<br />
Artefakte hinzuwirken, ist diese Perspektive attraktiv. Eine notwendige Voraussetzung,<br />
Verän<strong>de</strong>rung in dieser Weise <strong>de</strong>nken zu können, ist es jedoch, herkömmliche<br />
festgefahrene Vorstellungen von TechniknutzerInnen, TechnikgestalterInnen und <strong>de</strong>ren<br />
Verhältnissen aufzugeben. So bemängelt etwa Suchman an <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r Konfigurierung<br />
<strong>de</strong>r NutzerInnen und <strong>de</strong>m Skript-Konzept, diese wür<strong>de</strong>n trotz ihrer sorgfältigen<br />
Aufmerksamkeit für die Kontingenzen von Gestaltung und Nutzung „leave in place an<br />
overrationalized figure of the <strong>de</strong>signer as actor, and an overestimation of the ways and<br />
the extend to which <strong>de</strong>finitions of users and use can be inscribed into an artifact“<br />
(Suchman 2007, 192). Woolgar und Akrich wür<strong>de</strong>n vermutlich zustimmen, dass es<br />
148 Woolgars Konzept – wie auch das Skriptkonzept – wird kritisiert vorgeworfen, dass es die Sichtweise<br />
auf die Frage, wer an <strong>de</strong>r Konfigurationsarbeit beteiligt ist, auf TechnikgestalterInnen und die in <strong>de</strong>r<br />
herstellen<strong>de</strong>n Firma vertretenen AkteurInnen verenge. Nachfolgen<strong>de</strong> Ansätze erweiterten das jeweilige<br />
Konzept um die Beteiligung von JournalistInnen, öffentlichen Einrichtungen, PolitikerInnen und sozialen<br />
Bewegungen, aber auch die von NutzerInnen; vgl. hierzu die Beiträge in Oudshoorn/ Pinch 2003a sowie<br />
Mackay et al. 2000.<br />
86
we<strong>de</strong>r eine feste Perspektive <strong>de</strong>r GestalterInnen auf die NutzerInnen gibt, noch<br />
Imaginationen von NutzerInnen und Nutzung vollständig und in kohärenter Form in die<br />
technischen Artefakte eingeschrieben wer<strong>de</strong>n könnten. 149 Suchman schlägt vor, die<br />
Vorstellungen <strong>de</strong>r GestalterInnen von <strong>de</strong>n NutzerInnen <strong>einer</strong>seits spezifischer in <strong>de</strong>n<br />
vielfältigen Räumen, Imaginationen, Erfor<strong>de</strong>rnissen und Praktiken professionellen<br />
Designs zu verorten sowie an<strong>de</strong>rerseits allgem<strong>einer</strong> in folgen<strong>de</strong>m Sinne zu verstehen:<br />
„artifacts are characterized by greater open-en<strong>de</strong>dness and in<strong>de</strong>terminancy with<br />
respect to the question of how they might be incorporated into use. The ‚user‘ is, in<br />
other words, more vaguely figured, the object more <strong>de</strong>eply ambiguous“ (Suchman<br />
2007, 193). Sie kritisiert damit genau genommen, dass we<strong>de</strong>r das Skript-Konzept noch<br />
das <strong>de</strong>r „Konfigurierung <strong>de</strong>r NutzerInnen“ <strong>de</strong>r eigenen theoretischen Grundlegung, <strong>de</strong>r<br />
Akteur-Netzwerk-Theorie, genügend gerecht wer<strong>de</strong>n. Denn ANT zufolge müsste das,<br />
was als Artefakt o<strong>de</strong>r wer als NutzerIn gilt, sowie <strong>de</strong>ren situierte Grenzziehungen<br />
sorgfältig rekonstruiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Mit ihrem Begriff <strong>de</strong>r „Mensch-Maschine-Rekonfiguration“ im Titel ihres Buches formuliert<br />
Suchman (2007) meines Erachtens zumin<strong>de</strong>st indirekt noch eine weitere, viel<br />
grundlegen<strong>de</strong>re Kritik an Akrichs und auch Woolgars Konzepten. Denn dieser Begriff<br />
umfasst die Frage nach <strong>de</strong>n aktuellen Rekonfigurationen <strong>de</strong>s Humanen in und durch<br />
Technologientwicklungen, die weit über die Konfiguration <strong>de</strong>r NutzerInnen hinausgeht<br />
und insbeson<strong>de</strong>re für die Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte aufschlussreich<br />
ist, konnte doch aus feministischer Perspektive anhand von Definitionen <strong>de</strong>s<br />
Menschlichen historisch immer wie<strong>de</strong>r aufgezeigt wer<strong>de</strong>n, dass das menschliche Subjekt<br />
als ‚männlich‘ gedacht wird 150 . So betrachtet reichen Konzepte, die auf die Repräsentation<br />
von NutzerInnen durch die GestalterInnen fokussieren, selbst wenn sie als<br />
flexibel und situiert verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, nicht aus, um Gen<strong>de</strong>ringprozesse <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte umfassend zu konzeptualisieren. Akrichs und Woolgars Begriffe<br />
vermögen solche Einschreibungen, die sich nicht auf eine konkrete Anwendung, einen<br />
spezifischen Nutzungskontext o<strong>de</strong>r eine einzelne NutzerInnengruppe beziehen, nicht<br />
zu charakterisieren. Informatik lässt sich jedoch nicht allein auf Software- und Anwendungsentwicklung<br />
reduzieren. Die Disziplin umfasst zugleich die Entwicklung von<br />
Metho<strong>de</strong>nwissen, von Grundlagenforschung und Konzepten, die nicht notwendigerweise<br />
sofort auf eine praktische Umsetzung zielen. Beson<strong>de</strong>rs provokativ erscheinen dabei<br />
diejenigen Technologien, die traditionelle Grenzziehungen zwischen Mensch und<br />
Maschine verschieben und neu konfigurieren o<strong>de</strong>r tief greifen<strong>de</strong> Eingriffe in das versprechen,<br />
was wir „sehen“ und wahrnehmen bzw. wie wir <strong>de</strong>nken, fühlen und sozial<br />
interagieren. Dazu gehören beispielsweise informatische Mo<strong>de</strong>llierungsmetho<strong>de</strong>n wie<br />
die Objektorientierte Analyse und Design, Repräsentationen und Klassifikationen von<br />
Information wie etwa durch das Semantic Web und mittels Ontologien o<strong>de</strong>r übergreifen<strong>de</strong><br />
Projekte wie das <strong>de</strong>r menschenähnlichen Maschinen in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelli-<br />
149 Vgl. hierzu Stewart und Williams, die in ähnlicher Weise argumentieren, wenn sie behaupten, dass das<br />
Skript- und das Konfigurierungskonzept auf <strong>de</strong>r Sichtweise grün<strong>de</strong>ten, „that <strong>de</strong>sign incorporates a comprehensive<br />
representation of the inten<strong>de</strong>d users, their purposes and the context of use“ (Stewart/ Williams<br />
2005, 46, Hervorhebung im Orig.). Sie begrüßen zwar die zunehmen<strong>de</strong> Ten<strong>de</strong>nz zur Anwen<strong>de</strong>rInnenorientierung,<br />
allerdings sei die Falle <strong>de</strong>s so genannten Gestaltungstrugschlusses zu vermei<strong>de</strong>n: „the<br />
presumption that the primary solution to meeting users needs is to build ever more extensive knowledge<br />
about the specific context and purposes of various users into technology <strong>de</strong>sign“ (ebd., 44).<br />
150 Vgl. etwa Bußmann/ Hof 2005 sowie speziell für die Subjektkonzeption in <strong>de</strong>r Philosophie Klinger 2005.<br />
87
genzforschung. Auch in diesen informatischen Artefakten können Vorstellungen über<br />
„<strong>de</strong>n Menschen“, über bestimmte Personengruppen, über „die Welt“ o<strong>de</strong>r einen ihrer<br />
Ausschnitte, d.h. wissenschaftstheoretische Setzungen und ontologische Aussagen<br />
enthalten sein, die sich bei genauerer Betrachtung zwar als vergeschlechtlicht erweisen,<br />
aber nicht mit <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept erfasst wer<strong>de</strong>n können, das<br />
ausschließlich auf die Nutzung zentriert ist.<br />
Um das Gen<strong>de</strong>ring auch auf dieser Ebene fassen zu können, ist es nicht nur<br />
notwendig, <strong>de</strong>n theoretischen Rahmen so zu erweitern, wie er in <strong>de</strong>n voraus gegangenen<br />
Kapiteln 3.4 bis 3.6 entwickelt wur<strong>de</strong>. Vielmehr ist hier zugleich ein differenzierteres<br />
Verständnis von Vergeschlechtlichungsprozessen gefragt. Aufgrund <strong>de</strong>r bisherigen<br />
Diskussionen in diesem Kapitel ist also ein Ansatz gesucht, <strong>de</strong>r die gleichzeitige<br />
Produktion von Technologie und Geschlecht erklärt, ohne auf <strong>einer</strong> essentialistischen<br />
Unterscheidung zwischen Menschen und Maschinen zu beruhen (d.h. <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Lage<br />
ist, zu analysieren, wie sowohl Menschen und Maschinen als auch die Verteilung von<br />
Handlungsfähigkeit zwischen ihnen konstituiert wer<strong>de</strong>n), <strong>de</strong>r gleichzeitig <strong>de</strong>n politischen<br />
Charakter von Artefakten anerkennt (d.h. unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>ren Vergeschlechtlichung)<br />
und darüber hinaus Vorschläge zur (feministischen) Intervention in soziomaterielle<br />
bzw. materiell-diskursive Praktiken <strong>de</strong>r Technowissenschaften (d.h. zum De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring informationstechnologischer Artefakte) zu machen vermag. Barads Konzept<br />
<strong>de</strong>s Agential Realism zusammen mit Suchmans Überlegungen zu <strong>de</strong>n Mensch-<br />
Maschine-Rekonfigurationen liefern dafür eine Basis, die nun um ein Konzept zu<br />
ergänzen und konkretisieren ist, welches <strong>de</strong>n Prozess und die Prozesshaftigkeit <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte zu erfassen vermag.<br />
3.8. Posthumanistische Performativität und Ko-Materialisierung von<br />
Technologie und Geschlecht<br />
Die Grundi<strong>de</strong>e für das Verständnis <strong>de</strong>r Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Artefakten,<br />
die ich im Folgen<strong>de</strong>n vorschlagen möchte, besteht darin, diese Prozesse<br />
performativ aufzufassen. Zentral ist dabei <strong>de</strong>r Rückgriff auf Judith Butlers Konzept <strong>de</strong>r<br />
Performativität, welches die allmähliche Verfestigung von biologischen Körpern als<br />
Frauen o<strong>de</strong>r Männer durch das für alle Beteiligten zwangsläufige Zitieren von Normen<br />
beschreibt. Während Butlers Performanzbegriff, <strong>de</strong>r die Theatralität von Handlungen<br />
betont und eine gewisse Wahlfreiheit <strong>de</strong>r Selbstrepräsentation in Aussicht stellt, hinterfragt<br />
ihr Performativitätsbegriff die Vorstellung eines autonom und intentional han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n<br />
Subjekts. Gen<strong>de</strong>r performativ zu verstehen heißt, keine Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität<br />
„hinter“ <strong>de</strong>n Ausdrucksformen von Geschlecht anzunehmen. I<strong>de</strong>ntität wer<strong>de</strong> vielmehr<br />
gera<strong>de</strong> durch diese Äußerungen erst hervorgebracht. „So what I’m trying to do is think<br />
about performativity as that aspect of discourse that has the capacity to produce what it<br />
names. […] Then I take a further step, through the Derri<strong>de</strong>an rewriting of Austin, and<br />
suggest that this production actually always happens through a certain kind of<br />
repetition and recitation. […] Performativity is the discursive mo<strong>de</strong> by which ontological<br />
effects are installed” (Butler 1994, 34). Butler versteht also biologische Körper im<br />
Anschluss an Derrida nicht als Substrat, son<strong>de</strong>rn als Effekt von Diskurs und Praxis <strong>de</strong>r<br />
Signifikation. Sie stellt damit die in <strong>de</strong>r Frauen- und Geschlechterforschung lange Zeit<br />
88
vorherrschen<strong>de</strong> analytische Unterscheidung zwischen Sex (biologisches Geschlecht)<br />
und Gen<strong>de</strong>r (sozio-kulturelles Geschlecht) prinzipiell infrage, 151 die ein biologisches<br />
Geschlecht annimmt und in großen Teilen <strong>de</strong>r feministischen Theorie dazu diente,<br />
sozio-kulturelle Unterschie<strong>de</strong> und hierarchische Verhältnisse zwischen Frauen und<br />
Männern davon getrennt zu betrachten, sie in ihrer historischen Konstituiertheit zu<br />
rekonstruieren und ihnen entgegenzuwirken. Biologische Geschlechtskörper gelten<br />
Butler <strong>de</strong>mgegenüner nicht als <strong>de</strong>r Sprache vorgängig und nicht als ursächlich für<br />
Geschlechterdifferenzen und -hierarchien, son<strong>de</strong>rn entstün<strong>de</strong>n erst in und durch<br />
diskursive Praktiken.<br />
Wenn es jedoch keine vordiskursive Geschlechterdifferenz gibt, so stellt sich die<br />
Frage, wie die natürlich erscheinen<strong>de</strong> Geschlechterordnung, das Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
entstan<strong>de</strong>n ist und hergestellt wird. Nach Butler ist Geschlecht durch <strong>de</strong>n<br />
kulturellen Produktionsapparat hervorgebracht, <strong>de</strong>r Denksysteme, Sprachregeln, wissenschaftliche<br />
Diskurse und politische Interessen umfasst. Darauf, dass sie selbst<br />
dabei Maschinen und Technowissenschaften nicht integriert, wird im Folgen<strong>de</strong>n noch<br />
einzugehen sein. Soziales Geschlecht wer<strong>de</strong> aufgrund verwischter Machtsedimentierungen<br />
als biologisches gedacht. Diskurse können damit körperlich-materielle<br />
Gestalt annehmen. Das Performativitätskonzept verweist damit insgesamt auf die Fähigkeit<br />
sprachlicher Diskurse, körperliche Materialität zu produzieren.<br />
Butler setzt im Prozess <strong>de</strong>r Materialisierung bestehen<strong>de</strong>r Normen we<strong>de</strong>r ein ursprüngliches<br />
Original dieser Normen voraus, noch die Möglichkeit <strong>einer</strong> perfekten<br />
Kopie, welche dieses eigentliche Original unverfälscht wie<strong>de</strong>rgibt. Vielmehr bestehe<br />
Geschlecht „aus <strong>einer</strong> Kette von Resignifizierungen […], <strong>de</strong>ren Ursprung und En<strong>de</strong><br />
nicht feststehen und nicht feststellbar sind“ (Butler 1998 [1997], 27). Soziale Normen<br />
müssen ihr zufolge in <strong>einer</strong> ständigen Wie<strong>de</strong>rholung aktualisiert wer<strong>de</strong>n, um erhalten<br />
zu bleiben. „Daß diese ständige Wie<strong>de</strong>rholung notwendig ist, zeigt, dass die Materialisierung<br />
nie ganz vollen<strong>de</strong>t ist, dass die Körper sich nie völlig <strong>de</strong>n Normen fügen, mit<br />
<strong>de</strong>nen ihre Materialisierung erzwungen wird“ (Butler 1995 [1993], 21). Butler verweist<br />
damit auf <strong>de</strong>n kontingenten, provisorischen und gestalteten Charakter von biologischen<br />
Körpern, <strong>de</strong>ren Geschlechtzuweisung gelingen, aber auch fehlschlagen kann.<br />
Wesentlich für das Konzept <strong>de</strong>r Performativität ist <strong>de</strong>mnach, dass Geschlecht nicht<br />
in einem einzelnen Akt entsteht, son<strong>de</strong>rn als „ständig wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong> und zitieren<strong>de</strong><br />
Praxis“ (Butler 1995 [1993], 22) aufzufassen ist. Das be<strong>de</strong>utet, dass Geschlecht keine<br />
feststehen<strong>de</strong> Größe ist, son<strong>de</strong>rn stets durch eine ritualisierte Wie<strong>de</strong>rholung und durch<br />
Zitieren, d.h. durch <strong>de</strong>n Bezug auf vorangegangene Äußerungen von Geschlecht,<br />
wie<strong>de</strong>rhergestellt wird. „Wenn eine performative Äußerung vorläufig erfolgreich ist (und<br />
ich schlage vor, dass ‚Erfolg‘ immer nur vorläufig ist), dann […] nur <strong>de</strong>swegen, weil die<br />
(Sprech-)Handlung frühere (Sprech-)Handlungen echogleich wie<strong>de</strong>rgibt und die Kraft<br />
<strong>de</strong>r Autorität durch die Wie<strong>de</strong>rholungen o<strong>de</strong>r durch das Zitieren <strong>einer</strong> Reihe vorgängiger<br />
autoritativer Praktiken akkumuliert“ (Butler 1995 [1993], 299, Hervorhebung im<br />
Orig.). Die performative Äußerung wird erst dann als solche erkennbar und effizient<br />
wirksam, wenn sie sich auf das jeweilig vorherrschen<strong>de</strong> System gesellschaftlich anerkannter<br />
Normen bezieht, zu <strong>de</strong>m insbeson<strong>de</strong>re das normativ-kulturelle Konstrukt <strong>de</strong>r<br />
151 Vgl. Butler 1991 [1990]; für eine zusammenfassen<strong>de</strong> Darstellung <strong>de</strong>r so genannten Sex-Gen<strong>de</strong>r-<br />
Debatte siehe auch Knapp 2000.<br />
89
heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit gehört. Normen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mzufolge nie auf die<br />
gleiche Weise zitiert. Eine Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Kontexts <strong>einer</strong> Äußerung verän<strong>de</strong>rt auch<br />
<strong>de</strong>ssen Be<strong>de</strong>utung, kann diese außer Kraft setzen o<strong>de</strong>r auch die Norm verän<strong>de</strong>rn. Die<br />
Möglichkeit <strong>kritisch</strong>er Intervention bzw. Subversion von Geschlechternormen lässt sich<br />
damit in <strong>de</strong>r Zitatförmigkeit verorten. Dabei ist jedoch zu be<strong>de</strong>nken, dass Wi<strong>de</strong>rständigkeit<br />
gegenüber <strong>de</strong>n vorherrschen<strong>de</strong>n Konventionen in Form von Be<strong>de</strong>utungsverschiebungen<br />
bereits als Teil <strong>de</strong>s Performativen integriert und damit <strong>de</strong>r Macht immanent ist.<br />
Butlers Konzept <strong>de</strong>r Performativität ist breit rezipiert wor<strong>de</strong>n und hat verschie<strong>de</strong>ne<br />
Strömungen <strong>de</strong>r feministischen Theoriebildung inspiriert, die sich mit <strong>de</strong>r Konstitution<br />
biologischer Körper beschäftigen. Das Körpergeschlecht gilt auf dieser Grundlage als<br />
ständig neu hervorgebracht durch performative Akte, wobei sich die Körper selbst in<br />
diesem Prozess erst materialisieren. Diese Vorstellung wird neuerdings von feministischen<br />
Naturwissenschafts- und Technikwissenschaftsforscherinnen aufgegriffen, um<br />
die Materialisierung und Vergeschlechtlichung von nicht-menschlichen Körpern, insbeson<strong>de</strong>re<br />
Materie und Technologie zu beschreiben. In <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
mit Vorschlägen von Winker, Barad und Suchman möchte ich abschließend<br />
ein Konzept <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten entwickeln, das Butlers Performativitiätskonzept<br />
nutzt und für die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit tragfähig macht.<br />
Gabriele Winker entwickelt ein Konzept <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und<br />
Geschlecht. Dabei geht sie in Anlehnung an Butlers Ansatz davon aus, dass aus<br />
Artefakten nicht automatisch „Technik“ wird, „son<strong>de</strong>rn – vergleichbar <strong>de</strong>m vergeschlechtlichten<br />
Körper – Artefakte erst im Diskurs technisiert, als High-Tech-Produkte<br />
hervorgebracht und damit mächtig, beachtenswert und im Zuge <strong>de</strong>ssen männlich<br />
konnotiert wer<strong>de</strong>n“ (Winker 2005, 59). Technische bzw. technisierte Artefakte wür<strong>de</strong>n<br />
somit zusammen mit Geschlechtlichkeit durch zitatförmige Wie<strong>de</strong>rholungen <strong>einer</strong><br />
diskursiven Ordnung erzeugt. Menschliche und nicht-menschliche Entitäten erhielten<br />
damit gleichzeitig eine (beispielsweise vergeschlechtlichte) Gestalt.<br />
Mit <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht möchte<br />
Winker das in <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung vorherrschen<strong>de</strong> Verständnis<br />
<strong>de</strong>r Ko-Konstruktion als wechselseitige Einwirkung von sozialen Prozessen<br />
und technischen Artefakten transformieren. Es soll die analytische Trennung von<br />
Menschen und Maschinen aufheben und statt<strong>de</strong>ssen die Gleichzeitigkeit <strong>de</strong>r<br />
Materialisierung von Technik und Geschlecht betonen. Darüber hinaus grenzt Winker<br />
<strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung <strong>de</strong>zidiert gegen das Skriptkonzept ab. Denn<br />
Gen<strong>de</strong>rskripte liefen Gefahr, mit vorgängigen Technik- und Geschlechtsstereotypen zu<br />
operieren und auf Essentialismen zurückzugreifen. Butlers Performativitätskonzept<br />
dagegen wen<strong>de</strong> sich gegen die Vorstellung, dass sich Normen in die Oberfläche <strong>de</strong>s<br />
Körpers einschreiben. Normen entstün<strong>de</strong>n erst durch Diskurse und ihre wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong><br />
performative Praxis, was Winker zufolge ebenso für die Ko-Materialisierung von technisierten<br />
Körpern und vergeschlechtlichten Artefakten gelte. Materialisierung sei kein<br />
absichtsvoller, auf festgelegte Wirkungen zielen<strong>de</strong>r Akt, son<strong>de</strong>rn – wie Butler bereits<br />
betonte – ein Prozess, „<strong>de</strong>r im Laufe <strong>de</strong>r Zeit stabil wird, so dass sich die Wirkung von<br />
Begrenzung, Festigkeit und Oberfläche herstellt, <strong>de</strong>n wir Materie nennen“ (Butler 1995<br />
[1993], 32).<br />
Die Vorstellung, Geschlecht mit Butler als performativen Prozess <strong>de</strong>r<br />
Materialisierung aufzufassen, birgt (z.B. gegenüber <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept) <strong>de</strong>n<br />
90
Vorteil, die Vergeschlechtlichung technischer Artefakte breit fassen zu können und<br />
„das Wer<strong>de</strong>n“ von Technologie auch in Bezug auf die Grundlagenforschung und Leitbil<strong>de</strong>r<br />
von Technikgestaltung einzuschließen. Winker selbst fokussiert in ihrer Studie<br />
jedoch weniger auf die technischen Artefakte und <strong>de</strong>ren Entwicklungsprozesse, die in<br />
dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, son<strong>de</strong>rn analysiert primär die sprachlichen<br />
Diskurse und Handlungspraxen, die das Internet umgeben. Sie sieht ihre Aufgabe als<br />
Forscherin darin, „zur Verschiebung von Gen<strong>de</strong>r-Internet-Diskursen beizutragen,<br />
anstatt sie in performativen Akten zu wie<strong>de</strong>rholen und reifizieren“ (Winker 2005, 64),<br />
und stellt damit <strong>de</strong>n Nutzungskontext und die diesen umgeben<strong>de</strong> Diskurse in <strong>de</strong>n<br />
Vor<strong>de</strong>rgrund, die dazu führen, dass technischen Objekten Männlichkeit zugeschrieben<br />
wird, in <strong>de</strong>m sie „High Tech“ als <strong>de</strong>klariert wer<strong>de</strong>n. Deshalb birgt ihr Ansatz zwar<br />
wertvolle Hinweise dafür, wie die Ko-Materialisierung von Technologie und Geschlecht<br />
in <strong>de</strong>r Informatik <strong>de</strong>nkbar ist. Für das hier angestrebte Ziel, Gen<strong>de</strong>ringprozesse <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte theoretisch zu fundieren, erscheinen diese Ausführungen allerdings<br />
noch nicht weitreichend genug, da sie mit <strong>de</strong>n Geschlechter-Internet-Debatten im<br />
Bereich <strong>de</strong>s Diskursiven verbleiben<br />
Im Unterschied zu Winker richtet Barad die Aufmerksamkeit uf die Prozesse <strong>de</strong>r<br />
Materialisierung <strong>de</strong>s Materiellen. Mit <strong>de</strong>r „posthumanistischen Performativität“ (Barad<br />
2003) hat sie meines Erachtens das für das in diesem Kapitel verfolgte Vorhaben bisher<br />
am weitesten theoretisch ausgearbeitete Konzept vorgelegt. Posthumanistische<br />
Performativität baut zwar unter an<strong>de</strong>rem auf <strong>de</strong>m Butlerschen Performativitätskonzept<br />
auf, strebt jedoch <strong>de</strong>ssen materialistische, naturalistische und posthumanistische<br />
Reformulierung an (vgl. Barad 2003, siehe auch Barad 1998). Auch wenn sie primär<br />
von physikalische Objekten und Erkenntnissen ausgeht, lässt sich ihr Ansatz gut auf<br />
die Prozesse <strong>de</strong>r Technikgestaltung übertragen.<br />
Barad würdigt zunächst Butlers Vorstellung, Materie und Körper als „a process of<br />
materialization that stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and<br />
surface“ (Barad 1998, 90) zu begreifen. Denn diese habe einen wesentlichen Beitrag<br />
dazu geleistet, Körper als sozial konstruierte zu verstehen. Allerdings kritisiert sie, dass<br />
<strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>r Materialisierung dabei auf das Diskursive beschränkt bleibt. „[W]hile<br />
Butler’s temporal account of materialization displaces matter as a fixed and permanently<br />
boun<strong>de</strong>d entity, its temporality is analyzed only in terms of how discourse comes to<br />
matter. It fails to analyze how matter comes to matter” (Barad 1998, 90f, Hervorhebung<br />
im Orig.).<br />
Am Beispiel <strong>de</strong>r Ultraschalltechnologie zeigt Barad auf, dass es prinzipielle Unterschie<strong>de</strong><br />
gibt zwischen technologisch vermittelten und diskursiven Materialisierungsprozessen,<br />
<strong>de</strong>nn Geschlechtszuschreibungen nach <strong>de</strong>r Geburt grün<strong>de</strong>ten auf an<strong>de</strong>ren<br />
Voraussetzungen als solche, die vermittelt durch Ultraschallbil<strong>de</strong>r an Föten vorgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n. We<strong>de</strong>r die Produktion noch die Interpretation <strong>de</strong>r Ultraschallbil<strong>de</strong>r seien<br />
einfach materiell, vielmehr erfor<strong>de</strong>rten bei<strong>de</strong> hoch spezialisierte Formen <strong>de</strong>r Wissensgenerierung.<br />
„Producing a ‚good‘ ultrasound image is not as simple as snapping a<br />
picture; neither is reading one“ (Barad 1998, 101). Demzufolge materialisiert sich<br />
Geschlecht materiell-diskursiv.<br />
Nach Barad gibt Butlers Ansatz keine Einsichten o<strong>de</strong>r Werkzeuge an die Hand, wie<br />
materielle Dimensionen und materielle Beschränkungen Materialisierungsprozessen<br />
verstan<strong>de</strong>n und beschrieben wer<strong>de</strong>n können. Sie unterstelle das Materielle als gege-<br />
91
en statt seine Konstituiertheit begrifflich zu fassen. „What about the material limits: the<br />
material constraints and exclusions, the material dimension of agency, and the material<br />
dimensions of regulatory practices? Doesn’t an account of materialization that is attentive<br />
only to discursive limits reincribe this very dualism by implicitly reinstalling materiality<br />
in a passive role?“ (Barad 1998, 90f) Barad nimmt Butler also an, dass sie aufgrund<br />
ihres sprachphilosophischen Zugangs ihrer diskurstheoretisch bedingten<br />
Ignoranz materieller Prozesse <strong>de</strong>r Materie eine passive Rolle zuschreibe, anstatt diese<br />
als aktiv Han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong> und am Prozess <strong>de</strong>r Materialisierung Partizipieren<strong>de</strong> zu konzeptualisieren.<br />
Dies sei jedoch ein Rückfall in die für die Natur- und Technikwissenschaften<br />
typischen Repräsentationsansätze, die auf <strong>de</strong>r Cartesianischen Trennung von Subjekt<br />
und Objekt im Prozess <strong>de</strong>r Erkenntnisgewinnung basieren. Den Glauben an eine<br />
solche Möglichkeit, die „Dinge“ repräsentieren zu können, betrachtet Barad eher als<br />
historischen Zufall <strong>de</strong>nn als logische Notwendigkeit. Es sei eine cartesianisch geprägte<br />
Denkgewohnheit, welche durch <strong>de</strong>n ansonsten weitgehend post-repräsentationalistischen<br />
Zugang Butlers geistere und <strong>de</strong>n Blick auf die Materialisierungprozesse von<br />
Materie verstelle (vgl. Barad 1998, 90f, Barad 2003, 821, Fußnote 26).<br />
Barad versucht, diese Verengung von Butlers Konzept <strong>de</strong>r Performativität zu überwin<strong>de</strong>n,<br />
in<strong>de</strong>m sie mit <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r posthumanistischen Performativität einen<br />
„robust account of the materialization of all bodies – ‚human‘ and ‚non-human‘ – and<br />
the material-discursive practices by which their differential constitutions are marked“<br />
(Barad 2003, 810) vorlegt. Es gelingt ihr, das Konzept <strong>de</strong>r Materialisierung von<br />
biologischen Körpern, die sie mit Butler als Zitation von Normen begreift, auf Materie<br />
zu übertragen, in<strong>de</strong>m sie das Butlersche Performativitätskonzept mit ihrem eigenen<br />
theoretischen Ansatz <strong>de</strong>s „Agential Realism“ gegenliest. Auf dieser Basis liefert sie<br />
<strong>einer</strong>seits einen Ansatz, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r Intra-Aktion ein Verständnis <strong>de</strong>s<br />
Verhältnisses von materiellen und diskursiven Phänomenen zur Verfügung stellt und<br />
<strong>de</strong>r nicht-menschliche wie menschliche Formen <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit in ihrer<br />
asymmetrischen Relation umfasst. 152 An<strong>de</strong>rerseits trägt er zu einem „un<strong>de</strong>rstanding of<br />
the precise causal nature of productive practices that takes account of the fullness of<br />
matter’s implications in ongoing historicity“ (Barad 2003, 810) bei.<br />
Barad entwickelt also auf <strong>de</strong>r Grundlage von Butlers Ansatz ein performatives Verständnis<br />
<strong>de</strong>s Prozesses, wie sich Materialtiät und Geschlecht gleichzeitig materialisieren,<br />
welches sich für die Konzeptualisierung <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>ringprozesse von technischen<br />
Artefakten in dieser Arbeit hervorragend eignet. Zum einen wer<strong>de</strong>n auf diese<br />
Weise we<strong>de</strong>r Materie bzw. technische Artefakte noch Geschlechtlichkeit essentiell<br />
gedacht. Sie gelten vielmehr als Wie<strong>de</strong>rholungen von Handlungen und nicht als<br />
‚natürliche‘ o<strong>de</strong>r ‚unausweichliche‘ Materialisierungen. Dabei wer<strong>de</strong>n sie jedoch<br />
ebensowenig in Diskurs aufgelöst. Denn Barads ‚Ansatz <strong>de</strong>r posthumanistischen<br />
Performativität erkennt zugleich die Be<strong>de</strong>utsamkeit und Wi<strong>de</strong>rständigkeit <strong>de</strong>s Materiellen<br />
an. Zum an<strong>de</strong>ren lässt sich mit <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r posthumanistischen<br />
Performativität eine Vergeschlechtlichung von Technologien <strong>de</strong>nken, die noch im<br />
Wer<strong>de</strong>n begriffen sind. Dies erscheint für das Vorhaben, das Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte<br />
konzeptionell zu entwickeln, von Vorteil, da auch dabei auf Prozesse <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
fokussiert wird, d.h. auf Entwicklungen, die noch nicht abgeschlossen und<br />
152 Vgl. hierzu auch Kapitel 3.6.<br />
92
verfestigt sind. Barads Ansatz vermag ferner – wie angestrebt – Materialisierungen von<br />
Technik und Geschlecht zu erfassen, die sich nicht auf NutzerInnen o<strong>de</strong>r die<br />
Nutzungssituationen beschränken, wie dies beim Skriptkonzept vorausgesetzt wird,<br />
son<strong>de</strong>rn legt eine fundierte theoretische Basis dafür vor, wie sich das Verständnis <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung auf „technologies in the making“, die in <strong>de</strong>r Informatik häufig<br />
vorliegen, erweitern lässt. Allerdings befasst sich Barad selbst nicht explizit mit<br />
Technologien, son<strong>de</strong>rn fokussiert auf Materie bzw. materielle Objekte.<br />
Suchman zeigt, dass sich die Konzepte <strong>de</strong>r posthumanistischen Performativität und<br />
<strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technologien und Geschlecht, so wie sie von Winker<br />
ange<strong>de</strong>utet und von Barad theoretisch begrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, auf Produkte, Metho<strong>de</strong>n und<br />
Vorgehensweisen in <strong>de</strong>r Informatik übertragen lassen. Dabei lenkt Suchman <strong>de</strong>n Blick<br />
zwar weniger auf das Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte als auf die Neu-Verteilung von Handlungsfähigkeit,<br />
<strong>de</strong>nnoch geben ihre Ausführungen wesentliche Hinweise darauf, wie<br />
sich <strong>de</strong>r Transfer weiter <strong>de</strong>nken lässt. Suchman greift zur Beschreibung <strong>de</strong>s Prozesses<br />
<strong>de</strong>r Technologiegestaltung nicht auf Barad o<strong>de</strong>r Winker zurück, son<strong>de</strong>rn auf Butlers<br />
Performativitätskonzept. „Butler’s argument that sexed and gen<strong>de</strong>red bodies are<br />
materiallized over time through the reiteration of norms is suggestive for a view of technology<br />
construction as a process of materialization through a reiteration of form“<br />
(Suchman 2007, 272). So wie Butler behauptet, dass das körperliche Geschlecht eine<br />
dynamische Materialisierung ständig umkämpfter Geschlechternormen sei, können<br />
Dinge bzw. Objekte als Materialisierungen <strong>einer</strong> mehr o<strong>de</strong>r weniger umstrittenen normativen<br />
Gestaltung von Materie verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m bereits die Konstitution<br />
<strong>de</strong>s Subjekts für die feministische Theoriebildung zentral gewesen sei, käme es nun<br />
darauf an, auch die Objekte in <strong>einer</strong> Matrix historisch und kulturell konstitutierter<br />
Möglichkeiten zu verorten, die notwendigerweise ständig performativ wie<strong>de</strong>rholt<br />
wer<strong>de</strong>n. „Technologies like bodies, are both produced and <strong>de</strong>stabilized in the course of<br />
these reiterations“ (Suchman 2007, 272).<br />
Ausgehend von dieser Grundi<strong>de</strong>e lässt sich die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte in <strong>de</strong>m Sinne <strong>de</strong>nken, dass während <strong>de</strong>s Technologiegestaltungsprozesses,<br />
aber auch bei <strong>de</strong>r Nutzung auf Geschlechternormen zurückgegriffen wird, diese dabei<br />
allerdings zugleich jeweils neu zitiert wer<strong>de</strong>n. Da die Gestaltung von Informationstechnologien<br />
selbst zumeist explizit als ein iterativer Prozess organisiert wirdund das<br />
Produkt im gesamten Lebenszyklus stets verän<strong>de</strong>rbar bleibt, gibt es dabei immer<br />
wie<strong>de</strong>r Möglichkeiten, die bestehen<strong>de</strong> strukturell-symbolische Geschlechterordnung zu<br />
reproduzieren o<strong>de</strong>r zu unterlaufen. Mit Haraway, Barad und Winker lässt sich dieser<br />
Prozess als ein materiell-diskursiver verstehen, in <strong>de</strong>m Geschlecht und Informationstechnologie<br />
ko-materialisiert wer<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>m so gefassten Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte ist jedoch ausgehend von <strong>de</strong>r Akteur-Netzwerk-Theorie und ihren feministischen<br />
Reformulierungen zu berücksichtigen, dass technische Objekte stets in einem<br />
Netzwerk menschlicher und nicht-menschlicher AkteurInnen situiert sind. Diese<br />
spezifischen Verbindungen wie auch die darin vorgenommenen I<strong>de</strong>ntifikationen <strong>de</strong>s<br />
Technischen und Nicht-Technischen, d.h. die durch Netzwerke selbst hergestellten<br />
Einschlüsse und Ausschlüsse können dabei ebensovergeschlechtlicht sein. Im Anschluss<br />
an Barad sind menschliche und nicht-menschliche AkteurInnen in diesem<br />
Netzwerk nicht jedoch als gleichberechtigt anzunehmen, son<strong>de</strong>rn die spezifische<br />
menschliche Autorschaft, die insbeson<strong>de</strong>re auch bei <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen zu ver-<br />
93
orten ist, als asymmetrisch anzuerkennen. Diese Anerkennung be<strong>de</strong>utet jedoch zugleich<br />
– aus <strong>einer</strong> erkenntnistheoretischen, feministischen und gesellschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
Perspektive – verantwortliches Han<strong>de</strong>ln von <strong>de</strong>njenigen einzufor<strong>de</strong>rn, die an <strong>de</strong>m<br />
performativen Prozess <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technologie und Geschlecht<br />
beteiligt sind. Suchman zufolge besteht die Herausfor<strong>de</strong>rung vor allem darin, dabei<br />
keine erneuten Festschreibungen vorzunehmen, son<strong>de</strong>rn die Netzwerke als Effekt<br />
andauern<strong>de</strong>r, aber umstrittener soziomaterieller Praktiken zu verstehen: „The point to<br />
the end is not to assign agency either to persons or to things but to i<strong>de</strong>ntify the<br />
materialization of subjects, objects, and the relation between them as an effect, more<br />
or less durable and contestable, of ongoing sociomaterial practices“ (Suchman 2007,<br />
286).<br />
Nach diesen Ausführungen zur Materialisierung von Geschlecht und Technik lässt<br />
sich nun ein Ausblick auf die Möglichkeit <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
formulieren. Denn Suchman ruft explizit zu <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en Technikgestaltung auf, die<br />
auf <strong>de</strong>n Ansätzen von Haraway und Barad basiert und sich als eine Form <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
von Artefakten verstehen lässt. Sie schlägt zwei allgemeine Strategien vor, wie<br />
sich dieses Ziel beför<strong>de</strong>rn lässt: „accountable cuts“ und „expanding frames“ lauten<br />
dazu ihre bei<strong>de</strong>n Schlüsselkonzepte (Suchman 2007, 283). 153 Ihr erster Vorschlag<br />
besteht darin, die analytischen Trennlinien, sogenannte Schnitte (cuts), welche<br />
menschliche und nichtmenschliche AkteurInnen hervorbringen, verantwortungsvoll zu<br />
ziehen und dabei die Zuständigkeiten innerhalb <strong>de</strong>s heterogenen Netzwerks stets<br />
<strong>kritisch</strong> reflektierend zu verteilen. Es geht ihr darum, auf diese Weise soziomaterielle<br />
Assemblages zu erzeugen, die als Objekte <strong>de</strong>r Analyse und <strong>de</strong>r Intervention dienen<br />
können. 154 Was Suchman in ihrem Text primär von sozialwissenschaftlichen TechnikforscherInnen<br />
einfor<strong>de</strong>rt, lässt sich auf die Gestaltung von Technologien übertragen.<br />
Ein Ansatz <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring sollte <strong>de</strong>mnach im Kontext <strong>de</strong>r heterogenen Netzwerke<br />
die Trennlinien so ziehen, dass Ambivalenzen und Überschreitungen traditioneller<br />
Grenzen (zwischen Mensch und Maschine o<strong>de</strong>r zwischen spezifischen Verkörperungen<br />
von Geschlecht) <strong>de</strong>utlich wer<strong>de</strong>n. Die tatsächlichen Wirkungen und Ergebnisse<br />
<strong>kritisch</strong>-feministischer Eingriffe lassen sich dabei zwar – wie wir gesehen haben – nicht<br />
notwendigerweise absichtsvoll emanzipatorisch, <strong>de</strong>mokratisch, befähigend etc.<br />
steuern, wohl aber lässt sich in diesem Sinne versuchen, die Gestaltung von<br />
Technologie in eine <strong>kritisch</strong>-verantwortungsvolle Richtung zu lenken, die hierarchisieren<strong>de</strong>n<br />
Festschreibungen von Geschlecht entgegenwirkt.<br />
Die zweite Strategie, die Suchman vorschlägt, zielt auf eine Erweiterung <strong>de</strong>s<br />
Rahmens, <strong>de</strong>r durch die oft eng geführten Grenzen <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
beschränkt wird. Die <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Annahmen<br />
sollen aus <strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Perspektive hinterfragt, neu gestaltet und<br />
erweitert wer<strong>de</strong>n. Dies setzt zunächst die Analyse <strong>de</strong>r Grenzziehungsarbeit voraus,<br />
welche TechnologiegestalterInnen vornehmen, um die von ihnen kreierten Artefakte als<br />
153 Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 3.6 über Mensch-Maschine-Rekonfigurationen.<br />
154 Hier nimmt Suchman implizit Bezug auf Barads Begriff <strong>de</strong>s „agential cut“, <strong>de</strong>n letztere mit Hilfe <strong>de</strong>s Begriffs<br />
<strong>de</strong>r Intra-aktion erklärt: „A specific intra-action (involving a specific material configuration of the ‚apparatus<br />
of observation‘) enacts an agential cut (in contrast to a Cartesian cut – an inherent distinction –<br />
between subject and object) effecting a separation between ‚subject‘ and ‚object‘. That is, the agential cut<br />
enacts a local resolution within the phenomena of the inherent ontological in<strong>de</strong>terminancy“ (Barad 2003,<br />
815).<br />
94
solche zu konstruieren und abzugrenzen. Z.B. soll versteckte, nicht mehr sichtbare<br />
Arbeit herausgestelt wer<strong>de</strong>n, die häufig gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>njenigen AkteurInnen zugeschrieben<br />
o<strong>de</strong>r von ihnen ausgeführt wird, die sozio-kulturell als „Frauen“ gelten. Ebenso sollen,<br />
wi<strong>de</strong>rspenstige Kontingenzen, die die vermeintlichen Grenzen <strong>de</strong>s Rahmens überschreiten,<br />
<strong>de</strong>utlich gemacht wer<strong>de</strong>n. Dadurch entstehe eine neue Sichtweise auf Menschen<br />
und Maschinen, in <strong>de</strong>r diese durch spezifische, aber sich untereinan<strong>de</strong>r ständig<br />
verschieben<strong>de</strong> Netzwerke in ihrer Rekonfiguration stabilisiert wer<strong>de</strong>n. „The alternative<br />
perspective suggested here takes persons and machines as contingently stabilized<br />
through particular, more or less durable, arrangements whose reiteration and/or reconfiguration<br />
is the cultural or political project of <strong>de</strong>sign in which we are all continuously<br />
implicated. Responsibility on this view is met neither through control nor abdication but<br />
in ongoing practical, critical, and generative acts of engagement“ (Suchman 2007,<br />
285f).<br />
Wie solche alternativen Perspektiven aussehen können, führt Suchman selbst am<br />
Beispiel menschenähnlicher Maschinen, Roboter und an<strong>de</strong>rer Cyborgs vor, die häufig<br />
auf <strong>de</strong>m Vorverständnis <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung aufbauen, dass<br />
menschliche Eigenschaften in die Maschine hinein abzubil<strong>de</strong>n seien. Dazu führt sie<br />
<strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>r „Rematerialisierung“ von Körper und Subjektivität durch Technologie<br />
ein, mit <strong>de</strong>m sie wi<strong>de</strong>rständige, zu vorherrschen<strong>de</strong>n Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
entgegen gesetzte Formen umschreibt: „Framed not as the importation of<br />
mind into matter, but as the rematerialization of bodies and subjectivities in ways that<br />
challenge familiar assumptions about the naturalness of normative forms robots, and<br />
cyborg figures more generally, become sites for change rather than just for further<br />
reiteration“ (Suchman 2007, 275). Ausgehend von <strong>de</strong>r Vorstellung, dass sich Technologie<br />
und Geschlecht ko-materialisieren, lässt sich das De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte mit Suchman als eine Rematerialisierung begreifen, die darauf zielt,<br />
Verschiebungen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung von Geschlecht sowie von Mensch-Maschine-Grenzen<br />
zu produzieren.<br />
3.9. Resümee: Wie lässt sich das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
theoretisch konzipieren?<br />
Ziel dieses Kapitels war die Konzeption eines Ansatzes, <strong>de</strong>r das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte auf eine theoretisch fundierte Basis stellt. Da je<strong>de</strong>r Ansatz, <strong>de</strong>r versucht<br />
die Vergeschlechtlichung von Technologie zu fassen, explizit o<strong>de</strong>r implizit auf<br />
einem Verständnis <strong>de</strong>s Verhältnisses von Technik und Gesellschaft beruht, wur<strong>de</strong>n<br />
dazu zunächst grundlegen<strong>de</strong> Ansätze <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
daraufhin inspiziert, welchen Beitrag sie zu <strong>de</strong>m Vorhaben leisten können. Denn gera<strong>de</strong><br />
die sozialwissenschaftliche Technikforschung hat in <strong>de</strong>n letzten zwei Deka<strong>de</strong>n elaborierte<br />
Ansätze entwickelt, wie sich die Verwobenheit von Technik und Gesellschaft<br />
begreifen lässt. Die Diskussionen ver<strong>de</strong>utlichten, dass die Politik <strong>de</strong>r Artefakte und<br />
damit zugleich die Einschreibung <strong>de</strong>r Ungleichheitsstruktur Geschlecht in Technologie<br />
komplexer gedacht wer<strong>de</strong>n muss als sie als einen absichtsvollen Vorgang anzunehmen,<br />
bei <strong>de</strong>r GestalterInnen ihre Vorurteile direkt in <strong>de</strong>r Maschine materialisieren und<br />
Ungleichheiten somit auf Dauer stellen. Aus <strong>einer</strong> konstruktivistischen Sicht gilt es<br />
95
vielmehr, Essentialisierungen dieser Art zu vermei<strong>de</strong>n. Ebenso sind bekannte<br />
Verkürzungen im Verständnis von Technologie und Gesellschaft zu vermei<strong>de</strong>n, welche<br />
die frühen Ansätze sozialwissenschaftlicher Technikforschung prägten, wie etwa<br />
technik<strong>de</strong>terministische o<strong>de</strong>r sozial<strong>de</strong>terministische Positionen. Deshalb wur<strong>de</strong> hier<br />
stärker auf diejenigen Ansätze zurückgegriffen, die mit Konzepten von heterogenen<br />
Netzwerken, Cyborgs und Hybri<strong>de</strong>n arbeiten und von <strong>einer</strong> gegenseitigen Konstituierung<br />
<strong>de</strong>s Technischen und <strong>de</strong>s Sozialen ausgehen. Dazu gehören die Akteur-Netzwerk-Theorie<br />
sowie ihre Weiterentwicklungen durch feministische Theoretikerinnen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re durch Donna Haraway. Als beson<strong>de</strong>rs produktiv erwies sich <strong>de</strong>r Ansatz<br />
<strong>de</strong>s „Agential Realism“ von Karen Barad, <strong>de</strong>r über Verengungen <strong>de</strong>s Realismus wie<br />
<strong>de</strong>s Konstruktivismus hinausgeht. Sie verortet <strong>kritisch</strong>-politischen Wi<strong>de</strong>rstand bzw.<br />
feministische Interventionen – im Gegensatz zu Haraway – in <strong>de</strong>n Technowissenschaften<br />
selbst und geht von <strong>einer</strong> ontologischen Asymmetrie zwischen menschlichen<br />
und nicht-menschlichen AkteurInnen aus. Lucy Suchman hat diese Theorie auf die<br />
Informatik und ihre Artefakte übertragen. Ihr Begriff <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-<br />
Rekonfiguration for<strong>de</strong>rt eine <strong>kritisch</strong>e Umgestaltung <strong>de</strong>r Verhältnisse von Mensch und<br />
Technologie ein, für die sie in ihren Arbeiten bereits existieren<strong>de</strong> Beispiele anschaulich<br />
anführt. Alle drei Autorinnen – Haraway, Barad und Suchman – zielen mit ihren<br />
feministischen Ansätzen auf ein verantwortliches Han<strong>de</strong>ln und eine alternative<br />
Gestaltung von Technologie durch Technowissenschaften. Auf dieser Basis habe ich<br />
im Laufe <strong>de</strong>r Abschnitte 3.1 bis 3.6 ein theoretisches Rahmenkonzept entwickelt,<br />
� das nicht auf <strong>einer</strong> essentialistischen Unterscheidung zwischen Menschen und<br />
Artefakten beruht – und damit eine Analyse ermöglicht, wie Menschen und Artefakte<br />
konstituiert sind und wie Handlungsfähigkeit zwischen diesen verteilt ist,<br />
� das gleichzeitig davon ausgeht, dass technische Artefakte politisch sind – und auf<br />
dieser Grundlage Vergeschlechtlichung in <strong>de</strong>n Blick bekommt,<br />
� und das neue Formen <strong>de</strong>r feministisch-gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Intervention in soziomateriellen<br />
bzw. materiell-diskursiven technowissenschaftlichen Praktiken zu<br />
entwickeln und damit ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zu konzeptualisieren<br />
vermag.<br />
Was <strong>de</strong>r mit Haraway, Barad und Suchman vorgeschlagene theoretische Rahmen<br />
noch offen lässt, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n letzten Teilen 3.7. und 3.8. dieses Kapitels konkretisiert.<br />
Es wur<strong>de</strong>n Konzepte vorgestellt, wie Geschlecht in informatische Artefakte eingeschrieben<br />
wird, d.h. wie sich <strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte verstehen lässt. Zurückgegriffen wur<strong>de</strong> dabei zunächst auf Ansätze <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung wie Skripte, Gen<strong>de</strong>rskripte und Konfigurierungen<br />
von NutzerInnen, die Vorstellungen von Technikgestalten<strong>de</strong>n über NutzerInnen<br />
und Nutzungsweisen konzeptualisieren. Dabei erwies sich insbeson<strong>de</strong>re das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept<br />
als nützlich, um die Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten differenzierter<br />
zu begreifen. Dennoch birgt auch dieses Konzept Engführungen, ist theoretisch<br />
verkürzend und vermag somit nicht, <strong>de</strong>n zuvor entwickelten theoretischen Rahmen<br />
auszufüllen. Mit Hilfe von Barads Konzept ‚posthumanistischer Performativität‘ ließ sich<br />
das Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten jedoch reformulieren. Auf die Informatik angewandt ist<br />
dieses Konzept – wie es Suchman vorschlägt, allerdings nicht ausführt – sowohl in <strong>de</strong>r<br />
96
Lage, die Vergeschlechtlichung von Anwendungssoftware und Nutzungsoberflächen zu<br />
erfassen als auch die Vergeschlechtlichung von „technologies in the making“ in <strong>de</strong>n Laboren<br />
<strong>de</strong>r Informatik theoretisch zu begreifen, die überkommene Grenzziehungen zwischen<br />
menschlicher und nichtmenschlicher Handlungsträgerschaft bzw. zwischen Sozialem<br />
und Technischem unterlaufen. Es geht damit über die in <strong>de</strong>r feministischen<br />
Technikforschung übliche Interpretation <strong>de</strong>r „Ko-Konstruktion von Technik und Geschlecht“<br />
hinaus, die als gegenseitige, aber analytisch trennbare Formung betrachtet<br />
wird. Denn Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Materialem/ Objekten/ technischen Artefakten<br />
wer<strong>de</strong>n als eine Ko-Materialisierung verstan<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>r sich die Materialisierung von<br />
Artefakten und <strong>de</strong>ren Vergeschlechtlichung nicht mehr voneinan<strong>de</strong>r trennen lassen.<br />
Posthumanistische Performativität bleibt nicht – wie Butlers entsprechen<strong>de</strong>s Konzept –<br />
bei Diskursen und damit an <strong>de</strong>r Oberfläche <strong>de</strong>s Körperlich-Materiellen stehen: „matter<br />
is not simply ‚a kind of citationality‘, the surface effect of human bodies, or the end product<br />
of linguistic or discursive acts. Material constraints and exclusions and the material<br />
dimensions of regulatory practices are important factors in the process of materialization“<br />
(Barad 2003, 273).<br />
Insgesamt vermögen die Konzepte <strong>de</strong>r posthumanistischen Performativität und Ko-<br />
Materialisierung von Technik und Geschlecht Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte zu konzeptualisieren, ohne diese wie beim Skriptkonzept auf Repräsentationen<br />
von NutzerInnen und damit auf die Entwicklung von Anwendungstechnologien zu<br />
verengen. Darüber hinaus lässt sich dieses Verständnis <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von<br />
Technologie in das theoretische Rahmenkonzept einordnen, das in diesem Kapitel<br />
erarbeitet wur<strong>de</strong>. Denn es<br />
� erfasst die Neuverteilung von Handlungsfähigkeit zwischen menschlichen und<br />
nicht-menschlichen AkteurInnen und lässt traditionelle Dichotomien hinter sich,<br />
ohne in technik<strong>de</strong>terministische o<strong>de</strong>r sozial<strong>de</strong>termininistische Positionen<br />
zurückzufallen,<br />
� begreift das Gen<strong>de</strong>ring dabei we<strong>de</strong>r auf Basis eines essentialistischen Geschlechterverständnisses<br />
noch als ausschließlich diskursiv konstruiert, son<strong>de</strong>rn als einen<br />
Prozess <strong>de</strong>r Materiell-Werdung mit und durch technische Artefakte, die<br />
Regulierungen unterliegen und materielle Beschränkungen aufweisen,<br />
� ermöglicht die Beschreibung von alternativen Technikgestaltungsprozessen, die als<br />
Ausgangspunkte für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte dienen können. Als<br />
beson<strong>de</strong>rs produktiv erwies sich in dieser Hinsicht Suchmans Begriff <strong>de</strong>r Rematerialisierung,<br />
<strong>de</strong>r gera<strong>de</strong> auch wi<strong>de</strong>rständige Formen <strong>de</strong>r Technologiegestaltung umfassen<br />
kann, sowie ihre strategischen Vorschläge zu verantwortungsvollen<br />
Schnitten und Rahmenerweiterungen.<br />
Mit diesem Ansatz, Geschlecht und Technologie als performative Ko-Materialisierung<br />
zu <strong>de</strong>nken, wird eine Fundierung für das folgen<strong>de</strong> Kapitel vorgelegt, in <strong>de</strong>m konkrete<br />
Fallstudien <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte beschrieben und Mechanismen<br />
<strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Prozesse herausgearbeitet wer<strong>de</strong>n. Viele Studien, auf<br />
die ich mich darin beziehen wer<strong>de</strong>, sind zwar im Rahmen eines an<strong>de</strong>ren theoretischen<br />
Paradigmas entstan<strong>de</strong>n, das häufig eher mit <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept kompatibel ist.<br />
Jedoch verweist das in diesem Kapitel vorgestellte Konzept <strong>de</strong>r „posthumanistischen<br />
97
Performativät“ auf Leerstellen und Verkürzungen in diesen Untersuchungen, weshalb<br />
diese Studien zugleich neu interpretiert und weiter entwickelt wer<strong>de</strong>n. Es ermöglicht<br />
darüber hinaus, informatische Grundlagenforschung und Technologien aus <strong>einer</strong><br />
feministischen Perspektive zu untersuchen, die keine klaren Grenzen zwischen<br />
Nutzung und Gestaltung voraussetzen und die auf Konfigurationen, zugleich aber auch<br />
Rekonfigurationen <strong>de</strong>s Mensch-Maschine-Verhältnisses <strong>de</strong>uten.<br />
98
Kapitel 4 Die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte: Fallstudien,<br />
Dimensionen und Mechanismen<br />
In diesem Kapitel wird gezeigt, dass und wie die Produkte, Grundannahmen und<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Informatik vergeschlechtlicht sind. Hauptziel <strong>de</strong>s Kapitels ist eine<br />
systematische Bestandsaufnahme und Analyse <strong>de</strong>r Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring. Es sollen<br />
Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
herausgearbeitet und anhand ausgewählter Fallstudien ausführlich vorgestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Dazu wird hauptsächlich auf Studien aus <strong>de</strong>r feministischen Wissenschafts- und<br />
Technikforschung, zum Teil auch auf Untersuchungen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in<br />
<strong>de</strong>r Informatik, zurückgegriffen. Dort, wo es sich anbietet, wer<strong>de</strong>n erste Ansätze potentieller<br />
Strategien zur Entgegenwirkung <strong>de</strong>r erkannten Vergeschlechtlichungsprozesse<br />
diskutiert. Auf diese wird im Kapitel 5 zurückgegriffen.<br />
In Abschnitt 4.0. wer<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Basis von Untersuchungen zu Spracherkennungssoftware,<br />
Tastatur, <strong>de</strong>m Gerät „Computer“ und <strong>de</strong>m Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>n<br />
Design von Rasierapparaten drei Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
technischer Artefakte herausgearbeitet, die das verbleiben<strong>de</strong> Kapitel strukturieren<br />
wer<strong>de</strong>n. Die erste Dimension, die in Abschnitt 4.1. beschrieben wird, umfasst Problem<strong>de</strong>finitionen<br />
und Annahmen, die <strong>de</strong>r Technologie zugrun<strong>de</strong> liegen und gesellschaftlichsoziale<br />
Ausschlüsse bei ihrer Nutzung produzieren. Zunächst wird anhand <strong>de</strong>s USamerikanischen<br />
Girls-Game-Movement <strong>de</strong>r 1990er Jahre diskutiert, ob solche Ausschlüsse<br />
auf implizites Design „von und für Männer“ (4.1.1.) zurückzuführen und ob<br />
sie durch ein „Design for the Girl“ (4.1.2.) zu verhin<strong>de</strong>rn sind. Anschließend wer<strong>de</strong>n<br />
Vergeschlechtlichungen von Technologien im Sinne eines strukturell erschwerten<br />
Zugangs zur Nutzung für bestimmte Personengruppen an <strong>de</strong>n Beispielen „intelligenter<br />
Häuser“ (4.1.3.) und „digitaler Städte“ (4.1.4.) ver<strong>de</strong>utlicht. Dabei wird die so genannte<br />
„I-methodology“, nach <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen sich selbst unhinterfragt als NutzerInnen<br />
<strong>de</strong>r Produkte imaginieren und dadurch ihre eigenen Selbstverständnisse,<br />
Werte, Vorlieben etc. in <strong>de</strong>r Technologie vergegenständlichen, als ein Mechanismus<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien i<strong>de</strong>ntifiziert.<br />
Gegenstand <strong>de</strong>s Abschnitts 4.2. ist die zweite herausgearbeitete Dimension <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Technologien: die Digitalisierung strukturell-symbolischer<br />
Ungleichheit. Darunter wer<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne Aspekte <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
Geschlechterordnung, die technologisch fortgeschrieben wer<strong>de</strong>n, zusammengefasst.<br />
Dazu gehört erstens die Einschreibung geschlechtsstereotyper Vorstellungen über<br />
Kompetenzen <strong>de</strong>r NutzerInnen, beispielsweise die Formel „Sekretärinnen sind qua<br />
Geschlecht technisch inkompetent“, die einem frühen Textverarbeitungssystem als<br />
NutzerInnenbild eingeschrieben ist (4.2.1.). Zweitens können geschlechtlich kodierte<br />
Strukturen wie die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung, wenn sie im Anwendungsfeld<br />
vorliegen, in Softwaresystemen festgeschrieben wer<strong>de</strong>n (4.2.2.). Häufig wird<br />
drittens „invisible work“, d.h. bestimmte Aspekte von Tätigkeiten, die häufig von Frauen<br />
ausgeübt o<strong>de</strong>r ihnen zugeschrieben wer<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>r Softwareentwicklung ignoriert und<br />
<strong>de</strong>shalb technisch nicht unterstützt. Anhand von Dokumentationstätigkeiten in<br />
Rechtsanwaltskanzleien und Pflegearbeit im Krankenhaus wird diskutiert, inwiefern das<br />
Sichtbarmachen unsichtbarer Arbeit dieser Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung entgegenwirken<br />
kann (4.2.3.) o<strong>de</strong>r dazu führt, sie zu automatisieren, so wie etwa Callcenter-<br />
99
Arbeit in <strong>de</strong>r Dienstleistunggesellschaft zunehmend von virtuellen Assistentinnen<br />
übernommen wird (4.2.4.). Als vierter und letzter Aspekt <strong>de</strong>r Fortschreibung von<br />
Differenz und Ungleichheit in Technologien wird die explizite Repräsentation von<br />
geschlechtlich markierten Körpern am Beispiel von Avataren, Figuren in Computerspielen<br />
und anthropomorphen Softwareagenten diskutiert (4.2.5.). Sämtliche <strong>de</strong>r in<br />
Abschnitt 4.2. beschriebenen Formen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung sind mit unreflektierten<br />
hegemonialen Vorstellungen über Frauen, Männer, vermeintlich geschlechtsspezifische<br />
Kompetenzen und gesellschaftliche Arbeitsteilung verbun<strong>de</strong>n.<br />
In Abschnitt 4.3. wer<strong>de</strong>n Formalismen, Grundlagen und Grundlagenforschungen <strong>de</strong>r<br />
Informatik untersucht. Dabei wer<strong>de</strong>n Prozesse <strong>de</strong>r Formalisierung, Klassifizierung und<br />
Dichotomisierung, die zwar „an sich“ neutral, objektiv und „unschuldig“ erscheinen, in<br />
ihrem Resultat und Gebrauch jedoch (geschlechter-)politisch wirksam sind, als dritte<br />
Dimension <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte i<strong>de</strong>ntifiziert. Der Abschnitt<br />
4.3.1. führt zunächst in die Geschlechterpolitik <strong>de</strong>s Formalen ein und diskutiert<br />
erste Beispiele. Dazu gehören Algorithmen und Schwellenwerte, die Geschlechterdifferenzen<br />
sichtbar o<strong>de</strong>r unsichtbar machen, Klassifikationen in Informationssystemen,<br />
die Ausschlüsse <strong>de</strong>sjenigen Wissens herstellen, das „weiblich“ konnotiert ist, o<strong>de</strong>r in<br />
Technologie eingeschriebene Ontologien, die Macht- und damit Geschlechterverhältnisse<br />
verstärken können. Zugleich wird das Potential verschie<strong>de</strong>ner Konzeptionen<br />
feministischer Objektivität für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>s Formalen ausgelotet. Abschnitt<br />
4.3.2. fokussiert stärker auf epistemologische und ontologische Aspekte <strong>de</strong>s Formalen.<br />
Dabei wird etwa nachgewiesen, dass das Subjekt <strong>de</strong>s Wissens, das in Informationssystemen<br />
repräsentiert ist, ein vergeschlechtlichtes sein kann. Ferner wird aufgezeigt,<br />
dass in <strong>de</strong>r Informatik dominante Mo<strong>de</strong>llierungsmetho<strong>de</strong>n gera<strong>de</strong> diejenigen Bereiche,<br />
die – wie beispielsweise das Körperliche, Soziale, Emotionale – traditionell <strong>de</strong>m<br />
„Weiblichen“ zugeordnet wer<strong>de</strong>n, nicht zu erfassen vermag. In Abschnitt 4.3.3. wer<strong>de</strong>n<br />
geschlechtsmarkierte Dualismen wie Nutzung-Gestaltung, Körper-Geist und Emotion-<br />
Rationalität analysiert, die Technologien bzw. <strong>de</strong>r Informatik zugrun<strong>de</strong> liegen. Anhand<br />
von Softwareentwicklung, verhaltensbasierter Robotik und anthropomorphen<br />
Softwareagenten wird die Reichweite möglicher De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien wie die<br />
Anerkennung und Integration <strong>de</strong>s jeweils Ausgegrenzten sowie die Dekonstruktion von<br />
Dichotomien diskutiert. Abschnitt 4.4. fasst schließlich die in Kapitel 4 herausgearbeiteten<br />
Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte zusammen.<br />
4.0. Von „guten Beispielen“ zu Dimensionen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte<br />
Von „best practice“-Beispielen ist heutzutage in vielen Bereichen die Re<strong>de</strong> – von <strong>de</strong>r<br />
Agenda 21 über die Gesundheitsbildung bis hin zur Vereinbarkeit von Beruf und<br />
Familie. Dabei wird in <strong>de</strong>r Regel davon ausgegangen, dass ein anschauliches Beispiel<br />
überzeugen<strong>de</strong>r ist als die umfassen<strong>de</strong> Beschreibung eines Vorhabens. Ziel dieses<br />
Kapitels ist es, die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte aufzuzeigen. Auch<br />
hierfür lässt sich zunächst nach „guten Beispielen“ fragen. Gute Beispiele für die<br />
Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte müssten <strong>de</strong>r üblichen Logik folgend<br />
100
jedoch eher als „worst practice“-Beispiele bezeichnet wer<strong>de</strong>n, da sie zeigen, wie<br />
Technologiegestaltung zur Reproduktion <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n strukturell-symbolischen<br />
Geschlechterordnung beiträgt. Das Kriterium „gut“ ist bei diesen Beispielen dagegen<br />
daran anzusetzen, ob sie das Anliegen, <strong>de</strong>konstruktive Ansätze <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
in <strong>de</strong>r Informatik zu begrün<strong>de</strong>n und zu implementieren, forcieren. Ein Problem<br />
<strong>de</strong>r Suche nach guten Beispielen besteht darin, dass bislang nur vereinzelt<br />
anschauliche Beispiele für die Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Technikentwicklung in <strong>de</strong>r<br />
Informatik vorliegen.<br />
Eines <strong>de</strong>r wenigen eingängigen Beispiele, das auch von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sbildungsministerin<br />
<strong>de</strong>s Kabinetts Merkel angeführt wur<strong>de</strong> (vgl. Schavan 2007), ist das <strong>de</strong>r<br />
frühen Spracherkennungssysteme. Von diesen Systemen wird wie<strong>de</strong>rholt berichtet,<br />
dass sie nicht in <strong>de</strong>r Lage waren, „Frauenstimmen“ aufgrund ihrer gegenüber „Männerstimmen“<br />
höheren Frequenzen gut zu erkennen (vgl. etwa Bührer/ Schraudner 2006,<br />
6). 155 Für das Beispiel lassen sich zwar kaum wissenschaftliche Belege fin<strong>de</strong>n. Doch<br />
es illustriert, dass Artefakte entstehen können, die im Effekt Frauen als soziale Gruppe<br />
konstituieren, versämtlichen und von <strong>de</strong>r Nutzung dieser Technologie ausschließen,<br />
wenn Vergeschlechtlichungsprozesse in <strong>de</strong>r Entwicklung von Technologien nicht<br />
<strong>kritisch</strong> reflektiert wird. Mit Hilfe dieses Beispiels lässt sich leicht – auch auf <strong>einer</strong><br />
politischen statt auf <strong>einer</strong> ausschließlich wissenschaftlichen Ebene – dafür argumentieren,<br />
dass Konstruktionen von Geschlecht in <strong>de</strong>r Technikgestaltung zu berücksichtigen<br />
sind. Es bleibt allerdings bei <strong>de</strong>r Verankerung <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht in als strikt<br />
binär angenommenen körperlichen Differenzen stehen und erfasst damit – wenn<br />
überhaupt – nur einen sehr kleinen Teil jenes Gegenstands, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung<br />
verhan<strong>de</strong>lt wird.<br />
Um das Ausmaß <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte aufzuzeigen, sind weitere<br />
Belege notwendig, die auf strukturell-symbolische Dimensionen von Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
verweisen. Darüber hinaus sind zugleich die Erkenntnisse, die im<br />
letzten Kapitel auf <strong>einer</strong> theoretischen Ebene über die Verhältnisse von Technik und<br />
Gesellschaft gewonnen wur<strong>de</strong>n, auf die gesuchten Beispiele anzuwen<strong>de</strong>n, ist doch<br />
dort anhand <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>r Brücken, mit <strong>de</strong>nen Winner die Politik <strong>de</strong>r Artefakte<br />
plausibel gemacht hat, <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n, dass sein Ansatz theoretische Fallstricke<br />
birgt, die es für <strong>de</strong>n Fall <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Artefakten ebenso zu vermei<strong>de</strong>n<br />
gilt. Der hohe Anspruch, wonach die gesuchten Beispiele <strong>einer</strong>seits einfach und<br />
anschaulich sein und an<strong>de</strong>rerseits <strong>de</strong>n aktuellen Forschungsstand <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung sowie <strong>de</strong>r Geschlechterforschung wi<strong>de</strong>rspiegeln sollten,<br />
erscheint somit ambivalent o<strong>de</strong>r zumin<strong>de</strong>st schwer einlösbar. 156<br />
155 Martina Schraudner (2006, 7) führt aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Informatik ein weiteres leicht vermittelbares<br />
Beispiel an. Eine Zweigeschlechtlichkeit voraussetzen<strong>de</strong> und reproduzieren<strong>de</strong> Befragung von SeniorInnen<br />
im Vorfeld <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Haushaltroboters „Car-O-Bot“ generalisierte als Ergebnis, dass die soziale<br />
Gruppe „Männer“ sich von <strong>de</strong>m Artefakt Hilfe bei Haushalttätigkeiten wünschten, während die soziale<br />
Gruppe „Frauen“ darin eine Unterstützung für die Körperpflege suchten. Diese unterschiedlichen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen an eine (imaginierte) Technologie zu berücksichtigen, kann aus marktwirtschaftlichen<br />
Grün<strong>de</strong>n sicherlich hilfreich sein und <strong>de</strong>n Verkauf und das Marketing entsprechen<strong>de</strong>r Produkte för<strong>de</strong>rn.<br />
Allerdings geben sie keine wissenschaftliche Erklärung, worauf diese vergeschlechtlichte Differenzierung<br />
und Konstituierung sozialer Gruppen basieren und warum sie durch ein entsprechen<strong>de</strong>s Design von<br />
Technologien fortgeschrieben wer<strong>de</strong>n sollten.<br />
156 Deutlicher wird diese Schwierigkeit, „gute Beispiele“ für die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte zu fin<strong>de</strong>n, anhand <strong>de</strong>r Kriterien, die ich inspiriert von <strong>de</strong>r Stellung von Beispielen in <strong>de</strong>r<br />
Mathematik und theoretisch begrün<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r sozialkonstruktivistischen Geschlechter-Technik-Forschung<br />
101
Bevor ich weiter unten auf die Diskussion „guter Beispiele“ zurückkomme wer<strong>de</strong> und<br />
die Strukturierung <strong>de</strong>s Kapitels erläutere, wer<strong>de</strong>n zunächst techniksoziologische<br />
Fallstudien zur Tastatur, die bis heute die gängigste Schnittstelle zu Computern<br />
darstellt, zum Gerät „Computer“ sowie zum technischen Design von Rasierapparaten<br />
vorgestellt, die als Kandidaten für solche guten Beispiele gelten können. Anhand dieser<br />
Fallanalysen wer<strong>de</strong>n Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtichung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
herausgearbeitet.<br />
Die Schreibmaschinentastatur stellt für Nina Degele (2002, 51) eine prominentes<br />
Beispiel dar, das in <strong>de</strong>r Techniksoziologie einen ähnlichen Rang einnähme wie<br />
Winners Brückenbeispiel. Die historische Entwicklung <strong>de</strong>s Artefakts steht in diesem<br />
Feld primär für das Festhalten an <strong>einer</strong> frühen technischen Lösung trotz existieren<strong>de</strong>r<br />
funktional besserer Alternativmo<strong>de</strong>lle. An diesem Beispiel lässt sich zugleich die<br />
Vergeschlechtlichung von (informations-)technologischen Artefakten vorführen. Buhr<br />
und Buchholz (1999) berichten von verschie<strong>de</strong>nen Alternativen bei <strong>de</strong>r Entwicklung<br />
von Schreibmaschinen auf <strong>de</strong>m Weg zu <strong>de</strong>r bis heute üblichen QWERTY-Tastatur. 157<br />
Es gab Vorschläge, die Tasten kreisförmig anzuordnen, an <strong>de</strong>r Klaviatur zu orientieren<br />
o<strong>de</strong>r sie wie die Stachel eines Igels zu konzipieren, bis 1867 ein Prototyp mit<br />
vierreihiger Tastatur entstand. Die Anordnung <strong>de</strong>r Tasten wur<strong>de</strong> zunächst daran<br />
ausgerichtet, dass die am häufigsten gebrauchten Buchstaben von <strong>de</strong>n damals als am<br />
kräftigsten angenommenen Fingern bedient wer<strong>de</strong>n konnten. Da sich dabei allerdings<br />
die Typenhebel <strong>de</strong>r Tasten häufig verhakten, än<strong>de</strong>rte man das Arrangement<br />
dahingehend, dass die oft gebrauchten Buchstaben weit auseinan<strong>de</strong>r gelegt wur<strong>de</strong>n.<br />
Das spezifische Design <strong>de</strong>r QWERTY-Tastatur ist damit primär auf mechanische<br />
Gesichtspunkte zurückzuführen.<br />
Obwohl die Ergonomie dieser Anordnung seither immer wie<strong>de</strong>r als schlecht<br />
reklamiert wur<strong>de</strong> und seit 1936 eine messbar bessere Alternative zur Verfügung<br />
stand, 158 hielt man seither <strong>de</strong>nnoch an <strong>de</strong>m etablierten Mo<strong>de</strong>ll fest. Selbst mit <strong>de</strong>m<br />
Beginn <strong>de</strong>s PC-Zeitalters, als eine weitere historische Chance zur grundlegen<strong>de</strong>n<br />
Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Designs bestand, wur<strong>de</strong> das QWERTY-Prinzip beibehalten. Dieses<br />
Beispiel weist somit darauf hin, dass die Durchsetzung <strong>einer</strong> bestimmten Technologie<br />
nicht notwendigerweise auf eine technisch-funktionale Überlegenheit zurückzuführen<br />
ist, son<strong>de</strong>rn auf frühe organisatorische Weichenstellungen.<br />
Eine feministische Analyse <strong>de</strong>r beteiligten AkteurInnen zeigt, dass die Geschlechterverhältnisse<br />
bei dieser anfänglichen Festlegung eine wesentliche Rolle gespielt hatten.<br />
aufgestellt habe. Gute Beispiele sollten i<strong>de</strong>alerweise 1. allgemein verständlich, plausibel und eingängig<br />
sein, 2. sich nicht auf die „Frauenfrage“ reduzieren lassen (<strong>de</strong>nn sonst wären die Gleichstellungsbeauftragten<br />
zuständig), 3. nicht <strong>de</strong>m Vorurteil „Feminismus = Geschlechterkampf“ Vorschub leisten (<strong>de</strong>nn<br />
sonst wären sie wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen), 4. das Zweigeschlechtlichkeitssystem nicht<br />
zementieren (<strong>de</strong>nn sonst wür<strong>de</strong>n sie sowohl <strong>de</strong>m aktuellen Stand <strong>de</strong>r Geschlechterforschung nicht<br />
Rechnung tragen als auch innerhalb <strong>de</strong>r Informatik angreifbar sein), 5. sich nicht auf die Auswirkungen<br />
von Technisierung beschränken (<strong>de</strong>nn sonst wür<strong>de</strong>n viele TechnikwissenschaftlerInnen die Frage auf<br />
SozialwissenschaftlerInnen abzuwälzen versuchen statt sich selbst mit Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
auseinan<strong>de</strong>rzusetzen), 6. die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r konkreten Form betonen (<strong>de</strong>nn sonst wären<br />
PraktikerInnen zuständig, welche äußerliche, (geschlechts-)differenzieren<strong>de</strong> und spezifizieren<strong>de</strong> Formen<br />
umbauen könnten, ohne dass die Technologie selbst o<strong>de</strong>r ihre theoretischen Grundlagen davon betroffen<br />
wären), und 7. wissenschafts- und technikentwicklungsimmanent argumentieren und für die Informatik<br />
bzw. Technikwissenschaften relevant sein; vgl. Bath 2002b.<br />
157 QWERTY bezeichnet die Tastenfolge <strong>de</strong>r zweiten Reihe <strong>einer</strong> Standardtastatur.<br />
158 Degele berichtet von Untersuchungen, nach <strong>de</strong>nen die alternative Tastatur die Schreibgeschwindigkeit<br />
um 40% gesteigert habe; vgl. Degele 2002, 51.<br />
102
Buhr und Buchholz (1999) weisen auf groß angelegte Werbekampagnen hin, die nach<br />
Aussagen <strong>de</strong>r Hersteller En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts, als die ersten Schreibmaschinen<br />
industriell hergestellt wur<strong>de</strong>n, notwendig gewor<strong>de</strong>n waren, weil es keinen Markt für<br />
diese Geräte gab. Die Kampagnen zielten <strong>einer</strong>seits darauf, die – damals vorwiegend<br />
männlichen und gut bezahlten – Stenographen als Nutzer zu gewinnen. An<strong>de</strong>rerseits<br />
wur<strong>de</strong> versucht, die Attraktivität <strong>de</strong>s Geräts mit Hilfe erotisch-verführerischer<br />
Vorführdamen zu steigern, womit zugleich die leichte Bedienbarkeit <strong>de</strong>monstriert<br />
wer<strong>de</strong>n sollte. Die erste Werbestrategie war in <strong>de</strong>m Sinne erfolgreich, dass sich<br />
Wettbewerbe im Schnellschreiben nach kurzer Zeit großer Beliebtheit erfreuten und<br />
viele Stenographen hierfür eine sportliche Lei<strong>de</strong>nschaft entwickelten. Dies ließe sich<br />
als Anekdote verstehen, hätte nicht diese Nutzergruppe <strong>de</strong>r Stenographen die<br />
QWERTY-Tastatur <strong>de</strong>n Herstellern als Norm vorgeschlagen, um gleiche Ausgangsbedingungen<br />
bei <strong>de</strong>n Wettbewerben zu schaffen. Die Festschreibung <strong>de</strong>r Tastatur<br />
erfolgte <strong>de</strong>mnach aufgrund <strong>de</strong>r übereinstimmen<strong>de</strong>n Interessenlagen von Schreibmaschinenherstellern<br />
und wettschreiben<strong>de</strong>n Stenographen, die zur Zeit <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong><br />
vorwiegend Männer waren. Buhr und Buchholz skizzieren die Konsequenzen<br />
dieser Festschreibung folgen<strong>de</strong>rmaßen: „Dieser Standard wur<strong>de</strong> auch dann<br />
beibehalten, als sich die Einsatzbedingungen gravierend geän<strong>de</strong>rt hatten. Als <strong>de</strong>r<br />
Glanz <strong>de</strong>r Wettbewerbe verblasst war und das Maschineschreiben zur wenig spektakulären,<br />
dafür aber umso mühsameren alltäglichen schlechtbezahlten Frauenarbeit<br />
wur<strong>de</strong>, fehlte <strong>de</strong>n Herstellen<strong>de</strong>n das Interesse, eine dafür besser geeignete Tastatur zu<br />
konstruieren“ (Buhr/ Buchholz 1999, 182). Damit übergehen Buhr und Buchholz<br />
jedoch, dass die das berufliche Stenographieren <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> dominieren<strong>de</strong>n<br />
Männer sich ebenso aus spezifischen sozialen, ethnischen und religiösen Milieus<br />
rekrutierten wie die das spätere berufliche Stenographieren dominieren<strong>de</strong>n Frauen.<br />
Unter Absehung von <strong>de</strong>r Komplexität <strong>de</strong>s historisch je konkreten Zusammenspiels von<br />
Geschlecht mit an<strong>de</strong>ren sozialen Differenzierungs- und Hierarchisierungsmustern<br />
reduzieren Buhr und Buchholz die soziale Prägung <strong>de</strong>r Tastatur auf die schlichte<br />
binäre Logik „männlich“/„weiblich“. Sie rekonstruieren und reflektieren also nicht die<br />
Konstitution von Zweigeschlechtlichkeit, son<strong>de</strong>rn reproduzieren sie.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz macht das Beispiel für die hier diskutierte Frage <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
von Technologie auf mehrere Aspekte aufmerksam: Erstens zeigt die<br />
Fallstudie, dass als „männlich“ und „weiblich“ angenommene Konnotationen von Artefakten<br />
kulturell-historischen Wandlungen unterliegen. Dabei können Technologien<br />
auch „Geschlechtswechsel“ vollziehen, in<strong>de</strong>m sich strukturell verän<strong>de</strong>rt, wer diese<br />
vorwiegend nutzt und bedient (beim Beispiel <strong>de</strong>r Schreibmaschinentastatur war ein<br />
Wan<strong>de</strong>l vom Sekretär zur Sekretärin festzustellen). Die Studie schließt insofern bei<br />
aller Begrenztheit an Erkenntnisse <strong>de</strong>r neueren Geschlechterforschung an, nach <strong>de</strong>r<br />
Geschlecht und die Vergeschlechtlichung technischer Artefakte keine außersoziale und<br />
feststehen<strong>de</strong> Größe ist, die in als außerhistorisch gedachten Körper verankert<br />
angenommen wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn sie wer<strong>de</strong>n als sozial konstruiert verstan<strong>de</strong>n. Sie weist<br />
darauf hin, dass vergeschlechtlichte Zuweisungen zu bestimmten Artefakten kulturell<br />
und historisch situiert sind – ebenso wie die Technologie selbst.<br />
103
Zweitens lenkt das Beispiel <strong>de</strong>n Blick darauf, dass eine bestimmte als<br />
geschlechtshomogen angenommene NutzerInnengruppe die „Schließung“ 159 technischer<br />
Optionen beför<strong>de</strong>rn und damit ein alternatives Design ausschließen kann. Buhr<br />
und Buchholz folgern daraus, dass die Kategorie Geschlecht Einfluss auf die<br />
Entwicklung, Durchsetzung, Stabilisierung bestimmter Ausformungen von Technologien<br />
sowie ihrer möglichen Neugestaltung hat. Es wur<strong>de</strong> jedoch kein ein<strong>de</strong>utiger<br />
Ausschluss von Frauen hinsichtlich <strong>de</strong>s Zugangs zur Technologie nachgewiesen, etwa<br />
aufgrund <strong>de</strong>r Ausblendung von Frauenkörpern bei <strong>de</strong>r Technologieentwicklung, wie<br />
dies bei <strong>de</strong>n zuvor thematisierten Spracherkennungssystemen vom politisch dominanten<br />
und Zweigeschlechlichkeit reproduzieren<strong>de</strong>n Diskurs angenommen wird. Vielmehr<br />
legt die Studie zur Tastatur die These nahe, dass Hersteller technischer Geräte die (ab<br />
einem bestimmten Zeitpunkt) das berufliche Stenographieren dominieren<strong>de</strong>n Frauen<br />
als NutzerInnengruppen nicht ernst genug genommen haben, um ihre Produkte für<br />
diese spezifische Gruppe nutzungsfreundlich weiter zu entwickeln.<br />
Die Tätigkeit <strong>de</strong>s Maschineschreibens, die sich relativ schnell nach <strong>de</strong>n von<br />
bestimmten Männern dominierten Wettbewerben zu <strong>einer</strong> typischen „Frauenarbeit“<br />
entwickelt hatte, wur<strong>de</strong> mit dieser Verschiebung abgewertet. Die Fallstudie zur<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Schreibmaschinentastatur, welche die bis heute die gängigste<br />
Schnittstelle zu Computern darstellt, verweist damit drittens auf eine weitere Ebene <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Artefakten: die Verknüpfung von Technologien mit<br />
Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>r und festschreiben<strong>de</strong>r Arbeitsteilung und <strong>de</strong>r<br />
gleichzeitigen geringen Wertschätzung von als „weiblich“ imaginierten Tätigkeiten bzw.<br />
<strong>de</strong>r Abwertung entsprechen<strong>de</strong>r Fähigkeiten. Sie bestätigt damit die Erkenntnisse <strong>de</strong>r<br />
(berufs-)soziologischen Geschlechterforschung, dass <strong>einer</strong>seits als „Frauenarbeit“<br />
typisierte Arbeit häufig schlecht bezahlt ist und einen niedrigen Status besitzt (Wetterer<br />
1992, 1995) und an<strong>de</strong>rerseits gera<strong>de</strong> technische Kompetenzen eine wesentliche Rolle<br />
in <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>n Ausdifferenzierung von Professionen<br />
spielen.<br />
Nach Cynthia Cockburns (1988 [1986]) historisch-empirischen Untersuchungen<br />
unterschiedlicher Berufsbereiche sei das Technische – unabhängig von <strong>de</strong>n konkreten<br />
Inhalten <strong>de</strong>r Tätigkeit – stets als männlich symbolisiert, während die horizontale wie<br />
vertikale geschlechtliche Segregation von Berufen durch Neu<strong>de</strong>finition und<br />
Fragmentierung von Arbeitsprozessen aufrechterhalten bleibe. Ausgangspunkt und<br />
Ergebnis <strong>de</strong>r von ihr betrachteten Prozesse ist eine hierarchische Differenzierung in<br />
Frauen als Techniknutzerinnen und Männer als Technikentwickler. Das Beispiel <strong>de</strong>r<br />
Tastatur zeige, dass Frauen strukturell die Seite <strong>de</strong>r Bedienung von Technologie im<br />
Gegensatz zu <strong>de</strong>ren Gestaltung zugewiesen wird, die hier zusätzlich durch eine<br />
schlechte Ergonomie erschwert wird. 160 Insgesamt habe die historisch vorherrschen<strong>de</strong><br />
Geschlecht konstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung damit die Formung <strong>de</strong>r Schreibmaschinentastatur<br />
beeinflusst und diese wie<strong>de</strong>rum zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt, als<br />
159 Zum Begriff <strong>de</strong>r „Schließung“ vgl. Kapitel 3.3.<br />
160 Die Studie essentialistisch auf die Aussage zu verkürzen, dass „Männer“ aufgrund ihres<br />
angenommenen Spiel- und Wettbewerbstriebs sich auch mit <strong>einer</strong> schlechteren Ergonomie begnügten und<br />
„Frauen“ im Umkehrschluss eine gute Usability beson<strong>de</strong>rs nötig hätten, wäre sicherlich eine<br />
Missinterpretation; vgl. hierzu auch 4.1.1.<br />
104
Schreibtätigkeit zu einem von bestimmten Gruppen von Frauen dominierten Beruf<br />
gewor<strong>de</strong>n war.<br />
Ein weiteres, bekanntes Beispiel <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien ist die<br />
Metapher <strong>de</strong>s Computers und seine frühe mediale Inszenierung. Als das erste Gerät,<br />
die ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Calculator), 1946 konstruiert wur<strong>de</strong>,<br />
bezeichnete <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s Computers primär Personen, zumeist Frauen, die auf <strong>de</strong>r<br />
Basis <strong>einer</strong> Ausbildung in Mathematik mit <strong>de</strong>r mühsamen Arbeit <strong>de</strong>s Berechnens und<br />
Lösens mathematischer Gleichungen beschäftigt waren. Als konsequente Fortsetzung<br />
dieser Tätigkeit übernahmen diese später auch die Programmierung <strong>de</strong>r ersten<br />
elektronischen Maschinen. Ellen van Oost (2000) zufolge verlor <strong>de</strong>r Begriff <strong>de</strong>s<br />
Computers in <strong>de</strong>n 1950er und 1960er Jahren diese frühe Be<strong>de</strong>utung menschlicher<br />
bzw. weiblicher Rechnerinnen. Sie zeigt ferner anhand <strong>einer</strong> Medienanalyse<br />
nie<strong>de</strong>rländischer Zeitungen auf, dass <strong>de</strong>r Computer während dieser Zeit als<br />
„Denkmaschine“ sozial konstruiert wur<strong>de</strong>. Einen wesentlichen Anteil an dieser<br />
Um<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Begriffs Computer hätte die vorherrschen<strong>de</strong> Metapher <strong>de</strong>s Elektronengehirns.<br />
Da das Gehirn und das Denken traditionell als männlich betrachtet wer<strong>de</strong> (im<br />
Gegensatz zum weiblichen Körper o<strong>de</strong>r zu mit Frauen assoziierten Gefühlen), habe<br />
das Gerät Computer damit zugleich eine männliche Konnotation erhalten. Darüber<br />
hinaus wur<strong>de</strong>n Programmierer in <strong>de</strong>n Medien als männliche Meister imaginiert, die mit<br />
<strong>de</strong>r noch unvertrauten, mysteriös erscheinen<strong>de</strong>n Maschine umzugehen vermochten,<br />
sowie als Künstler o<strong>de</strong>r sogar als Magier vorgestellt, die wie Klavierspieler auf <strong>de</strong>r<br />
Maschine spielten. „All these images refer to programming as an activity saturated with<br />
virtuosity. Explicit elements of the virtuosity are high status, expense, mystery, danger,<br />
and mastery – all elements that symbolise masculinity in our society“ (van Oost 2000,<br />
13). Die Gehirnmetapher und <strong>de</strong>r Pathos <strong>de</strong>r Genialität trugen ihres Erachtens<br />
wesentlich dazu bei, dass <strong>de</strong>r Computer und die Programmierarbeit männlich<br />
konnotiert wur<strong>de</strong>n. Van Oost betont damit die symbolische Ebene <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Technologien.<br />
In <strong>einer</strong> weiteren Studie legt sie dar, dass ein Gen<strong>de</strong>ring auf symbolischer Ebene<br />
Auswirkungen auf die konkrete Ausformung und Funktionalität <strong>einer</strong> Technologie<br />
haben kann (van Oost 2003). Am Beispiel <strong>de</strong>r Gestaltung von Rasierapparaten <strong>de</strong>r<br />
nie<strong>de</strong>rländischen Firma Philips rekonstruiert sie die Ausdifferenzierung von Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong>n Produktlinien und ihre jeweiligen Merkmale. Philips<br />
entwickelte seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1930er Jahre elektrische Rasierer für Männer, 1950 kamen<br />
Produkte für Frauen hinzu. In diesen frühen Zeiten waren die Produkte fast baugleich.<br />
Der Ladyshave unterschied sich von <strong>de</strong>m für Männer intendierten Mo<strong>de</strong>ll primär durch<br />
das äußere Design, etwa die Farbe pink und eine rote Hülle sowie leicht unterschiedliche<br />
Rasierköpfe. Erst En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1950er Jahre wur<strong>de</strong>n Rasierer für Frauen in<br />
Form eines großen Lippenstifts entwickelt und mit einem parfümbetupften Kissen<br />
ausgestattet, um <strong>de</strong>n Geruch <strong>de</strong>s Öls <strong>de</strong>s Rasierermotors zu verbergen. Damit sollte –<br />
so van Ooosts These – die Assoziation <strong>de</strong>s Rasierers mit einem Schönheitsprodukt<br />
und Kosmetik hervorgerufen wer<strong>de</strong>n – eine Strategie, die später mit <strong>de</strong>m Produkt <strong>de</strong>s<br />
„Ladyshave beauty set“ (1979) und mit <strong>de</strong>m unter <strong>de</strong>r Dusche benutzbaren „Wet & Dry<br />
Ladyshave“ (1994) fortgesetzt wur<strong>de</strong>. Im Vergleich dazu wur<strong>de</strong> beim Design <strong>de</strong>s<br />
Rasierers für Männer <strong>de</strong>r technische Charakter stark betont. Die anfänglichen<br />
elfenbeinfarbenen und run<strong>de</strong>n Formen machten in <strong>de</strong>n 1970er Jahren schwarz und<br />
105
metallic sowie einem kantigen Design Platz. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> die Integration neuester<br />
technologischer Entwicklungen im Innern <strong>de</strong>s Gerätes später durch einen Aufkleber<br />
<strong>de</strong>utlich sichtbar gemacht.<br />
Die zweigeschlechtliche Differenzierung blieb jedoch nicht auf das äußere Design<br />
und das Marketing <strong>de</strong>r Rasierapparate beschränkt, son<strong>de</strong>rn umfasste zugleich technische<br />
Funktionalitäten. Männer bekamen technische Informationen aus <strong>de</strong>m Inneren<br />
<strong>de</strong>s Gerätes über ein elektronisches Display übermittelt und konnten das Gehäuse<br />
durch Schrauben öffnen. Demgegenüber wur<strong>de</strong>n die Ladyshaves ohne Display und<br />
ohne Schrauben geliefert, so dass ein Öffnen <strong>de</strong>s Gerätes ohne weitgehen<strong>de</strong> Zerstörung<br />
nicht möglich war. Van Oost schließt daraus, dass das Design <strong>de</strong>r Rasierapparate<br />
für Männer die Männern zugeschriebene Ten<strong>de</strong>nz zu Kontrolle und technologischer<br />
Kompetenz stützte, während durch die Gestaltung <strong>de</strong>r für Frauen gedachten Mo<strong>de</strong>lle<br />
<strong>de</strong>r technische Charakter verschleiert wer<strong>de</strong>n sollte. „The script of the Ladyshaves<br />
hi<strong>de</strong>s the technology for its users both in a symbolic way (by presenting itself as a<br />
beauty set) and in a physical way (by not having screws that would allow the <strong>de</strong>vice to<br />
be opened). The Ladyshave’s <strong>de</strong>sign trajectory was based on a representation of<br />
female users as technophobic“ (van Oost 2003, 206). Die Analyse <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>rskripte in<br />
Rasierern zeige, dass eine enge Verknüpfung von Männern mit technologischer<br />
Kompetenz im Design festgeschrieben wur<strong>de</strong>. Insofern spiegelten Rasierer<br />
vorherrschen<strong>de</strong> Geschlechtersymbole und -i<strong>de</strong>ntitäten. Sie trügen damit jedoch<br />
zugleich zu <strong>einer</strong> Normalisierung von Zweigeschlechtlichkeit im Sinne von „weiblichen“<br />
und „männlichen“ Umgangsweisen in Bezug auf Technologien bei. „The Philips<br />
shavers not only reflected this gen<strong>de</strong>ring of technological competence, they too<br />
constructed and strengthened the prevailing gen<strong>de</strong>ring of technological competence.<br />
… the gen<strong>de</strong>r script of the Ladyshave inhibits (symbolic and material) the ability of<br />
women to see themselves as interested in technology and technologically competent,<br />
whereas the gen<strong>de</strong>r script of the Philishaves invites men to see themselves that way.<br />
In other words: Philips not only produces shavers but also gen<strong>de</strong>rs“ (van Oost 2003,<br />
206).<br />
Nun gehören Rasierapparate nicht zu <strong>de</strong>n Informationstechnologien. Jedoch weist<br />
van Oosts Fallstudie darauf hin, dass Geschlecht konstituieren<strong>de</strong> Nutzungsvorstellungen<br />
über Inszenierungen von Technologien in <strong>de</strong>n Medien o<strong>de</strong>r Marketingstrategien<br />
von Herstellerfirmen hinaus in die Funktionalität technischer Artefakte Eingang fin<strong>de</strong>n,<br />
wodurch wie<strong>de</strong>rum strukturelle Dimensionen von Geschlecht in <strong>de</strong>r Nutzung reproduziert<br />
wer<strong>de</strong>n. Ihre Untersuchung veranschaulicht somit <strong>de</strong>n Zirkel <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Technologien im Sinne <strong>einer</strong> zitatförmigen Bezugnahme auf Geschlechtersymbolismen<br />
und das performative Neuhervorbringen von Geschlechterdifferenz und Geschlechterungleichheit<br />
durch technische Artefakte. Dennoch ist dies kein zwangsläufiger Prozess.<br />
Bereits im letzten Kapitel wur<strong>de</strong> diskutiert, dass NutzerInnen <strong>einer</strong> in die Technologie<br />
eingeschriebenen Repräsentation <strong>de</strong>r Nutzungsvorgabe nicht notwendigerweise folgen<br />
müssen. Besitzerinnen von Rasierern für Frauen wer<strong>de</strong>n nicht gezwungen, <strong>de</strong>n<br />
technischen Charakter <strong>de</strong>s Gerätes abzulehnen. Sie können vielmehr, wie van Oost<br />
selbst erläutert, das Skript verweigern (z.B. in<strong>de</strong>m sie einen Männerrasierer benutzen<br />
o<strong>de</strong>r sich nicht rasieren) o<strong>de</strong>r es modifizieren (z.B. in<strong>de</strong>m sie <strong>de</strong>n Ladyshaver doch<br />
öffnen).<br />
106
Die NutzerInnen können jedoch – wie eine weitere empirische Studie von Merete<br />
Lie (1995) zeigt – ihre Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität ebenso auf an<strong>de</strong>re Symbole und Merkmale<br />
grün<strong>de</strong>n als <strong>de</strong>njenigen, die von <strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>rskript <strong>de</strong>r Technologie aufgerufen<br />
wer<strong>de</strong>n. Lie interessierte, inwieweit <strong>de</strong>r Personalcomputer ein Symbol für Männlichkeit<br />
darstellt. Sie führte ihre Untersuchungen ca. 1990 in <strong>einer</strong> norwegischen Dienstleistungsfirma<br />
durch, die Maschinen für landwirtschaftliche Betriebe, Ersatzteile, aber<br />
auch Dünger und Futter vertreibt. Interviews mit MitarbeiterInnen verschie<strong>de</strong>ner<br />
Abteilungen ver<strong>de</strong>utlichten, dass <strong>de</strong>m Artefakt Personalcomputer in verschie<strong>de</strong>nen<br />
Abteilungen unterschiedliche und vergeschlechtliche subjektive Be<strong>de</strong>utungen zugeschrieben<br />
wur<strong>de</strong>. Der Gruppe <strong>de</strong>r Verkäufer, die ausschließlich aus Männern bestand<br />
und die Kun<strong>de</strong>n mit Ersatzteilen von Maschinen versorgte, erschien <strong>de</strong>r Computer<br />
unwichtig und uninteressant. Ihre Tätigkeit war stark an die Kenntnis <strong>de</strong>r spezifischen<br />
Landmaschinen gebun<strong>de</strong>n, die sie sich im Zuge ihrer Sozialisation auf <strong>de</strong>m Land<br />
informell angeeignet hatten. Diese Mitarbeiter konnten ihr Wissen nicht von <strong>de</strong>n Landmaschinen<br />
auf <strong>de</strong>n Computer übertragen, <strong>de</strong>r ihnen als eine „closed box“ erschien und<br />
damit eher als Büroausstattung galt <strong>de</strong>nn als Maschine. Computertätigkeit schrieben<br />
sie <strong>de</strong>n Sekretärinnen und <strong>de</strong>n im Büro angestellten Frauen zu, während sie die eigene<br />
Kompetenz in Bezug auf die Landmaschinen als Zeichen ihrer Männlichkeit inszenierten.<br />
Die zwei weiteren MitarbeiterInnengruppen, die Lie in ihrer Studie beschreibt,<br />
bestätigten dagegen die simplifizierte traditionelle Formel, dass Computer männlich<br />
und unweiblich seien. Den Männern im mittleren Management <strong>de</strong>r Firma diente <strong>de</strong>r<br />
Computer als zentrales Objekt ihrer Aufgaben <strong>de</strong>r Planung und Organisationsentwicklung.<br />
Das Artefakt wur<strong>de</strong> nicht mit Routinearbeiten in Verbindung gebracht – und damit<br />
mit Weiblichkeit assoziiert –, son<strong>de</strong>rn galt ihnen als ein Arbeitsmittel, um Überblick<br />
über die Firma zu gewinnen, um Entscheidungen zu treffen und die eigenen Fähigkeiten<br />
zu erweitern. Die im Büro angestellten Frauen wie<strong>de</strong>rum empfan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Computer<br />
als faszinierend. Sie sahen in <strong>de</strong>m Gerät bisher unvorstellbare Möglichkeiten. Die Büroangestellten<br />
waren also durchaus am Computer interessiert, aber betrachteten<br />
diesen nicht als <strong>de</strong>n „ihren“. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n Männern im mittleren Management,<br />
die sich die Potentiale anzueignen versuchten, lag das „Innere“ <strong>de</strong>r Maschine<br />
außerhalb ihrer Reichweite.<br />
Die Studie belegt die enorme Flexibilität symbolischer Geschlechter<strong>de</strong>utungen von<br />
Computern. Welche Botschaften das Artefakt übermittelt, hängt stark von <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen NutzerInnen ab, von ihrer konkreten Tätigkeit im Betrieb und allgem<strong>einer</strong><br />
von <strong>de</strong>n kulturellen Prägungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. Während die<br />
Männer aus <strong>de</strong>m Management und die im Büro angestellten Frauen die in Bezug auf<br />
herkömmliche Technologien üblichen Geschlechter-Inszenierungen weitgehend reproduzierten,<br />
grün<strong>de</strong>ten die Ersatzteilverkäufer ihre Männlichkeit auf einem Technikverständnis<br />
von mechanischen Maschinen, das <strong>de</strong>n Bezug auf <strong>de</strong>n Computer überflüssig<br />
macht. „In this case study we found that to some men mastering of mechanical<br />
machinery and manual skills are most important to their pri<strong>de</strong> as workers. The<br />
computer cannot represent the qualities which are central to these men. Once<br />
intellectual capacities linked to organizational power are emphasized, however, the<br />
computer works as an expression of such attributes. Here, these different symbolic<br />
expressions seem to work si<strong>de</strong> by si<strong>de</strong>.” (Lie 1995, 391) Die These, dass <strong>de</strong>r Computer<br />
symbolisch als „männlich“ konnotiert ist, be<strong>de</strong>utet Lie zufolge nicht, dass sämtliche<br />
107
Männer diese Technologie beherrschen und darüber ihre Maskulinität bestätigen.<br />
Neben (bzw. unter) <strong>de</strong>r hegemonialen Männlichkeit (Connell 1987) existierten auch<br />
weniger dominante Formen „typischer Männlichkeit“, beispielsweise jene, die sich auf<br />
einen an<strong>de</strong>ren Typ technologischer Artefakte – in Lies Fallstudie die Landmaschinen<br />
anstelle <strong>de</strong>s Computers – beziehen. Ihre Studie ver<strong>de</strong>utlicht, dass das Verständnis <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Technologien auf <strong>einer</strong> symbolischen Ebene ausdifferenziert<br />
wer<strong>de</strong>n muss. Technische Artefakte symbolisieren nicht entwe<strong>de</strong>r „Männlichkeit“ o<strong>de</strong>r<br />
„Weiblichkeit“. Vielmehr zeigt das Beispiel, dass es verschie<strong>de</strong>ne „Männlichkeiten“ und<br />
verschie<strong>de</strong>ne Symbolisierungsformen von Männlichkeiten gibt. Unterschiedliche<br />
Symbolisierungsformen von Männlichkeiten können sich sogar wi<strong>de</strong>rsprechen und<br />
ausschließen. Lie arbeitet heraus, dass Geschlecht, Klasse und Position im Produktionsprozess<br />
eng zusammenspielen. Hinsichtlich <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntifizierung mit <strong>de</strong>m Artefakt<br />
liegt eine größere Nähe zwischen Management (d.h. Männern <strong>de</strong>r herrschen<strong>de</strong>n<br />
Klasse) und Verwaltung (d.h. Frauen <strong>de</strong>r intermediären Klasse <strong>de</strong>r Angestellten) vor<br />
als als zwischen <strong>einer</strong> dieser Gruppen mit <strong>de</strong>n landwirtschaftlichen Technikern (d.h.<br />
Männern <strong>de</strong>r Arbeiterklasse). Während sich die höher Positionierten positiv auf Computer<br />
beziehen, wenngleich auf unterschiedliche Weise, grenzen sich die Arbeiter vom<br />
Computer ab und bil<strong>de</strong>n ihre Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität anhand <strong>de</strong>s Umgangs mit<br />
Landmaschinen heraus. Im Ergebnis zeigt sich die Priorität von Klasse und Position im<br />
Produktionsprozess gegenüber Geschlecht im Sinne <strong>einer</strong> verengten Geschlechterdifferenz-Perspektive.<br />
Vergeschlechtlichung muss <strong>de</strong>shalb in Bezug auf an<strong>de</strong>re Kategorien<br />
sozialer Ungleichheit als intersektional o<strong>de</strong>r inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt begriffen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die bisher angeführten Fallstudien ver<strong>de</strong>utlichen <strong>einer</strong>seits, dass die Prozesse <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring von Technologien zu vielschichtig, komplex und variabel sind, um im Sinne<br />
eines fest gefügten, dichotomen Geschlechterverständnisses interpretiert wer<strong>de</strong>n zu<br />
können. An<strong>de</strong>rerseits setzt insbeson<strong>de</strong>re Lies Untersuchung <strong>de</strong>n zuvor diskutierten<br />
Analysen, die auf die Vergeschlechtlichung durch und während <strong>de</strong>r Gestaltung von<br />
Artefakten fokussieren, die Perspektive <strong>de</strong>r NutzerInnen und <strong>de</strong>ren Aneignung o<strong>de</strong>r<br />
Ablehnung <strong>de</strong>r Geschlechtseinschreibung entgegen. Damit liefern die diskutierten<br />
Beispiele insgesamt eine Reihe von Grün<strong>de</strong>n dafür, warum es so schwierig ist, „gute<br />
Beispiele“ für die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte anzugeben. Das<br />
Gen<strong>de</strong>ring von Technologien kann nicht auf die Seite <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
beschränkt wer<strong>de</strong>n. Materielle, strukturelle und symbolische Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
fin<strong>de</strong>n ebenso während <strong>de</strong>r Verbreitung, <strong>de</strong>m Marketing und <strong>de</strong>r<br />
Nutzung statt. Ferner lassen sich aus <strong>de</strong>n Fallstudien keine einfachen dualistischen<br />
Muster ableiten. Klare Muster wie <strong>de</strong>r Ausschluss von Frauen von <strong>de</strong>r Nutzung <strong>de</strong>r<br />
Technologie (beispielsweise bei <strong>de</strong>r Spracherkennungssoftware), <strong>de</strong>r <strong>einer</strong> ein<strong>de</strong>utigen<br />
Benachteiligung von in typischen Frauenberufen Tätigen durch das konkrete Design<br />
(wie bei <strong>de</strong>r Schreibmaschinentastatur) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r <strong>einer</strong> klaren männlichen Symbolisierung<br />
von Artefakten (wie in <strong>de</strong>n Anfangszeiten <strong>de</strong>s Computern) erwiesen sich bereits<br />
bei <strong>de</strong>r hier skizzierten Zusammenschau von Fallbeispielen als flexibler und brüchiger<br />
als dass sie in das dichotome Zweigeschlechtlichkeitssystem einzuordnen wären, das<br />
bei <strong>de</strong>r Interpretation häufig vorherrscht. Vielmehr wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass nicht nur die<br />
Verknüpfungen von Weiblichkeit bzw. Männlichkeit mit bestimmten Artefakten<br />
Wandlungen unterliegen, son<strong>de</strong>rn auch die Geschlechtlichkeit selbst, die nicht in einem<br />
einfachen, dualistischen Schema verortbar ist. Die Kategorie Geschlecht ist ebenso<br />
108
wie die Geschlechter-Technik-Verhältnisse und damit das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte variabel und historisch-kulturell situiert.<br />
Für die Fragestellung <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte erweisen<br />
sich die betrachteten Fallstudien als wertvoll, insofern <strong>de</strong>r Blick sowohl auf die<br />
Kontinuität <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring gerichtet ist als auch auf die Variabilität und Instabilität <strong>de</strong>r<br />
Geschlechter-Technik-Verhältnisse. Die Zusammenschau <strong>de</strong>r bisher angeführten<br />
Beispiele zeigt, dass auf vielen Ebenen Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte stattfin<strong>de</strong>n. Sie geben damit wichtige Hinweise, worauf <strong>de</strong>r<br />
analytische Blick zu richten ist, um ein Gen<strong>de</strong>ring von neuen Technologien zu<br />
i<strong>de</strong>ntifizieren, die bisher noch nicht untersucht wur<strong>de</strong>n. Im Folgen<strong>de</strong>n wird <strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>r<br />
Fokus von <strong>de</strong>n „guten Beispielen“ allgem<strong>einer</strong> auf die Dimensionen <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung informationstechnologischer Artefakte verschoben.<br />
Bis hierher lassen sich die Prozesse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring entlang von drei Fragen verorten:<br />
1. Kann die Ignoranz von Geschlechtsdifferenzierungen – unabhängig davon, ob<br />
diese wie bei <strong>de</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r Spracherkennungssysteme als körperlich begrün<strong>de</strong>t<br />
angenommen o<strong>de</strong>r auch sozial-kulturell verortet wer<strong>de</strong>n – zu einem Ausschluss<br />
bestimmter Gruppen von <strong>de</strong>r Nutzung <strong>einer</strong> Technologie führen?<br />
2. Kann die Arbeit, die mit einem informationstechnologischen Artefakt bzw.<br />
Computersystem unterstützt o<strong>de</strong>r automatisiert wer<strong>de</strong>n soll, Merkmale Ggeschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung aufweisen und diese Differenzierung durch Technologie<br />
weiter verstärken? Ein wesentlicher Faktor geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Markierungen<br />
bestimmter Tätigkeiten besteht darin, welche Fähigkeiten dazu explizit o<strong>de</strong>r implizit<br />
vorausgesetzt wer<strong>de</strong>n und wie diese wie<strong>de</strong>rum in Bezug auf Status, Macht und<br />
Bezahlung anerkannt o<strong>de</strong>r auch abgewertet wer<strong>de</strong>n.<br />
3. Können <strong>de</strong>m Artefakt bzw. <strong>de</strong>r mit diesem verbun<strong>de</strong>nen Tätigkeit vorherrschen<strong>de</strong><br />
„Männlichkeiten“ o<strong>de</strong>r „Weiblichkeiten“ zugeschrieben wer<strong>de</strong>n, beispielsweise durch<br />
entsprechen<strong>de</strong> gesellschaftlich-kulturelle Symbolisierung auf <strong>einer</strong> medialen Ebene<br />
o<strong>de</strong>r durch Marketing, Verpackung und Design von Funktionalität? Auf diese Weise<br />
wird das vorherrschen<strong>de</strong> System <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit gestützt o<strong>de</strong>r auch<br />
unterminiert. Dabei ist zu bemerken, dass strukturelle und symbolische Dimensionen<br />
eng miteinan<strong>de</strong>r verflochten sind und <strong>de</strong>shalb im Folgen<strong>de</strong>n nicht weiter differenziert<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. 161<br />
In dieser Kategorisierung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Technologien ist allerdings <strong>de</strong>r<br />
spezifische Charakter aktueller Informationstechnologien und ihrer Gestaltung noch<br />
nicht berücksichtigt. Ein Aspekt <strong>informatischer</strong> Artefakte, <strong>de</strong>r diese gegenüber an<strong>de</strong>ren<br />
Technologien auszeichnet, besteht in <strong>de</strong>r Rolle, die diesen beim Zugang zu<br />
161 Die entwickelte Taxonomie <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Technologien entspricht grob <strong>de</strong>m Raster, das Nelly<br />
Oudshoorn 1996 vorgeschlagen hat, wenn sie konstatiert, dass Gen<strong>de</strong>rskripte in viererlei Hinsicht<br />
problematisch sein können: „they can ‚<strong>de</strong>legate different competencies and responsibilities to men and<br />
women; they can reinforce differences between female and male work; they can normalize stereotypical<br />
male and female behaviour and they can create barriers for the accessability of technology“ (Oudshoorn<br />
1996, zitiert nach Rommes 2002, 18). In m<strong>einer</strong> Klassifizierung habe ich die ersten bei<strong>de</strong>n Kategorien von<br />
Oudshoorns Gen<strong>de</strong>rskripten, die Zuweisung geschlechtsdifferenzieren<strong>de</strong>r Kompetenzen und Verantwortungen<br />
sowie die Verstärkung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung, aufgrund ihrer engen<br />
Verknüpfung zusammengefasst. Vergleiche hierzu auch <strong>de</strong>n Aufsatz Bath 2003, in <strong>de</strong>m ich eine erste<br />
Version <strong>de</strong>r Systematisierung von Prozessen, durch die Informationstechnologien vergeschlechtlicht<br />
wer<strong>de</strong>n, entwickelt hatte.<br />
109
Informationen und <strong>de</strong>ren Strukturierung und Verbreitung zukommt. Mit <strong>de</strong>m Übergang<br />
in die Informations- bzw. Wissensgesellschaft wer<strong>de</strong>n in Technologien verkörperte<br />
Machtverhältnisse nicht mehr nur über Arbeitssysteme hergestellt, son<strong>de</strong>rn zunehmend<br />
auch in verschie<strong>de</strong>nen Informationssystemen sowie in Methodiken ihrer Herstellung<br />
inkorporiert. Es gilt <strong>de</strong>mnach zu untersuchen, inwieweit auch das in informationstechnischen<br />
Systemen repräsentierte Wissen zur Aufrechterhaltung <strong>de</strong>r strukturellsymbolischen<br />
Geschlechterordnung beiträgt. Aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive<br />
beson<strong>de</strong>rs relevant erscheint dabei die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r spezifischen Klassifizierung und<br />
Formalisierung von Informationen, die Ein- und Ausschlüsse auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>s Wissens<br />
und <strong>de</strong>r Subjekte <strong>de</strong>s Wissens produziert, welche als Politik <strong>de</strong>r Artefakte<br />
bezeichnet wer<strong>de</strong>n kann. 162 Denn in die ontologischen Vorannahmen von Abstraktion,<br />
Mo<strong>de</strong>llierung, aber auch <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Informationssystementwicklung gehen<br />
Wissensordnungen und Macht, mithin die bestehen<strong>de</strong> Geschlechterordnung in die<br />
Konstitution <strong>de</strong>r Artefakte ein. Diese Probleme führen zu wissenschaftstheoretischen<br />
Fragen, 163 welche quer zu <strong>de</strong>n bisher i<strong>de</strong>ntifizierten Kategorien <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
von Technologien liegen und <strong>de</strong>shalb zu ergänzen sind.<br />
Eine weitere Beson<strong>de</strong>rheit <strong>informatischer</strong> Artefakte besteht in ihrer Interaktivität und<br />
Flexibilität, die diese in <strong>de</strong>r Nutzung wie auch <strong>de</strong>r eingeschriebenen Funktionalität<br />
aufweisen. Während die bisher entwickelte Taxonomie für die I<strong>de</strong>ntifikation <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring relativ feststehen<strong>de</strong>r Artefakte nützlich erscheint, stößt sie insbeson<strong>de</strong>re bei<br />
<strong>de</strong>n neueren, mit Ansätzen <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz ausgestatteten Technologien,<br />
die – wie im Kapitel 3 vorgestellt – „lernen“, sich verän<strong>de</strong>rn bzw. „anpassen“ können<br />
und Handlungsträgerschaft zwischen Mensch und Maschine neu verteilen, auf<br />
Grenzen. Der Ansatz, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n theoretischen Grundlagen <strong>de</strong>r Ko-Konstruktion von<br />
Geschlecht und Technik beruht, erscheint geeignet, das Gen<strong>de</strong>ring von Schreibmaschinentastaturen,<br />
Computern o<strong>de</strong>r Rasierapparaten (bzw. die Politik von Brücken)<br />
nachzuweisen, allerdings bleiben die Gen<strong>de</strong>rdimension von mit KI ausgestatteten Softwareprodukten<br />
und an<strong>de</strong>ren informatischen Artefakten auf dieser Basis schwer<br />
greifbar. Die Qualität dieser Artefakte erfor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>mgegenüber eine differenzierte<br />
Analyse epistemologischer Dimensionen, <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> gelegten ontologischen<br />
Setzungen sowie <strong>de</strong>r Konzeptionen <strong>de</strong>s Humanen, d.h. anthropologischer Annahmen.<br />
Hier wie bei <strong>de</strong>r Untersuchung von Wissenstechnologien erscheinen Erkenntnisse <strong>de</strong>r<br />
feministischen Theorie und Epistemologie sowie die Geschlechter<strong>de</strong>batten um <strong>de</strong>n<br />
Körper produktiv. Um diesen Charakteristiken <strong>informatischer</strong> Artefakte Rechnung zu<br />
tragen, ergänze ich die bisherige Taxonomie <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung um die<br />
Dimension <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen. 164<br />
162 Bereits an dieser Stelle <strong>de</strong>utet sich eine generelle Problematik von Taxonomien an. Intendiert als<br />
Zusammenfassung disjunkter Kategorien, die <strong>de</strong>n Gegenstandsbereich vollständig ab<strong>de</strong>cken sollen,<br />
lassen sich die einzelnen Dimensionen in realiter selten trennscharf voneinan<strong>de</strong>r abgrenzen. Je nach<strong>de</strong>m,<br />
wo die Grenzen <strong>de</strong>s Gegenstandsbereiches gezogen wer<strong>de</strong>n (z.B. ausschließlich Nutzungsrepräsentionen<br />
o<strong>de</strong>r auch epistemologische Annahmen), können Kategorien hinzu gehören o<strong>de</strong>r auch nicht.<br />
163 Beispielsweise auf die Frage <strong>de</strong>r Objektivität.<br />
164 Eine weitere Schwierigkeit, informatische Artefakte mit Hilfe <strong>de</strong>r entwickelten Taxonomie zu<br />
beforschen, ergibt sich aus <strong>de</strong>m historischen Charakter <strong>de</strong>r bisher diskutierten Fallstudien. Die Historizität<br />
<strong>de</strong>r betrachteten Technologien <strong>de</strong>utet darauf, dass das Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten erst im Rückblick<br />
erkennbar ist. VertreterInnen eines konservativen Wissenschaftsverständnisses erklären dieses<br />
Phänomen häufig dadurch, dass sozialwissenschaftlich Forschen<strong>de</strong> eine gewisse Distanz zu ihrem<br />
Gegenstand benötigen, um soli<strong>de</strong>, nicht-involvierte Untersuchungen durchführen zu können.<br />
Demgegenüber vertrete ich hier mit Bezug auf Ansätze feministischer Theorie, welche die<br />
110
Folgen<strong>de</strong> Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung informationstechnologischer Artefakte<br />
wer<strong>de</strong>n somit in einzelnen Abschnitten ausführlich beschrieben und anhand von<br />
Fallstudien veranschaulicht:<br />
1. Problem<strong>de</strong>finitionen und Annahmen, die gesellschaftlich-soziale Ausschlüsse<br />
produzieren,<br />
2. die Digitalisierung strukturell-symbolischer Geschlechterungleichheit,<br />
3. Geschlechterpolitik und die Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen.<br />
Dabei wur<strong>de</strong>n Studien über symbolische Aspekte <strong>de</strong>s Vergeschlechtlichung, die im<br />
Effekt zur Normalisierung <strong>de</strong>s Zweigeschlechtlichkeitssystems beitragen, <strong>de</strong>m zweiten<br />
Abschnitt zugeordnet (4.2.5), da hierzu nur wenige Untersuchungen aus <strong>de</strong>r Informatik<br />
und <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung vorliegen.<br />
Meine Darstellung orientiert sich zwar häufig an <strong>de</strong>r historischen Entwicklung von<br />
Informationstechnologien sowie ihrer <strong>kritisch</strong>en Reflexion in <strong>de</strong>n Ansätzen feministischer<br />
Informatikerinnen und feministischer TechnikforscherInnen. Jedoch verstehen<br />
sich meine Ausführungen primär als ein Ansatz zur Systematisierung <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichungsprozesse<br />
von IT. Dabei wird das weitergehen<strong>de</strong> Ziel, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
entgegenzuwirken, stets im Blick behalten. Sofern anhand <strong>de</strong>r<br />
skizzierten Fallstudien bereits I<strong>de</strong>en bzw. sogar Systeme entwickelt wur<strong>de</strong>n, die<br />
Alternativen zu <strong>de</strong>n vergeschlechtlichten Technologien und Prozessen darstellen und<br />
damit Hinweise auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring geben, wer<strong>de</strong>n diese hier ansatzweise diskutiert.<br />
4.1. Access <strong>de</strong>nied!? Problem<strong>de</strong>finitionen und Annahmen, die soziale<br />
Ausschlüsse produzieren<br />
Der Ausschluss von Frauen o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren spezifischen Gruppe „An<strong>de</strong>rer“ von <strong>de</strong>r<br />
Nutzung <strong>einer</strong> Technologie ist ein starkes Argument für die Berücksichtigung von Geschlechter-<br />
und Diversity-Aspekten bei <strong>de</strong>r Technologiegestaltung. Lässt sich ein<br />
Gen<strong>de</strong>ring „by <strong>de</strong>sign“ (vgl. Green et al. 1993a) für technologische Artefakte<br />
überzeugend nachweisen, so ruft dies vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s Imperativs<br />
angestrebter Geschlechtergerechtigkeit gemeinhin Wi<strong>de</strong>rspruch hervor. Allerdings<br />
beruht die Behauptung, dass eine Technologie in <strong>de</strong>m Sinne vergeschlechtlicht ist,<br />
dass Frauen <strong>de</strong>r Zugang und die Nutzung versperrt bleiben, auf Annahmen, die <strong>einer</strong><br />
Objektivitätsannahmen als nicht mögliche Positionen kritisieren, die These, dass es nicht fehlen<strong>de</strong><br />
Distanz, son<strong>de</strong>rn die mangeln<strong>de</strong> Fixierung <strong>de</strong>s Gegenstan<strong>de</strong>s ist, die die Analyse neu aufkommen<strong>de</strong>r<br />
Technologien erschwert. Gera<strong>de</strong> die Informatik ist von <strong>einer</strong> Dynamik geprägt, die eine für die sorgfältige<br />
Erforschung notwendige Eingrenzung und Festlegung oft unpraktikabel macht. Im angloamerikanischen<br />
Raum wer<strong>de</strong>n Technologien <strong>de</strong>shalb primär ethnografisch erforscht (vgl. hierzu die im Kapitel 3.3<br />
skizzierten Labor- und Netzwerkstudien-Ansätze sowie Kapitel 5.6). Dabei wird jedoch in <strong>de</strong>r Regel<br />
vorausgesetzt, dass die untersuchten Technologien bereits in <strong>de</strong>r Nutzung sind. Ein Teil <strong>de</strong>r auf ein<br />
Gen<strong>de</strong>ring zu befragen<strong>de</strong>n Technologien befin<strong>de</strong>t sich allerdings noch nicht in <strong>de</strong>r kommerziellen<br />
Anwendung. Sie wur<strong>de</strong>n bisher nicht in <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r Nutzung gestellt, son<strong>de</strong>rn wer<strong>de</strong>n noch konzipiert,<br />
mo<strong>de</strong>lliert, sind mithin – ähnlich wie die Grundlagenforschung – „technologies in the making“.<br />
Die Erkenntnis, dass Analysen neuer Technologien <strong>de</strong>n technologischen Entwicklungen stets hinterher<br />
hinken, stellt das vorliegen<strong>de</strong> Vorhaben hier vor große Herausfor<strong>de</strong>rungen. Denn die Vergeschlechtlichung<br />
<strong>de</strong>r Artefakte soll nicht nur zum Selbstzweck analysiert wer<strong>de</strong>n. Vielmehr sollen die Ergebnisse<br />
hier in Vorschläge mün<strong>de</strong>n, wie diese Prozesse durch eine entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />
können. Um geeignete De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesse in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung zu initiieren, müssen die<br />
Analysen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung jedoch höchst aktuell sein o<strong>de</strong>r sich auf die gegenwärtig konzipierten<br />
Artefakte übertragen lassen. Auf diese Problematik wer<strong>de</strong> ich im nächsten Kapitel zurückkommen.<br />
111
grundlegen<strong>de</strong>n Reflexion bedürfen. Zum einen basiert sie – wie im letzten Kapitel<br />
ausgehend von Winners Brückenbeispiel ausführlich diskutiert wur<strong>de</strong> – häufig auf<br />
einem verengten Verständnis von Technologie, ihrer gesellschaftlichen Situierung und<br />
Ko-Konstitution mit sozialen Prozessen. Zum an<strong>de</strong>ren setzt die These <strong>de</strong>s Ausschlusses<br />
voraus, dass es ein o<strong>de</strong>r mehrere Merkmale gibt, welche die von <strong>de</strong>m Gebrauch<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen Technologie Ausgeschlossenen charakterisieren und von <strong>de</strong>n Eingeschlossenen<br />
abzugrenzen vermögen. Im Folgen<strong>de</strong>n wird am Beispiel <strong>de</strong>r Kategorie<br />
Geschlecht diskutiert, inwiefern eine solche Klassifikation geschlechtertheoretisch<br />
haltbar ist, strategisch sinnvoll sein kann o<strong>de</strong>r besser verworfen wer<strong>de</strong>n sollte.<br />
Kann bei <strong>de</strong>r Definition von Grenzen auf statistisch ungleich verteilte, auf <strong>de</strong>n<br />
Körper bezogene Aspekte zurückgegriffen wer<strong>de</strong>n, so lässt sich leicht argumentieren.<br />
Rachel Weber (1999) weist etwa auf das Beispiel <strong>de</strong>s Flugzeugcockpits hin, das<br />
bestimmte Körpergrößen <strong>de</strong>r PilotIn wie Sitzhöhe, Armlänge, Gewicht erfor<strong>de</strong>rt, um<br />
eine adäquate Bedienung und sichere Kontrolle <strong>de</strong>r Instrumente zu ermöglichen. Im<br />
Fall US-amerikanischer Militärflugzeuge waren Grenzwerte so festgelegt, dass sie<br />
maximal von 5% <strong>de</strong>r kleinsten Männer unterschritten und von 5% <strong>de</strong>r größten Männer<br />
überschritten wur<strong>de</strong>n. Diese Richtlinie schloss ihrer Untersuchung zufolge allerdings<br />
ca. 65% <strong>de</strong>r kleinsten und 5% <strong>de</strong>r größten Frauen von <strong>einer</strong> Pilotinnenkarriere bei <strong>de</strong>r<br />
Navy o<strong>de</strong>r Airforce aus. Dies kann als ein Fall <strong>de</strong>r Geschlechterblindheit in <strong>de</strong>r<br />
Technologieentwicklung betrachtet wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Bezug auf physische<br />
Merkmale evi<strong>de</strong>nt erscheint. Eine solche Begründung <strong>de</strong>s Ausschlusses erscheint<br />
überzeugend, sofern <strong>de</strong>n statistischen Daten Glauben geschenkt wird und ihre<br />
Gültigkeit auf <strong>de</strong>n betrachteten kulturell-historischen Raum beschränkt bleibt.<br />
Vergleichbare Argumentationen lassen sich jedoch in <strong>de</strong>r Informatik nur äußerst<br />
selten anführen. Denn die Nutzung <strong>informatischer</strong> Artefakte ist nur in Einzelfällen an<br />
materielle Bedingungen gekoppelt. Abgesehen vom Bereich <strong>de</strong>r Benutzungsschnittstellen<br />
sind dort Fragen <strong>de</strong>r Körperlichkeit eher irrelevant. In <strong>einer</strong> Disziplin, die sich historisch<br />
auf das Artefakt <strong>de</strong>s Computers bezieht, <strong>de</strong>r früh als „Elektronengehirn“ (vgl. van<br />
Oost 2000, Coy 1992) und später als „Fließband im Kopf“ (vgl. Heintz 1993) charakterisiert<br />
wur<strong>de</strong>, lässt sich nur selten auf körperliche Geschlechterunterschie<strong>de</strong> rekurrieren,<br />
um damit auf soziale Ausschlüsse von <strong>de</strong>r Nutzung aufmerksam zu machen. Frühe<br />
Spracherkennungssysteme und ihre Orientierung an als „männlich“ gedachten<br />
Stimmfrequenzen wer<strong>de</strong>n womöglich <strong>de</strong>shalb so häufig zitiert, weil sich für die<br />
Informatik kaum ein an<strong>de</strong>res einschlägiges Beispiel mit Bezug auf Geschlechtskörper<br />
fin<strong>de</strong>n lässt.<br />
Soll ein Ausschluss aufgrund <strong>de</strong>r spezifischen Gestaltung <strong>informatischer</strong> Hardware<br />
o<strong>de</strong>r Software nachgewiesen wer<strong>de</strong>n, so wird in <strong>de</strong>r Regel mit sozialen Unterschie<strong>de</strong>n<br />
zwischen <strong>de</strong>n sozialen Großgruppen „Frauen“ und „Männer“ argumentiert. In diesem<br />
Abschnitt diskutiere ich Studien, die eine Ausgrenzung von Frauen von <strong>de</strong>r Nutzung<br />
<strong>einer</strong> Technologie konstatieren. Dabei unterschei<strong>de</strong> ich Untersuchungen, die auf die<br />
Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r NutzerInnen rekurrieren von solchen, die sich auf die<br />
Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r DesignerInnen beziehen. Die ersteren begrün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n<br />
Ausschluss von Frauen mit als „geschlechtsspezifisch“ angenommenen Interessen,<br />
Vorlieben o<strong>de</strong>r kognitiven Fähigkeiten, die bei <strong>de</strong>r Nutzung relevant seien (Abschnitte<br />
4.1.1. und 4.1.2.). Die letzteren behaupten, dass das jeweilige informatische Artefakt<br />
<strong>de</strong>shalb vergeschlechtlicht sei, weil die Entwickler (i.d.R. Männer) aufgrund ihrer als<br />
112
einheitlich angenommenen Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität nur solche Probleme und Lösungen in<br />
<strong>de</strong>n Blick bekommen, die ihrem eigenen und ebenfalls als einheitlich angenommenen<br />
lebensweltlichen Hintergrund entsprechen. Der implizite Selbstbezug, mit <strong>de</strong>m sich die<br />
TechnologiegestalterInnen als NutzerInnen imaginieren, habe gravieren<strong>de</strong> Auswirkungen<br />
erstens auf die Problem<strong>de</strong>finition, die <strong>de</strong>r Technologie zugrun<strong>de</strong> liegt, d.h. darauf,<br />
welche Technologien entworfen wer<strong>de</strong>n sollen (Abschnitt 4.1.3.) und zweitens auf die<br />
kontinuierlichen Designentscheidungen, d.h. auf die konkrete Gestalt, welche die<br />
Technologie im Laufe <strong>de</strong>s Entwicklungsprozesses erhält (Abschnitt 4.1.4.).<br />
4.1.1. Vom impliziten Design „von und für Männer“: Haben Frauen an<strong>de</strong>re<br />
Vorlieben und Fähigkeiten bei <strong>de</strong>r Nutzung?<br />
Beispiele für das Argument <strong>de</strong>s Ausschlusses von Technologien, die auf zweigeschlechtlich<br />
differenzierte Vorlieben bei <strong>de</strong>r Nutzung <strong>informatischer</strong> Produkte<br />
rekurrieren, sind primär aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Human-Computer-Interaction-Forschung<br />
(HCI) bekannt. Eine oft angeführte Thematik stellt dabei die Formgebung <strong>de</strong>r Interaktionselemente<br />
auf <strong>de</strong>r Bildschirmoberfläche dar. Der renommierte US-amerikanische<br />
User-Interface-Designer und Usability-Forscher Aaron Marcus etwa schlug 1993 zwei<br />
unterschiedliche Gestaltungen grafischer Benutzungsoberflächen zur Formatierung<br />
von Texten vor: die eine gedacht für weiße US-amerikanische Frauen, die an<strong>de</strong>re<br />
sollte europäische erwachsene männliche Intellektuelle ansprechen (vgl. Abbildung 1).<br />
Seinen Entwürfen lag die Annahme zugrun<strong>de</strong>, europäische erwachsene männliche<br />
Intellektuelle wür<strong>de</strong>n „suave prose, a restrained treatment of information <strong>de</strong>nsity, and a<br />
classical approach to font selection (e.g. the use of serif type in axial symmetric layouts<br />
similar to those found in elegant bronze European building i<strong>de</strong>ntification signs)“<br />
(Marcus 1993 nach Preece et al. 2002, 144) mögen, während weiße Amerikanerinnen<br />
„prefer a more <strong>de</strong>tailed presentation, curvilinear shapes and the absence of some more<br />
brutal terms … favored by male engineers.“ (ebd.). Marcus ging zwar nicht so weit zu<br />
behaupten, dass das kantig-eckige Design dazu tendierte, weiße Amerikanerinnen von<br />
<strong>de</strong>r Nutzung fernzuhalten, jedoch legt sein Ansatz diesen Schluss nahe. Die von ihm<br />
zugrun<strong>de</strong> gelegten Hypothesen hielten allerdings <strong>einer</strong> empirischen Überprüfung nicht<br />
stand. Tests mit NutzerInnen belegten vielmehr, dass das für weiße amerikanische<br />
Frauen intendierte Design <strong>de</strong>r Benutzungsoberfläche von sämtlichen Versuchspersonen<br />
stark abgelehnt wur<strong>de</strong> (Teasley et al. 1994 zitiert nach Preece et al 2002).<br />
Unabhängig vom Geschlecht favorisierten diese durchweg das für europäische<br />
erwachsene männliche Intellektuelle entwickelte User-Interface. Damit wur<strong>de</strong> die weit<br />
verbreitete Auffassung, 165 dass Frauen run<strong>de</strong> und gekrümmte gegenüber kantigeckigen<br />
Formen bevorzugen wür<strong>de</strong>n, für <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r Benutzungsoberflächen<br />
wi<strong>de</strong>rlegt. Das Beispiel zeigt, dass immer wie<strong>de</strong>r ernst gemeinte Vorschläge zur<br />
Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>n Gestaltung von Interfaces - explizit „für<br />
Frauen“ o<strong>de</strong>r explizit „für Männer“ - entstehen, <strong>de</strong>ren Geschlechtervorstellungen jedoch<br />
<strong>einer</strong> empirischen Überprüfung nicht standhalten können.<br />
165 Die Frage, ob Frauen run<strong>de</strong> Formen bei <strong>de</strong>r Interface-Gestaltung bevorzugen wür<strong>de</strong>n, ist mir bei<br />
Vorträgen (insbeson<strong>de</strong>re vor internationalem Informatikpublikum) häufig gestellt wor<strong>de</strong>n.<br />
113
Abbildung 1: (a) Das für weiße amerikanische Frauen intendierte User-Interface (b) Das für europäische,<br />
erwachsene, männliche Intellektuelle gedachte Design (Abbildung nach Preece 2002, 145)<br />
Während dieser Gestaltungsversuch auf unbestätigten Annahmen über<br />
zweigeschlechtlich differenzierte Vorlieben beruhte, grün<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re Ansätze auf<br />
wissenschaftlichen Untersuchungen, welche Unterschie<strong>de</strong> zwischen Frauen und<br />
Männern behaupten. Laura Beckwith und Margaret Burnett (2004) ziehen beispielsweise<br />
eine Reihe empirischer Ergebnisse aus <strong>de</strong>r (lern-)psychologischen Forschung<br />
und <strong>de</strong>m Marketing heran, um „Gen<strong>de</strong>r HCI“ als Teilgebiet <strong>de</strong>r Human-Computer-<br />
Interaction-Forschung zu reklamieren. Ihr Ziel ist es, gegen ein Design von Software,<br />
das eine <strong>de</strong>r Geschlechtsgruppen „Männer“ und „Frauen“ ausschließt, zu<br />
argumentieren. Sie entwickeln eine Taxonomie von Unterschie<strong>de</strong>n zwischen diesen<br />
sozialen Großgruppen, die sie für die EndnutzerInnen-Programmierung als relevant<br />
erachten. Darin fassen sie weit verbreitete und teils empirisch bestätigte Differenzannahmen<br />
über Selbstvertrauen, NutzerInnenführung und Motivation zusammen:<br />
Frauen hätten aufgrund geringeren Selbstvertrauens im Umgang mit <strong>de</strong>m Computer<br />
und einem an<strong>de</strong>ren Risikoverhalten weniger Interesse als Männer, neue Funktionalitäten<br />
eines Programms auszuprobieren, während Männer wegen Selbstüberschätzung<br />
fehlerhafte Ergebnisse nicht erkennen wür<strong>de</strong>n. Weitere Unterschie<strong>de</strong> bestün<strong>de</strong>n<br />
in Lernstilen, Problemlösungsstrategien und <strong>de</strong>r Art wie sie Informationen nutzten, die<br />
eine zweigeschlechtlich differenzieren<strong>de</strong> Unterstützung durch Software erfor<strong>de</strong>rlich<br />
machten. So wür<strong>de</strong>n Männer im Gegensatz zu Frauen nicht dazu neigen, ausführliche<br />
Erklärungen und Hilfefunktionen zu nutzen, son<strong>de</strong>rn eher heuristisch mit <strong>de</strong>r Software<br />
arbeiten, in<strong>de</strong>m sie <strong>de</strong>n Aufwand und Informationsumfang für einfache Aufgaben<br />
minimierten und nur bei komplexeren Aufgaben zu <strong>einer</strong> aufwendigen Strategie hin<br />
wechselten. Ferner sei es für Frauen ein Motivationsfaktor, sich mit Technologie zu<br />
beschäftigen, wenn diese für an<strong>de</strong>re Menschen nützlich ist o<strong>de</strong>r die Kommunikation<br />
114
und Zusammenarbeit unterstützt, während Männer technologische Artefakte um ihrer<br />
selbst Willen spannend fän<strong>de</strong>n und einfach daran Spaß hätten (Beckwith/ Burnett<br />
2004, vgl. hierzu auch Margolis et al. 1999). Die referierten Differenzen wer<strong>de</strong>n zu<br />
Teilaspekten <strong>de</strong>r Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität erklärt. Nicht diskutiert wird dabei, ob sie aus<br />
an<strong>de</strong>ren als geschlechtlichen Faktoren resultieren. Da Beckwith und Burnett diese<br />
Erkenntnisse aus <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n psychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Literatur beziehen, ist häufig unklar, wie die konstatierten Unterschie<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n<br />
Geschlechtsgruppen in Software repräsentiert sein können und aufgrund <strong>de</strong>ssen zu<br />
Ein- bzw. Ausschlüssen führen. 166 Vor allem aber bleibt offen, welchen Effekt diese<br />
informationstechnischen Repräsentationen auf verschie<strong>de</strong>ne NutzerInnen unter verschie<strong>de</strong>nen<br />
Umstän<strong>de</strong>n tatsächlich haben und ob dabei womöglich an<strong>de</strong>re Kategorien<br />
als die <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit wirksam sind. Es gibt verschie<strong>de</strong>ne Hinweise darauf,<br />
dass das Frauen unterstellte geringe Interesse an einem explorativen, spielerischtüfteln<strong>de</strong>n<br />
Umgang mit neuen Funktionalitäten womöglich stärker mit <strong>de</strong>m Maß an<br />
Erfahrungen in <strong>de</strong>r Computernutzung korreliert als generell zu <strong>einer</strong> Frage <strong>de</strong>r<br />
Zugehörigkeit vergeschlechtlichter Großgruppen erklärt wer<strong>de</strong>n kann. 167 Das be<strong>de</strong>utet,<br />
dass sich die essentialistischen Thesen <strong>de</strong>s Ansatzes bereits immanent wi<strong>de</strong>rlegen<br />
lassen.<br />
In ähnliche Legitimationsschwierigkeiten wie die Untersuchungen, die auf <strong>de</strong>r<br />
Annahme zweigeschlechtlich differenzierter Vorlieben grün<strong>de</strong>n, geraten diejenigen<br />
Studien, die sich auf die populärwissenschaftliche Behauptung beziehen, dass Frauen<br />
geringere Fähigkeiten bei <strong>de</strong>r räumlichen Orientierung in <strong>de</strong>r physischen Welt hätten<br />
als Männer und dabei an<strong>de</strong>re Navigationsstrategien verwen<strong>de</strong>ten. 168 Geschlechterunterschie<strong>de</strong><br />
bestün<strong>de</strong>n diesen essentialistischen Auffassungen zufolge vor allem<br />
darin, dass Frauen sich im realen Raum primär an Landmarken (z.B. Gebäu<strong>de</strong>,<br />
Telefonzellen) und Richtungswechseln im Wegverlauf (z.B. „nach <strong>de</strong>m Hotel links<br />
abbiegen“) orientierten, während Männer eher Übersichtswissen besäßen, d.h. eine<br />
landkartenähnliche mentale Repräsentation hätten, bei <strong>de</strong>r Himmelsrichtungen und<br />
räumliche o<strong>de</strong>r zeitliche Entfernungsangaben wesentlich sind. Sigrid Schmitz (1997)<br />
zeigte jedoch, dass auch viele Männer zumeist eine Routenstrategie mit Landmarken<br />
nutzen wür<strong>de</strong>n, wenn sie sich ängstlich und unsicher fühlten, während erkundungserfahrene<br />
Frauen gern Übersichtsstrategien einsetzten (vgl. auch Schmitz/ Nikoleyczik<br />
2004 sowie Grunau 2004). Navigationsstrategien im realen Raum wären <strong>de</strong>mzufolge<br />
166 In späteren Studien begannen die Autorinnen ihre Hypothesen anhand von Problemlösungssoftware<br />
(Excel) und Data Mining zu testen. Dabei ergab sich häufig ein differenzierteres Bild. „An assumption in<br />
much work on gen<strong>de</strong>r differences in computing is that males’ behaviors are reasonably well matched to<br />
today’s problem-solving features […], but the situation is not black and white. For example, in our studies<br />
males’ tinkering patterns have been often more counterproductive to their problem-solving effectiveness<br />
than females’ tinkering patterns […]“ (Beckwith et al. 2006). Auch wenn dabei das Schema, dass Männer<br />
mit <strong>de</strong>m Computer besser umgehen können, aufgebrochen wird, bleiben die Autorinnen <strong>de</strong>m Interpretationssystem<br />
dichotomer Zweigeschlechtlichkeit verhaftet.<br />
167 Vgl. etwa http://www.sigis-ist.org sowie Knapp 1989 und Bath 2000<br />
168 Die Behauptung, dass Geschlechterdifferenzen in kognitiven Fähigkeiten (z.B. Navigation) auf Unterschie<strong>de</strong><br />
zwischen <strong>de</strong>n Gehirnen von Frauen und Männern zurückgeführt wer<strong>de</strong>n können, sind insbeson<strong>de</strong>re<br />
durch die populärwissenschaftlichen Interpretation kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse<br />
durch Alan und Barbara Pease bekannt gewor<strong>de</strong>n; vgl. Pease/ Pease 2000. Kritische Positionen gegenüber<br />
solchen biologistischen Vorstellungen wur<strong>de</strong>n sowohl von Biologinnen und Psychologinnen (vgl. etwa<br />
Quaiser-Pohl/ Jordan 2004) als auch aus <strong>de</strong>r Perspektive feministischer Naturwissenschaftskritik formuliert<br />
(vgl. etwa Schmitz 2004).<br />
115
weniger durch die Kategorie Geschlecht bestimmt als durch Faktoren wie Erfahrung,<br />
Sicherheitsgefühl und Orientierungsängstlichkeit.<br />
Dennoch sind solche geschlechterstereotypen Thesen auf die Navigation im Internet<br />
und in virtuellen Umgebungen übertragen wor<strong>de</strong>n. Im Gegensatz zu oben skizzierten<br />
Ansätzen zu zweigeschlechtlich differenzierten Vorlieben, die Erkenntnisse aus <strong>de</strong>r<br />
(Lern-)Psychologie und <strong>de</strong>m Marketing hypothetisch auf <strong>de</strong>n Umgang mit Computern<br />
transferierten, liegen hierzu jedoch bereits empirische Tests mit NutzerInnen vor.<br />
McDonald und Spencer (2000) etwa fan<strong>de</strong>n in Bezug auf die verwen<strong>de</strong>ten<br />
Navigationsstrategien im Internet ähnliche binär vergeschlechtlichte Unterschie<strong>de</strong> wie<br />
diejenigen, die simplifiziert für <strong>de</strong>n physischen Raum konstatiert wor<strong>de</strong>n sind. So<br />
dienten <strong>de</strong>n Frauen unter <strong>de</strong>n Versuchspersonen ihrer Studie auch im Web<br />
Landmarken als Orientierungspunkte, während Männer zuvor festgelegten Routen<br />
folgten. Im Gegensatz zu stereotypen Ergebnissen <strong>de</strong>r Untersuchungen über <strong>de</strong>n<br />
realen Raum seien die Frauen allerdings effizienter, die gestellten Suchaufgaben zu<br />
erfüllen, obwohl die Männer auch hier ein größeres Selbstvertrauen hätten. An<strong>de</strong>re<br />
Untersuchungen zur Orientierung in Virtual Reality-bzw. 3D-Umgebungen konnten<br />
dagegen we<strong>de</strong>r die Frauen zugeschriebene Landmarken-/Routenstrategie bestätigen<br />
noch binär vergeschlechtlichte Unterschie<strong>de</strong> feststellen (vgl. etwa Brehm et al. 2004,<br />
Ardito et al. 2006). Die empirischen Daten zur Navigation durch virtuelle Räume sind<br />
<strong>de</strong>mnach ebenso wi<strong>de</strong>rsprüchlich wie ihr Bezug auf die Raumorientierung in <strong>de</strong>r<br />
physischen Welt und von <strong>de</strong>r Fragestellung und <strong>de</strong>n Vorannahmen <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
Studie abhängig. Auch in diesem Bereich setzen auch die Studien unreflektierte<br />
Annahmen über Geschlechterdifferenzen und ein binäres, normatives Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
voraus und reproduzieren diese empirisch.<br />
Ein weiteres Feld, in <strong>de</strong>m auf binäre Vorstellungen von Geschlechterdifferenzen<br />
zurückgegriffen wird, ist das <strong>de</strong>r Computer- und Vi<strong>de</strong>ospiele. 169 Ausgangspunkt dieser<br />
Studien in ist zumeist die Frage, warum Jungen bereits im Kin<strong>de</strong>salter ein stärkeres<br />
Interesse an Computerspielen haben als Mädchen und dieser Beschäftigung tatsächlich<br />
auch mehr Zeit widmen – ein Phänomen, das seit vielen Jahren empirische<br />
Bestätigung fin<strong>de</strong>t. 170 Als Antwort wird zumeist ein vielfältiges Spektrum geschlechtsi<strong>de</strong>ntitärer<br />
Merkmale angeführt: Mädchen benutzten <strong>de</strong>n Computer eher als Werkzeug<br />
als zum Spielen. Sie bevorzugten Lernspiele gegenüber reinen Unterhaltungsspielen.<br />
Wenn sie sich mit Computerspielen beschäftigen, so probierten sie gern neue Rollen,<br />
Charaktere und Handlungsweisen aus sowie Spiele mit unterschiedlichem Ausgang.<br />
Es käme ihnen darauf an, Erfahrungen zu machen. Mädchen spielten gern Spiele mit<br />
starken weiblichen Figuren, die ihrer eigenen Lebenswelt ähnlich sind. Wichtig sei,<br />
dass sie sich zu <strong>de</strong>n Figuren in Beziehung setzen können, am besten so wie zu ihrer<br />
besten Freundin, und dass sie Entscheidungen selbst treffen können. Sie favorisierten<br />
Spiele, die sie mit an<strong>de</strong>ren online o<strong>de</strong>r vor <strong>de</strong>m gleichen Computer gemeinsam spielen<br />
169 Die einzige Differenz zwischen Vi<strong>de</strong>ospielen und Computerspielen besteht darin, dass Vi<strong>de</strong>ospiele auf<br />
speziellen Konsolen (z.B. Nintendo o<strong>de</strong>r Sega) gespielt wer<strong>de</strong>n. Ich wer<strong>de</strong> sie im Folgen<strong>de</strong>n nicht weiter<br />
gehend unterschei<strong>de</strong>n.<br />
170 Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, dass ich hier vorwiegend historische Ansätze<br />
zusammenfasse. Da die darin verwen<strong>de</strong>ten Argumente immer wie<strong>de</strong>r neu zitiert wer<strong>de</strong>n (vgl. etwa<br />
Kimpeler 2006, Graner Ray 2004), erscheint mir eine geschlechtertheoretische Diskussion notwendig. Ich<br />
möchte darauf hinweisen, dass es mittlerweile jedoch auch <strong>de</strong>konstruktivistische Ansätze im Bereich <strong>de</strong>r<br />
Computerspiele gibt; vgl. etwa Flanagan 2002 sowie die in Kapitel 5.5 dargestellten feministisch<br />
motivierten Fallbeispiele zum „Mind Scripting“ und „Value Sensitive Design“.<br />
116
können und die die Online-Kommunikation mit <strong>de</strong>n MitspielerInnen unterstützen.<br />
Mädchen bevorzugten realistische Schauplätze gegenüber Science Fiction- und<br />
Fantasy-Szenarien. Spiele, welche die Immersion auf mehreren Ebenen beför<strong>de</strong>rten,<br />
Ent<strong>de</strong>ckungen ermöglichten und starke Handlungsstränge haben, wären für Mädchen<br />
beson<strong>de</strong>rs geeignet, während sie gewalttätige Spiele sowie Kämpfe zwischen Gut und<br />
Böse ablehnten. Im Gegensatz dazu ginge es <strong>de</strong>n Jungen primär darum zu<br />
konkurrieren, ihr Ziel sei Gewinn. Jungen wür<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mentsprechend lineare Spiele<br />
vorziehen, mit einem einzigen richtigen Lösungsweg und ein<strong>de</strong>utig gutem o<strong>de</strong>r<br />
schlechtem Ausgang: „die and start over“. Sie mochten herausragen<strong>de</strong> Hel<strong>de</strong>n mit<br />
übermenschlichen Fähigkeiten. Wichtig sei ihnen Geschwindigkeit und Action im Spiel<br />
(vgl. etwa Agosto 2004, Jenkins 2001, Cassell/ Jenkins 1998, Jantzen/ Jensen 1993).<br />
Auch im Bereich <strong>de</strong>r Computerspiele wer<strong>de</strong>n somit häufig Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong> Vorlieben und zweigeschlechtlich differieren<strong>de</strong> kognitive Fähigkeiten<br />
vorausgesetzt und durch sozialwissenschaftliche Untersuchungen wie<strong>de</strong>rhergestellt.<br />
Für die Fragestellung dieser Arbeit interessanter erscheinen <strong>de</strong>mgegenüber Untersuchungen,<br />
<strong>de</strong>nen zufolge die strikt binär orientierten Auffassungen über Geschlecht<br />
beim Umgang mit Computerspielen von <strong>de</strong>n DesignerInnen reproduziert wer<strong>de</strong>n und<br />
sich <strong>de</strong>shalb im Design wi<strong>de</strong>rspiegelten. Erste Hinweise dafür lieferte bereits 1987 eine<br />
empirische Studie, in <strong>de</strong>r LehrerInnen gefragt wer<strong>de</strong>n, Computerspiele für Mädchen<br />
o<strong>de</strong>r Jungen bzw. allgemein für Kin<strong>de</strong>r zu entwerfen (vgl. Huff/ Cooper 1987, Huff<br />
2002). Diese Aufgabe führte dazu, dass die allgemein für Kin<strong>de</strong>r kreierten Spiele<br />
<strong>de</strong>nen glichen, die für die Jungen gedacht waren, während die Versuchspersonen bei<br />
<strong>de</strong>r Konzeption von Computerspielen für Mädchen stark auf die angeführten<br />
stereotypen Annahmen <strong>de</strong>r An<strong>de</strong>rsartigkeit zurückgriffen. Anhand dieses Beispiels wird<br />
das Zusammenwirken <strong>de</strong>r symbolischen Ebene mit <strong>de</strong>r materialen Reproduktion von<br />
Geschlecht in <strong>de</strong>r Technologieentwicklung sichtbar, das zur Herstellung <strong>de</strong>s Zweigeschlechtlichkeitssystems<br />
beiträgt – ein Aspekt <strong>de</strong>s Prozesses, <strong>de</strong>r im letzten Kapitel als<br />
Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht angesprochen wor<strong>de</strong>n ist. Teils<br />
reduzierte o<strong>de</strong>r überzeichnete Vorstellungen über Geschlechterdifferenzen fließen in<br />
das Design von Software ein und bringen diese Unterschie<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>rum erneut hervor,<br />
nicht nur in <strong>de</strong>r positivistisch-sozialwissenschaftlichen Beschreibung, wie bereits<br />
ausgeführt wur<strong>de</strong>, son<strong>de</strong>rn auch in <strong>de</strong>r Nutzung selbst. In diesem zirkulären<br />
Bestätigungsprozess hegemonialer Geschlechterbil<strong>de</strong>r spielen auch Werbestrategien<br />
eine wesentliche Rolle.<br />
4.1.2. Gegenbewegungen: Design for „the girl“?<br />
Viele <strong>kritisch</strong>e InformatikerInnen sehen <strong>de</strong>n Grund für das konstatierte Phänomen,<br />
dass Mädchen seltener Computerspiele nutzen und an<strong>de</strong>re Arten von Spielen bevorzugen,<br />
zumeist darin, dass Computerspiele für Jungen und Männer gestaltet und<br />
vermarktet wer<strong>de</strong>n (vgl. Subrahmanyam/ Greenfield 1998). Sie kritisieren damit, dass<br />
Mädchen und Frauen qua Design <strong>de</strong>r Technologie von <strong>de</strong>r Nutzung ausgeschlossen<br />
sind. Gegen diese einseitige Ausrichtung formierte sich in <strong>de</strong>n 1990er Jahren eine<br />
Gegenbewegung. Justine Cassell (2003) berichtet von verschie<strong>de</strong>nen Initiativen in <strong>de</strong>n<br />
USA, die Computerspiele speziell für Mädchen entwickelten und versuchten, sich die<br />
im letzten Abschnitt skizzierten Erkenntnisse über binär vergeschlechtlichte<br />
117
Differenzen dabei zu Nutze zu machen. Zu diesem sogenannten „Girls’ Games<br />
Movement“ 171 zählten feministisch orientierte Unternehmerinnen, die explizit zum<br />
Empowerment <strong>de</strong>r nächsten Generation von Frauen beitragen wollten. Ihr Ziel war es,<br />
Mädchen für Computerspiele zu interessieren, welches sie häufig mit <strong>de</strong>m Gleichheitsargument<br />
begrün<strong>de</strong>ten, dass junge Frauen durch Beschäftigung mit Computerspielen<br />
Fähigkeiten im Umgang mit <strong>de</strong>m Gerät erwerben wür<strong>de</strong>n, die für eine spätere gut<br />
bezahlte Beruftätigkeit notwendig wären. Einige Vertreterinnen <strong>de</strong>s „entrepreneurial<br />
feminism“ (Cassell/ Jenkins 1998, 14) sahen Computerspiele als einen Bereich an, in<br />
<strong>de</strong>m konventionelle und stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit untergraben wer<strong>de</strong>n<br />
können. An<strong>de</strong>ren Firmen dagegen, die sich gleichfalls auf die skizzierten<br />
Geschlechterdifferenzforschungen beriefen, ging es jedoch keineswegs um feministische<br />
Ziele. Sie ent<strong>de</strong>ckten vielmehr in Computerspielen für Frauen einen noch nicht<br />
erschlossenen Markt, <strong>de</strong>r durch die neue Zielgruppe ökonomische Vorteile versprach.<br />
Das erste bekannte Computerspiel für Mädchen war „Barbie Fashion Designer“ <strong>de</strong>r<br />
Firma Mattel. Diese Software gab <strong>de</strong>n NutzerInnen die Möglichkeit, Kleidung für die<br />
Barbiepuppe zu gestalten, eine virtuelle Barbie damit anzuklei<strong>de</strong>n und auf einen<br />
virtuellen Laufsteg zu schicken. Später konnte das Design <strong>de</strong>r Kleidung auf einem<br />
speziellen Stoff ausgedruckt wer<strong>de</strong>n, um es dann auszuschnei<strong>de</strong>n, zusammenzunähen<br />
und <strong>de</strong>r physischen Barbie anziehen zu können. „Barbie Fashion Designer“ ist <strong>de</strong>shalb<br />
kein Spiel „an sich“, kein „game qua game“ wie Subrahmanyarn/ Greenfield (1998)<br />
betonen, son<strong>de</strong>rn ein Accessoir für das materiale Spiel mit Barbiepuppen. Es ist eine<br />
Software, die sich in ein bereits bestehen<strong>de</strong>s Spiel mit physischen Puppen einpasst.<br />
Dieses Design bestätigt vorherrschen<strong>de</strong> stereotype Geschlechterkonzeptionen <strong>de</strong>s<br />
Umgangs mit <strong>de</strong>m Computer, ohne dabei jedoch emanzipatorische Absichten zu<br />
verfolgen. Das „Spiel“, das 1996 auf <strong>de</strong>n Markt gebracht wur<strong>de</strong>, verkaufte sich bereits<br />
in <strong>de</strong>n ersten zwei Monaten 500.000 Mal. Es war damit zu dieser Zeit auf <strong>de</strong>m USamerikanischen<br />
Markt erfolgreicher als je<strong>de</strong>s an<strong>de</strong>re Computerspiel für Kin<strong>de</strong>r.<br />
Die Interface-Designerin und Medientheoretikerin Brenda Laurel, 172 die Mitte <strong>de</strong>r<br />
1990er Jahre die Start-Up-Firma Purple Moon grün<strong>de</strong>te, fühlte sich dagegen schon<br />
eher <strong>de</strong>m feministischen „Girls’ Games Movement“ verpflichtet. Sie produzierte<br />
Computerspiele mit Mädchen und Frauen als Spielfiguren, gestaltet als „friendship<br />
adventures for girls“, in die eine Reihe von Annahmen über Interessen von Mädchen<br />
(z.B. Tagebuch schreiben, Horoskop lesen, Quiz über Romanzen lösen) eingingen.<br />
Laurel betonte vielfach, dass das Design ihrer Spiele auf empirischen Studien über<br />
Mädchen und ihre Spielmotivationen basiere, sie selbst hatte in <strong>einer</strong> umfangreichen<br />
Untersuchung 1000 junge Frauen in <strong>de</strong>n USA befragt. In feministischen Kreisen<br />
provozierte Laurel mit <strong>de</strong>r Bemerkung: „I agreed that whatever solution the research<br />
suggested, I’d go along with it. Even if it meant shipping products in pink boxes” (Laurel<br />
zitiert nach Jenkins 2001, o.S.). Damit ging es ihr weniger um die Verpackung als<br />
171 Die Herausbildung <strong>de</strong>s feministisch orientierten „Girls’ Games Movement“ scheint ein einmaliges, auf<br />
<strong>de</strong>n US-amerikanischen Raum beschränktes Phänomen zu sein. So wur<strong>de</strong> etwa im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
umfangreichen Studie SIGIS (Strategies of Inclusion, Gen<strong>de</strong>r and the Information Society) von k<strong>einer</strong><br />
vergleichbaren Bewegung im europäischen Kontext berichtet; vgl. Faulkner 2004, Faulkner/ Lie 2007<br />
sowie http://www.sigis-ist.org. Da jedoch insbeson<strong>de</strong>re die aktuelle <strong>de</strong>utsche Fraunhofer-Studie „Discover<br />
Gen<strong>de</strong>r“ (vgl. Bührer/ Schraudner 2006, Schraudner/ Lukoschat 2006 sowie Kapitel 2.2) strukturell<br />
vergleichbar argumentiert, wird die Entwicklung <strong>de</strong>s „Girls’ Games Movement“ im Folgen<strong>de</strong>n diskutiert.<br />
172 In <strong>de</strong>r Informatik ist Laurel vor allem durch ihr Buch „Computers as Theatre“ (1991) bekannt, das als<br />
<strong>einer</strong> <strong>de</strong>r ersten Beiträge zur Medieninformatik betrachtet wer<strong>de</strong>n kann.<br />
118
primär um die Frage, wie ein feministisches Anliegen – Mädchen <strong>de</strong>n Umgang mit<br />
Computern zu erleichtern und generell zu stärken – transportiert wer<strong>de</strong>n kann. Im<br />
Gegensatz zu <strong>de</strong>r behüteten Welt <strong>de</strong>r Barbiepuppen, sollten die Mädchen in Laurels<br />
Spielwelten stärker <strong>de</strong>n realen Herausfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s Lebens ausgesetzt wer<strong>de</strong>n:<br />
„Our characters exhibit loyalty, honor, love, and courage. They also struggled with<br />
gossip, jealousy, cheating, lipstick, smoking, exclusion, racism, poverty, materialism<br />
and broken homes. When we had to choose, we sacrificed political correctness in or<strong>de</strong>r<br />
to meet the girls where they were, in the realities of their own lives.” (ebd.). Die Purple<br />
Moon Website war äußerst populär, dagegen scheiterten die Computerspiele <strong>de</strong>r Firma<br />
auf <strong>de</strong>m Markt, sie wur<strong>de</strong> schließlich von <strong>de</strong>m US-amerikanischen Spielekonzern<br />
Mattel aufgekauft, <strong>de</strong>r u.a. Barbiepuppen produziert.<br />
Das „Girls’ Games Movement“ wur<strong>de</strong> vielerorts scharf kritisiert und hält <strong>de</strong>r hier<br />
eingenommenen geschlechtertheoretischen Perspektive nicht stand (vgl. etwa Cassell/<br />
Jenkins 1998, Deuber-Mankowski 2007). Dabei ist jedoch zunächst zu fragen, aus<br />
welcher Position heraus die Kritik geäußert wird. Denn Jenkins (2001) weist darauf hin,<br />
dass die Argumente, die sich mit <strong>de</strong>m Scheitern von Computerspielen für Mädchen am<br />
Markt legitimieren, häufig im Sinne eines Backlash gegen Feminismen gerichtet sind.<br />
Demgegenüber ist meines Erachtens trotz <strong>de</strong>s ökonomischen Misserfolgs und trotz <strong>de</strong>r<br />
noch auszuführen<strong>de</strong>n theoretische Einwän<strong>de</strong> zu würdigen, dass mit <strong>de</strong>m „Girls’ Games<br />
Movement“ ein Raum im Bereich <strong>de</strong>r Computertechnologien entstan<strong>de</strong>n war, in <strong>de</strong>m<br />
mit Hilfe entsprechen<strong>de</strong>n Designs von Technologien bewusst versucht wur<strong>de</strong>, emanzipatorische<br />
Ziele zu implementieren. Die Entwicklungen waren von Frauen initiiert, die<br />
sich aktiv gegen <strong>de</strong>n Ausschluss von Mädchen als NutzerInnen zu richten versuchten,<br />
<strong>de</strong>r ihres Erachtens durch die vorherrschen<strong>de</strong>, implizit an Jungen orientierte<br />
Gestaltung von Computerspielen fortgeführt wor<strong>de</strong>n wäre.<br />
Trotz <strong>de</strong>r gut gemeinten Absichten ist das Geschlechterverständnis dieser<br />
feministischen Designbewegung grundsätzlich zu problematisieren. Denn es greift<br />
zumeist auf eine fragwürdige Geschlechterdifferenzforschung zurück und versucht, das<br />
empirisch zu verifizieren, was <strong>de</strong>n kritisierten „Computerspielen von und für Jungs“ als<br />
implizites Selbst- und Alltagsverständnis bereits eingeschrieben ist. Ein solches<br />
„Design von und für Mädchen“ basiert damit auf <strong>de</strong>nselben Voraussetzungen, auf <strong>de</strong>m<br />
das verworfene Design grün<strong>de</strong>te: <strong>de</strong>r binären geschlechtsein<strong>de</strong>utigen Interpretation<br />
von Jungen und Mädchen im Verhältnis zu Technologien. So interviewten etwa<br />
Cornelia Brunner, Dorothy Bennett, and Margaret Honey (1998) für ihre Studie<br />
insgesamt nur 24 Personen und gaben auf dieser Basis strikt geschlechterdualistische<br />
Interpretationen an: „Frauen sehen Technik als ein Werkzeug“, „Männer sehen sie als<br />
Waffe“, „Frauen wollen sie für die Kommunikation nutzen“, „Männer wollen sie zur<br />
Kontrolle benutzen“ etc. Für viele technische Entwicklungen, die im Rahmen <strong>de</strong>s „Girls’<br />
Games Movement“ entstan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n primär solche Studien herangezogen, die<br />
ausschließlich auf binäre Geschlechterunterschie<strong>de</strong> fokussierten und an<strong>de</strong>re<br />
Differenzen vernachlässigten. Die Artefakte bringen damit starke Generalisierungen<br />
über Mädchen hervor, diese wer<strong>de</strong>n als eine homogen-monolithische Gruppe<br />
verstan<strong>de</strong>n. Die Studien wie auch die Computerspiele konstruieren ein „universelles<br />
Mädchen“, das in <strong>de</strong>r Regel implizit und unreflektiert als westlich, weiß, heterosexuell<br />
und aus <strong>de</strong>r Mittelschicht stammend vorausgesetzt wird. Auf diese Weise stellt die mit<br />
<strong>de</strong>m Design intendierte Inklusion von Mädchen in die Gruppe von<br />
119
ComputerspielerInnen erneute Ausschlüsse her, <strong>de</strong>nn diejenigen, die <strong>de</strong>r als „normales<br />
Mädchen“ gesetzten Norm nicht entsprechen, wer<strong>de</strong>n nicht angesprochen. Soziale und<br />
kulturelle Unterschie<strong>de</strong>, welche die aktuelle Geschlechterforschung unter <strong>de</strong>m Begriff<br />
<strong>de</strong>r Intersektionalität in ihrem Zusammenspiel mit <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht verhan<strong>de</strong>lt,<br />
wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Konzeption <strong>de</strong>r für Mädchen intendierten Spiele ignoriert. 173<br />
Das Problem besteht damit zum einen darin, dass mit Bezug auf wissenschaftliche<br />
Untersuchungen ein normatives Verständnis von „Mädchen“ hervorgebracht wird. Es<br />
ließe sich jedoch einwen<strong>de</strong>n, dass die empirischen Studien nur sozialwissenschaftlich<br />
fundiert durchgeführt und interpretiert wer<strong>de</strong>n müssten, dann wür<strong>de</strong>n sie die<br />
tatsächlichen Zugänge und Umgangsweisen mit Computerspielen in ihrer Vielfalt<br />
wi<strong>de</strong>rspiegeln. Dazu könnte sicherlich auch ein Blick auf an<strong>de</strong>re Differenzen beitragen.<br />
Genau dies hatte Laurel jedoch versucht, allerdings ist ihr feministischer Ansatz auf<br />
<strong>de</strong>m Spielemarkt (im Gegensatz zu Laurels erfolgreichen Webseiten) ökonomisch<br />
fehlgeschlagen. Es sei jedoch kein Zufall, wie Justine Cassell und Henry Jenkins in<br />
ihrem Buch „From Barbie to Mortal Combat“ betonen, dass Mädchen an<strong>de</strong>re Spiele<br />
bevorzugten und die Produkte rosa o<strong>de</strong>r lila verpackt zugeschickt bekommen wollen. „<br />
[S]uch <strong>de</strong>sires are manufactured by the toy industry itself long before the researchers<br />
get a chance to talk with the girls and find out ‚what girls really want from<br />
technology‘“(Cassell/ Jenkins 1998, 19). Ein zweites Problem liegt <strong>de</strong>mzufolge darin,<br />
dass sozialwissenschaftlich ermittelte Erkenntnisse nur die bereits zuvor festgeschriebenen<br />
„Interessen von Mädchen“ spiegeln und damit primär sozial geprägte und<br />
erwünschte Antworten repräsentieren. Auch die Eltern, die Computerspiele kaufen,<br />
sind von diesen Vorannahmen nicht frei. Insofern weisen empirische Metho<strong>de</strong>n<br />
Grenzen auf, wenn es hier nicht nur darum gehen soll, das Bestehen<strong>de</strong> zu erkun<strong>de</strong>n,<br />
um es technologisch adäquat zu bedienen, son<strong>de</strong>rn das Design von Technologie<br />
emanzipatorisch auszurichten.<br />
Ein drittes Problem besteht darüber hinaus in <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong>n Differenzierung <strong>de</strong>s Designs selbst. Darauf <strong>de</strong>utet die Entwicklung<br />
<strong>de</strong>s Computerspiels „The SIMS“ <strong>de</strong>r Firma Maxis, für das Jenkins (2001) herausarbeitet,<br />
dass es genau die Kriterien erfüllt, die als „weibliche“ Zugänge zur elektronischen<br />
Spielewelt gelten. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>r Strategie <strong>de</strong>s „Girls’ Games Movement“<br />
wird „The SIMS“ jedoch we<strong>de</strong>r als ein „Spiel für Mädchen“ vermarktet, noch grün<strong>de</strong>t es<br />
auf einem „Design for the girl“. Auf diese Weise scheint es <strong>de</strong>m Problem, vermeintliche<br />
Eigenschaften von Mädchen in <strong>einer</strong> geschlechternormativen Weise durch Technologie<br />
zu reproduzieren und festzuschreiben, zu entkommen. Und tatsächlich wird diesem<br />
auch ein großer Markterfolg bei Mädchen bestätigt. 174 Ist ein auf Geschlecht<br />
173 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass für Jungen seit langer Zeit unterschiedliche<br />
Produkte angeboten wer<strong>de</strong>n. Der Spielemarkt hat sich für diese Zielgruppe relativ stark ausdifferenziert.<br />
So lassen sich hier beispielsweise Abenteuerspiele, Actionspiele, Sportspiele, Rollenspiele, Denk- bzw.<br />
Logikspiele, Labyrinthspiele, Strategiespiele und Fahrzeugsimulatoren unterschei<strong>de</strong>n.<br />
174 Dass ein geschlechterdifferenzieren<strong>de</strong>s Design – entgegen <strong>de</strong>r Intention <strong>de</strong>s „Girls’ Games Movement“<br />
– nicht zum gewünschten Erfolg bei Mädchen und Frauen führt, darauf <strong>de</strong>uten die neueren Entwicklungen<br />
im Computerspiel-Design. So berichten etwa Henry Jenkins und Justine Cassell (2008) rückblickend auf<br />
die Debatten <strong>de</strong>r 1990er Jahre von großen Verän<strong>de</strong>rungen aufgrund <strong>de</strong>r partizipativen Kultur, die sich in<br />
diesem Bereich durchgesetzt hat: „Very little time was spent […] discussing game content or the efforts of<br />
the mainstream game industry to reach female consumers. Rather, the focus had shifted onto participatory<br />
culture, onto the social dynamics that emerged as players created their own i<strong>de</strong>ntities and communities<br />
within massively multiplayer online games, onto the ways that players were modifying existing games to<br />
serve alternative purposes, onto workshops that were teaching young people game <strong>de</strong>sign skills, and onto<br />
120
eflektieren<strong>de</strong>s Design ohne explizite Bezugnahme auf Mädchen bzw. Frauen in <strong>de</strong>r<br />
Vermarktung also ein Weg, ansonsten ausgegrenzte NutzerInnen einzuschließen ohne<br />
dabei erneut Stereotype herzustellen? Dieser Frage wird im folgen<strong>de</strong>n Kapitel 5 weiter<br />
nachgegangen. Ebenso wird dort diskutiert, ob und unter welchen Umstän<strong>de</strong>n ein<br />
„Design für Frauen“ <strong>de</strong>nnoch sinnvoll sein kann, um Ausschlüsse von <strong>de</strong>r Nutzung<br />
abzuwen<strong>de</strong>n, und wie sich dabei Festschreibungen von Geschlechterdifferenzannahmen<br />
vermei<strong>de</strong>n lassen. Zuvor wer<strong>de</strong>n jedoch noch weitere Studien vorgestellt, die das<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte aufzeigen, zunächst solche, die mit <strong>de</strong>m Ausschluss<br />
von Frauen von <strong>de</strong>r Nutzung argumentieren.<br />
4.1.3. Von Männern <strong>de</strong>finierte Probleme: Worauf geben technische Lösungen<br />
Antworten?<br />
Eine weitere Ebene <strong>de</strong>s Ausschlusses von Frauen durch das Design, die Studien <strong>de</strong>r<br />
Geschlechter-Technik-Forschung anführen, ist die <strong>de</strong>r Problem<strong>de</strong>finitionen. Dabei wird<br />
in <strong>de</strong>r Regel angenommen, dass Technikentwicklung primär von <strong>einer</strong> spezifischen,<br />
homogenen Gruppe von Männern getragen wird, die für politische und ökonomische<br />
Entscheidungen <strong>de</strong>r Technologieentwicklung ebenso verantwortlich sind wie dafür,<br />
welche Forschung geför<strong>de</strong>rt und welche Technologien entwickelt wer<strong>de</strong>n sollen. Die<br />
technischen Produkte seien auf verschie<strong>de</strong>nen Stufen <strong>de</strong>r Technologieentwicklung von<br />
<strong>de</strong>n Perspektiven dieser Menschen stark beeinflusst. Ihre Erfahrungen, ihre Lebenswelt<br />
und Lebenssituation, ihre Werte und Selbstverständnisse prägten die technischen<br />
Artefakte maßgeblich. 175 Dies gelte nicht nur für die bewussten Entscheidungen<br />
darüber, was in <strong>de</strong>r Technologie explizit repräsentiert sein, d.h. was sie leisten soll,<br />
son<strong>de</strong>rn insbeson<strong>de</strong>re für die blin<strong>de</strong>n Flecken. Implizite Annahmen, die Ausschlüsse<br />
produzierten, seien bereits in <strong>de</strong>n Visionen und Leitbil<strong>de</strong>rn sowie in <strong>de</strong>n Vorstellungen,<br />
wofür und für wen die Technologie intendiert ist, verankert. 176<br />
Die Wissenschaftstheoretikerin Londa Schiebinger diagnostiziert Ausgrenzungen in<br />
<strong>de</strong>n Hintergrundannahmen, welche sie als ‚Selbstverständlichkeiten‘ charakterisiert, die<br />
so harmlos erscheinen, dass sie in <strong>einer</strong> Gemeinschaft von Fachleuten nicht mehr<br />
wahrgenommen wer<strong>de</strong>n. „Diese Annahmen sichern grundlegen<strong>de</strong> Arbeitsweisen, wozu<br />
ein gewisses Maß an Konsens gehört, das sich auf Problem<strong>de</strong>finitionen, die Annehmbarkeit<br />
<strong>de</strong>r Lösungen, geeignete Techniken [...] erstreckt. Formelle und informelle<br />
Ausschlüsse aus <strong>de</strong>r Gemeinschaft schützen die Annahmen und bekräftigen sie. In <strong>de</strong>r<br />
Abwesenheit abweichen<strong>de</strong>r Auffassungen wer<strong>de</strong>n Forschungsprogramme oft ganz<br />
unbewußt und unbeabsichtigt von sozialen Werten und Praktiken strukturiert.“<br />
research initiatives that resulted in the production of games for use in the classroom. Today’s gamers grew<br />
up in an area of consumer-produced content all around – web pages, blogs, music sampling and mashing.<br />
If the game industry would not produce the kinds of games women wanted to play, they would simply<br />
make their own“ (Jenkins/ Cassell 2008, o.S.)<br />
175 Vgl. hierzu auch das Skriptkonzept Akrichs und Rommes (siehe Kapitel 3.7), das zum Verständnis, wie<br />
technologischen Artefakte Barrieren gegenüber bestimmten NutzerInnen eingeschrieben wer<strong>de</strong>n können,<br />
die Analyse <strong>de</strong>r NutzerInnnen semiotisch darauf wen<strong>de</strong>t, wie TechnologiegestalterInnen sich diese<br />
vorstellen.<br />
176 Die Problemstellungen, auf die technische Lösungen Antworten geben, wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n TechnologieentwicklerInnen<br />
nicht notwendigerweise angeführt. Zwar zwingt die Forschungsför<strong>de</strong>rung die Antragstellen<strong>de</strong>n<br />
zunehmend dazu, ihre Forschung und Entwicklung mit einem gesellschaftlichen Nutzen zu<br />
begrün<strong>de</strong>n. Doch wird gera<strong>de</strong> im Bereich <strong>de</strong>r Informationstechnologien häufig generell von einem<br />
ökonomischen Nutzen ausgegangen, <strong>de</strong>r nicht im Einzelfall legitimiert wer<strong>de</strong>n muss.<br />
121
(Schiebinger 1999, 205). Daraus resultierten Einseitigkeiten in <strong>de</strong>r Auswahl und Definition<br />
wissenschaftlicher Probleme, auf die eine Reihe von Beispielen aus <strong>de</strong>m Bereich<br />
<strong>de</strong>r Naturwissenschaften und Medizin verwiesen, die in <strong>de</strong>n letzten drei Deka<strong>de</strong>n von<br />
feministischen ForscherInnen angeführt wur<strong>de</strong>n. Evelyn Fox Keller veranschaulichte<br />
geschlechterdifferenzieren<strong>de</strong> Verzerrungen anhand <strong>de</strong>r Forschung zur Empfängnisverhütung.<br />
Diese habe sich vornehmlich auf solche Techniken konzentriert, die von<br />
Frauen anzuwen<strong>de</strong>n seien, anstatt darauf hinzuwirken, die Verantwortung für die<br />
Verhütung „geschlechtergerecht“ im Sinne <strong>de</strong>r Binarität hegemonialer Zweigeschlechtlichkeit<br />
zu verteilen und in Metho<strong>de</strong>n, die Männer nutzen können, zu investieren (vgl.<br />
Keller 1989 [1982], 282f) Auf <strong>einer</strong> allgemeinen Ebene kritisiert Schiebinger, dass in<br />
<strong>de</strong>n 1990er Jahren in <strong>de</strong>n USA umfangreiche Ressourcen in das Human-Genom-<br />
Projekt geflossen seien, während diese für gesellschaftlich notwendigere Projekte<br />
fehlten. Die Biologin Ruth Hubbard behauptet sogar, dass die einseitige För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />
Genforschung und Molekularbiologie im Grun<strong>de</strong> die Gesundheit gefähr<strong>de</strong>, da sie die<br />
Aufmerksamkeit und Ressourcen von <strong>de</strong>m Problem <strong>de</strong>r Armut und Unternährung<br />
abziehe. Sie plädiert für soziale und politische Maßnahmen, um Arbeitsplätze zu<br />
schaffen, für einen Min<strong>de</strong>st-Lebensstandard zu sorgen und diesen zu gewährleisten<br />
(vgl. Hubbard 1995 nach Schiebinger 1999, 211). Demzufolge ist Wissenschaft<br />
gesellschaftlich, historisch und sozial zu kontextualisieren, um eine <strong>kritisch</strong>e Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
darüber führen zu können, was sinnvolle und legitime Fragestellungen<br />
von Forschung und Entwicklung sein sollen und welche Antworten darauf jeweils<br />
adäquat erscheinen.<br />
Angesichts <strong>de</strong>r enormen öffentlichen wie privatwirtschaftlichen Ressourcen, die in<br />
die Software-Entwicklung und Forschungsför<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Informatik 177 fließen, sind die<br />
„Hintergrundannahmen“ <strong>informatischer</strong> Vorhaben zu hinterfragen. Voraussetzung dafür<br />
ist es, die Problem<strong>de</strong>finitionen, Visionen und Leitbil<strong>de</strong>r, auf <strong>de</strong>nen technische Lösungen<br />
beruhen, herauszuarbeiten, wozu Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung<br />
nützlich sein können. GeschlechterforscherInnen haben hierzu Fallstudien<br />
vorgelegt.<br />
So rekonstruiert Anne-Jorunn Berg (1999 [1994]) am Beispiel von drei Prototypen<br />
„intelligenter Häuser“ die Motivationen <strong>de</strong>r Hersteller, die in die Entwicklung dieser<br />
Artefakte eingeflossen sind.Dabei bestand ihr Untersuchungsinteresse primär in <strong>de</strong>r<br />
Frage, wie Hausarbeit – so, wie sie auf Grundlage <strong>de</strong>r sich seit <strong>de</strong>n 1950er Jahren verfestigten<br />
mo<strong>de</strong>rnen Arbeitsteilung in Mittelklassehaushalten hauptsächlich von Frauen<br />
geleistet wird – in <strong>de</strong>n technischen Entwürfen repräsentiert ist und welche KonsumentInnen<br />
die Designer als Zielgruppe ihres Produkts annehmen. Berg analysierte<br />
dazu <strong>einer</strong>seits die existieren<strong>de</strong>n Prototypen und ihre Werbebroschüren. An<strong>de</strong>rerseits<br />
führte sie Interviews mit <strong>de</strong>n Entwicklern durch.<br />
Auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r technischen Implementierung konnte sie keine Bezugnahme auf<br />
Haushaltstätigkeiten feststellen, <strong>de</strong>nn die Funktionalitäten beschränkten sich auf die<br />
Bereiche Energie, Sicherheit, Kommunikation, Unterhaltung und Umwelt. Das Ziel <strong>de</strong>r<br />
technischen Entwicklungsarbeit schien ausschließlich auf die zentralisierte Kontrolle<br />
und Regulierung dieser Bereiche zu fokussieren, für die im Einzelnen bereits<br />
177 Insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Bereich <strong>de</strong>r Forschungsför<strong>de</strong>rung sollte sich mit <strong>de</strong>r hier angesprochenen Thematik<br />
intensiv auseinan<strong>de</strong>rsetzen und in entsprechen<strong>de</strong> För<strong>de</strong>rinstrumente und Begutachtungsverfahren<br />
einfließen lassen.<br />
122
technologische Lösungen vorlagen. Nur eines <strong>de</strong>r Projekte verfolgte die weiter<br />
gehen<strong>de</strong> Vision eines „intelligenten Hauses“ als „a house you can talk to, a house that<br />
answers in different voices, where every room can be adjusted to your changing<br />
moods, a house that is a servant, adviser and friend to each individual member of the<br />
household“ (Berg 1999 [1994], 305). Dieser Traum schien zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Untersuchung<br />
allerdings weit von <strong>de</strong>r Realisierung entfernt. Die Werbeprospekte priesen die<br />
Häuser damit an, dass die EigentümerInnen nicht mehr darüber nach<strong>de</strong>nken müssten,<br />
„how things are done“; das Haus soll eines sein, „which will take care of me“. Ein<br />
weiteres Mo<strong>de</strong>ll wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bild eines Roboters beworben, <strong>de</strong>r <strong>einer</strong> Mutter<br />
Frühstück serviert. Im Begleittext heißt es: „We are not replacing Mommy with a robot.<br />
We are representing i<strong>de</strong>as on how to <strong>de</strong>sign, build and use a home in new ways that<br />
can reduce drudgery while increasing comfort, convenience and security“ (Mason 1983<br />
zitiert nach Berg 1999, 308).<br />
Das Zitat ließe vermuten, dass die neue Technologie auch darauf ziele, die<br />
angesprochene „Plackerei“ mit <strong>de</strong>r Hausarbeit zu verringern, informationstechnisch zu<br />
unterstützen und zumin<strong>de</strong>st zu erleichtern. In <strong>de</strong>n Funktionalitäten fand sich von<br />
diesem Anspruch jedoch nichts wie<strong>de</strong>r. Bergs Interviews lieferten ebenso wenig<br />
Hinweise darauf, dass die Entwickler Hausarbeit berücksichtigt hatten. Während eine<br />
<strong>de</strong>r untersuchten Firmen darauf verwies, dass diese eher eine Sache <strong>de</strong>r „white goods<br />
producers“ sei, wur<strong>de</strong> beim zweiten Hersteller betont, dass das Licht in ihrem Haus<br />
automatisch angehe, wenn die Hausfrau mit vollen Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Raum betritt. Im dritten<br />
Prototypen fand sich ein „gourmet autochef“, <strong>de</strong>r jedoch nur Kochrezepte vorschlug.<br />
Berg kritisiert, dass die Entwickler keine Vorstellung von <strong>de</strong>r Vielfalt und <strong>de</strong>n<br />
materiellen Notwendigkeiten von Hausarbeit hätten, insbeson<strong>de</strong>re zeitrauben<strong>de</strong> und<br />
körperlich anstrengen<strong>de</strong> Aufgaben wür<strong>de</strong>n ignoriert. Die Studie bestätigt <strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>n<br />
Verdacht, dass das in informatischen Artefakten Ausgeschlossene häufig genau das<br />
ist, was als „weiblich“ o<strong>de</strong>r als „Frauenarbeit“ gilt.<br />
Insgesamt setzten die Hersteller <strong>de</strong>r untersuchten intelligenten Häuser zwar implizit<br />
voraus, dass ihre Prototypen geschlechtsneutral seien. Allerdings zeigt Bergs Analyse,<br />
dass bereits bei <strong>de</strong>r Konzeption Annahmen über Geschlecht konstituieren<strong>de</strong> und<br />
hierarchisieren<strong>de</strong> gesellschaftliche Strukturen eingeschrieben waren. Es han<strong>de</strong>lt sich<br />
hier – im Vergleich zur geschlechtlichen Segregation von Erwerbsarbeit, die im folgen<strong>de</strong>n<br />
Abschnitt 4.2. ausführlicher diskutiert wird – um die Ausgrenzung von Haus- und<br />
Reproduktionsarbeit, auf <strong>de</strong>ren gesellschaftliche Ignoranz und Unterbewertung feministische<br />
Forschungen seit mehreren Jahrzehnten aufmerksam machten. Bergs Studie<br />
weist darauf hin, dass dieser Ausgrenzungsprozess <strong>de</strong>r als „weiblich“ gelten<strong>de</strong>n<br />
Bereiche auch bei <strong>de</strong>r Entwicklung von Technologien wirksam ist und dadurch vergeschlechtlichte<br />
Technologien entstehen. Jedoch geht ihre Studie über geschlechtersoziologische<br />
Analysen hinaus, da sie <strong>de</strong>n Blick zugleich auf die an <strong>de</strong>r Konstruktion<br />
von Technologien beteiligten Menschen lenkt. Bergs Interviews <strong>de</strong>cken auf, dass sich<br />
die Entwickler am ehesten selbst als potentielle Käufer imaginieren: „It’s the technology-as-such,<br />
the way artefacts function in technical terms, that fascinates the<br />
<strong>de</strong>signers. […] the target consumer is implicitly the technical-interested man, not unlike<br />
the stereotype of the computer hacker“ (Berg 1999, 308). Dadurch, dass die Entwickler<br />
<strong>einer</strong> weitgehend homosozialen Gruppe von Technikbegeisterten angehörten, die <strong>de</strong>m<br />
weit verbreiteten Vorurteil über Informatiker entspricht, wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rückgriff auf das<br />
123
eigene Selbstverständnis zu einem Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Technologie führen. Es seien<br />
Wünsche, Träume und Visionen von bestimmten Gruppen Informatik betreiben<strong>de</strong>r<br />
Männer, die in <strong>de</strong>n betrachteten Prototypen intelligenter Häuser vergegenständlicht<br />
sind. 178 Die Unsichtbarkeit und mangeln<strong>de</strong> Unterstützung gewöhnlicher Haushaltstätigkeiten<br />
ist <strong>de</strong>mnach eng verknüpft mit <strong>de</strong>r Implementierung von Funktionalitäten, die<br />
<strong>de</strong>n Entwicklern aus <strong>de</strong>r Perspektive ihres spezifischen lebensweltlichen Erfahrungsraums<br />
heraus als sinnvoll und wünschenswert erscheinen. 179 Dass eine solche Einschreibung<br />
persönlicher Träume <strong>de</strong>r Entwickler in die Artefakte möglich war, lässt<br />
darauf schließen, dass diese die potentiellen KundInnen ihres Produktes nicht<br />
hinreichend in <strong>de</strong>n Blick bekommen haben. Berg betont, dass die von ihr befragten<br />
Hersteller intelligenter Häuser in <strong>de</strong>n Interviews nicht in <strong>de</strong>r Lage waren, die Zielgruppe<br />
ihres Angebots genauer zu charakterisieren. „Anyone and everyone“ schien die<br />
einhellige Antwort <strong>de</strong>r Firmen auf die Frage nach möglichen KundInnen, die nur in<br />
einem <strong>de</strong>r drei Fälle stereotyp als „Kleinfamilie“ mit männlichem Ernährer spezifiziert<br />
wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Die Studie rekonstruiert die <strong>de</strong>n intelligenten Häusern zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong> Problem<strong>de</strong>finition<br />
als eine „männlich“ geprägte. Sie gerät damit in die bereits diskutierte Problematik<br />
<strong>de</strong>r Reifizierung von Zweigeschlechtlichkeit durch die Frauen- und Geschlechterforschung<br />
selbst hinein. Es erscheint zwar durchaus gerechtfertigt, auf die Ausgrenzung<br />
von Hausarbeit und ihrer materiellen Bedingungen in <strong>de</strong>r technischen Konzeption<br />
hinzuweisen, die beispielsweise in Bergs rhetorischer Nachfrage „Does nobody change<br />
the sheets? Is that meal not cooked and are the dishes not washed afterwards? Are<br />
those possessions never dusted?“ (Berg 1999, 309) zum Ausdruck kommt. In<strong>de</strong>m Berg<br />
diesen <strong>kritisch</strong>en Hinweis jedoch mit <strong>de</strong>r Behauptung einleitet, dass sicherlich je<strong>de</strong><br />
Hausfrau danach fragen wür<strong>de</strong>, nimmt sie eine fragwürdige Zuweisung <strong>de</strong>r ignorierten<br />
Tätigkeiten (d.h. <strong>de</strong>r Sorge für das Zuhause) an „die Hausfrau“ vor. Gleichzeitig<br />
zementiert ihre Beschreibung <strong>de</strong>r Technikgestalter <strong>de</strong>n Mythos vom männlichen<br />
Hacker. 180 Was sie <strong>de</strong>n Konstrukteuren intelligenter Häuser vorwirft – „lack of support<br />
for changes in the domestic sexual division of labour“ – ist ihr selbst auf <strong>einer</strong><br />
symbolischen Ebene anzulasten. Sie setzt in ihrer Studie die bestehen<strong>de</strong> gesellschaftliche<br />
Arbeitsteilung voraus und schreibt diese allerdings mit ihrer Zuweisung von<br />
Hausarbeit an Frauen fort, statt die hegemoniale Geschlechter-Technik-Verknüpfung<br />
<strong>kritisch</strong> zu rekonstruieren.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz weist Berg auf blin<strong>de</strong> Flecken bei <strong>de</strong>r Technologieentwicklung hin,<br />
die aus unreflektierten Selbstverständnissen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen und ihren Leitbil<strong>de</strong>rn<br />
resultieren. Der Wert ihrer Studie besteht darin, dass sie das, was Longino als<br />
„Hintergrundannahmen“ (Longino 1990) bei <strong>de</strong>r Entstehung und Produktion von<br />
Wissen und Technologien bezeichnet, am Beispiel intelligenter Häuser aufzeigt. Mit<br />
Bergs Untersuchung lässt sich <strong>einer</strong>seits argumentieren, dass die DesignerInnen<br />
178<br />
Zu dieser so genannten „I-Methodology“ vgl. auch die Ausführungen <strong>de</strong>s letzten Kapitels 3 sowie die<br />
<strong>de</strong>s nächsten Abschnitts 4.1.3.<br />
179<br />
Dass sich an <strong>de</strong>n Implementierungen „intelligenter Häuser“ in dieser Hinsicht seither wenig geän<strong>de</strong>rt<br />
hat, zeigen Harald Rohrachers Untersuchungen von NutzerInnen. Darunter fan<strong>de</strong>n sich vorwiegend<br />
technisch interessierte Männer. Ferner kritisierten die BewohnerInnen, dass traditionelle<br />
Haushaltstätigkeiten nicht genügend technisch unterstützt wür<strong>de</strong>n; vgl. Rohracher 2006, 249ff.<br />
180<br />
Geschlechterforscherinnen in <strong>de</strong>r Informatik bemühen sich seit langem darum, die Disziplin von <strong>de</strong>m<br />
verengten Bild zu befreien, dass dort ausschließlich technikzentrierte Vorgehensweisen und<br />
Programmierkompetenz gefragt seien; vgl. etwa Erb 1996, Maaß/ Wiesner 2006.<br />
124
Anfor<strong>de</strong>rungen und Bedürfnisse verschie<strong>de</strong>ner zukünftiger BewohnerInnen in die<br />
Entwicklung intelligenter Häuser einbeziehen sollten, ohne dabei wie<strong>de</strong>rum stereotyp<br />
geschlechtliche Festschreibungen (z.B. Frauen mit Hausfrauen gleichzusetzen) vorzunehmen.<br />
Dass nicht notwendigerweise Frauen und Kin<strong>de</strong>r befragt wer<strong>de</strong>n müssen, um<br />
eine fehlen<strong>de</strong> Unterstützung von Hausarbeit zu i<strong>de</strong>ntifizieren, son<strong>de</strong>rn primär solche<br />
Menschen, die an<strong>de</strong>re Selbstverständnisse haben als die Designer, zeigt<br />
beispielsweise eine Erhebung <strong>de</strong>r Fraunhofer-Gesellschaft zu <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen an<br />
einen Pflegeroboter. Dieser Studie zufolge wünschten sich Senioren Unterstützung bei<br />
<strong>de</strong>r Haushaltsführung, Seniorinnen dagegen bei <strong>de</strong>r Körperpflege (Schraudner 2006, 7,<br />
siehe auch Rainfurth 2006).<br />
Nimmt man Longinos Kritik ernst, so genügt es für eine <strong>kritisch</strong>e Reflexion <strong>de</strong>r<br />
Problem<strong>de</strong>finitionen, die <strong>einer</strong> Technologie zugrun<strong>de</strong> liegen, jedoch nicht, allein nach<br />
<strong>de</strong>n Zielgruppen und <strong>de</strong>n Lebenssituationen potentieller NutzerInnen zu fragen, für die<br />
<strong>de</strong>r Einsatz <strong>de</strong>r informatischen Produkte explizit gedacht o<strong>de</strong>r implizit vorausgesetzt ist.<br />
Vielmehr stellt sich zugleich die Frage, ob diese Technologie gesellschaftlich<br />
wünschenswert ist und welche (Um-)Orientierung <strong>de</strong>r technologischen Entwicklung<br />
sinnvoll o<strong>de</strong>r gar notwendig erscheint. Es gilt also die <strong>de</strong>m technischen Artefakt<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong> Problemstellung zu problematisieren. Wer wird von <strong>einer</strong> (neuen)<br />
Technologie profitieren? Wessen „Träume“ wer<strong>de</strong>n dabei erfüllt? Die implizit<br />
angestrebten Nutzungsoptionen lassen sich aus <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en Perspektive mit <strong>de</strong>n<br />
gegenwärtig relevanten gesellschaftlichen und globalen Problemen konfrontieren. Es<br />
wäre dann jeweils zu prüfen, inwiefern informationstechnologische Entwicklungen <strong>de</strong>n<br />
anstehen<strong>de</strong>n gesellschaftlichen Aufgaben gewachsen sind, ob sie anstreben, zu <strong>de</strong>ren<br />
Lösung beizutragen o<strong>de</strong>r auf „Nebenschauplätzen“ agieren und womöglich an an<strong>de</strong>rer<br />
Stelle neue Probleme evozieren. Dabei könnte sich im Fall intelligenter Häuser ergeben,<br />
dass in Richtung ressourcenschonen<strong>de</strong>r Energieversorgung (d.h. im Hinblick auf<br />
das gesellschaftliche Ziel <strong>de</strong>r Nachhaltigkeit) bereits Fortschritte gemacht wur<strong>de</strong>n, aber<br />
für das Erreichen <strong>de</strong>s Ziels <strong>de</strong>r Geschlechtergerechtigkeit, insbeson<strong>de</strong>re hinsichtlich<br />
<strong>de</strong>r Verteilung materieller Hausarbeitstätigkeiten, noch immer ein hoher Forschungsbedarf<br />
angezeigt ist. 181 Geschlechterforschung kann in diesem Prozess <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en<br />
Überprüfung <strong>einer</strong> zukünftigen Technologie – wie Bergs Analyse zeigt – als ein „Eye-<br />
Opener“ (Weller 2002) fungieren, <strong>de</strong>r Leerstellen in <strong>de</strong>r technischen Entwicklung<br />
ver<strong>de</strong>utlicht, die nicht nur entlang <strong>de</strong>r Geschlechterordnung verortet sind, son<strong>de</strong>rn auf<br />
Einschreibungen weiterer Differenzen in <strong>de</strong>r Technologie verweist.<br />
4.1.4. „I-Methodology“:„Configuring the user as everybody“ o<strong>de</strong>r Design für<br />
<strong>de</strong>n Entwickler?<br />
Eine dritte Variante von Studien zum Ausschluss von Frauen durch das spezifische<br />
Design <strong>de</strong>r Technologie argumentiert gleichfalls mit <strong>de</strong>r Ignoranz von vornehmlich<br />
Männern als Entscheidungsträger und Entwickler gegenüber <strong>de</strong>r An<strong>de</strong>rsartigkeit<br />
gewöhnlicher NutzerInnen, insbeson<strong>de</strong>re von Frauen. Dabei wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologie<br />
181 In diesem Kontext verdienen historische Studien zu Haushaltstechnologien Beachtung, <strong>de</strong>nen zufolge<br />
die Einführung unterstützen<strong>de</strong>r technischer Geräte (z.B. <strong>de</strong>r Waschmaschine) nicht dazu geführt hat, dass<br />
sich die für Haushaltstätigkeiten aufgewen<strong>de</strong>te Zeit statistisch verringert hat, son<strong>de</strong>rn sich vielmehr höhere<br />
Hygienestandards durchsetzten; vgl. etwa Schwartz Cowan 1983, 1985.<br />
125
eingeschriebene Barrieren nicht – wie im letzten Abschnitt – auf <strong>de</strong>r Ebene unreflektierter<br />
Problem<strong>de</strong>finitionen, die einen sozialen Ausschluss nach sich ziehen, thematisiert,<br />
son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>n Zugängen und Interaktionsverhalten <strong>de</strong>r NutzerInnen. So betont<br />
etwa Susanne Maaß: „GestalterInnen haben die Definitionsmacht darüber, was<br />
‚richtige’ und ‚falsche’ Eingaben bzw. Interpretationen von Ausgaben sind, und normieren<br />
damit die zulässigen Verhaltensweisen <strong>de</strong>r BenutzerInnen. Menschen, die ihr<br />
Verhalten nicht entsprechend ausrichten können, weil sie nicht über die vorausgesetzten<br />
Fähigkeiten, Fertigkeiten und kulturellen Gewohnheiten, über Erfahrungen,<br />
Zeit, Geduld und Motivation, über Geräte, Geld o<strong>de</strong>r soziale Netzwerke verfügen,<br />
können die Software nicht für ihren Zweck nutzen. Sie wer<strong>de</strong>n durch die Technikgestaltung<br />
ausgegrenzt“ (Maaß 2003, 216).<br />
Aus Untersuchungen wie <strong>de</strong>rjenigen Anne-Jorunn Bergs über intelligente Häuser<br />
lässt sich zwar schließen, dass die „I-Methodology“ häufig eine <strong>de</strong>r Ursachen <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring ist. Allerdings bleibt dabei offen, wie Annahmen <strong>de</strong>r EntwicklerInnen, dass<br />
NutzerInnen dieselben Interessen und Fähigkeiten hätten wie sie selbst, als<br />
Selbstverständnisse in die vielfältigen Entscheidungen über ein Artefakt und seine<br />
spezifische Gestalt einfließen und welche Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung dabei en<br />
<strong>de</strong>tail wirksam sind. Deshalb erscheinen aus <strong>einer</strong> analytischen Perspektive gera<strong>de</strong><br />
solche technologischen Artefakte von beson<strong>de</strong>rem Interesse, die mit <strong>de</strong>m Ziel<br />
größtmöglicher Inklusion verschie<strong>de</strong>nartiger NutzerInnen antreten – jedoch in dieser<br />
Absicht scheitern. Denn die Differenz zwischen <strong>de</strong>m Anspruch <strong>de</strong>s Einschlusses und<br />
<strong>de</strong>s Resultat <strong>de</strong>s Ausschlusses verspricht, diejenigen Mechanismen innerhalb <strong>de</strong>s<br />
Technikgestaltungsprozesses aufzu<strong>de</strong>cken, die bei <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte am Werke sind.<br />
Ein solches Fallbeispiel, das in <strong>de</strong>r feministischen Technikforschung gut dokumentiert<br />
wur<strong>de</strong>, ist die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte <strong>de</strong>r digitalen Stadt<br />
Amsterdam 182 (vgl. Rommes et al. 1999, Rommes 2000, 2002, Oudshoorn et al. 2004).<br />
Diese wur<strong>de</strong> Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre aufgebaut, um <strong>de</strong>n Amsterdamer BürgerInnen<br />
nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r US-amerikanischen „Freenets“ freien Zugang zu Informationen<br />
zu bieten und öffentliche politische Debatten über das Internet zu evozieren. Anhand<br />
umfangreicher ethnografischer Untersuchungen zeigen Rommes, van Oost und<br />
Oudshoorn auf, dass die EntwicklerInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen<br />
mit <strong>de</strong>r elektronischen Plattform zunächst das I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>r Stärkung <strong>de</strong>r Demokratie<br />
verban<strong>de</strong>n. Die digitale Stadt sollte ein Ort wer<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>m je<strong>de</strong> und je<strong>de</strong>r innerhalb<br />
eines nicht-hierarchischen Raumes kommunizieren kann. Der Slogan „Zugang für alle“<br />
(„XS4all“) stand nicht nur für die Hoffnung, dass die neue Technologie dazu beitragen<br />
könne, <strong>de</strong>mokratische Strukturen zu verbessern, son<strong>de</strong>rn zugleich für das bei <strong>de</strong>n<br />
DesignerInnen vorherrschen<strong>de</strong>, explizite NutzerInnenbild „je<strong>de</strong> und je<strong>de</strong>r“. Im Gegensatz<br />
zu <strong>de</strong>n Entwicklern intelligenter Häuser, <strong>de</strong>ren Vorstellungen von <strong>de</strong>n NutzerInnen<br />
– wie Berg dargelegt hatte – implizit waren, wur<strong>de</strong> die Inklusionsi<strong>de</strong>e von <strong>de</strong>n<br />
InitiatorInnen <strong>de</strong>r digitalen Stadt Amsterdam explizit vertreten. Anfangs bestand <strong>de</strong>r<br />
Anspruch darin, dass auch diejenigen, die noch keine Erfahrungen im Umgang mit<br />
Computern hatten an <strong>de</strong>r neuen Technologie teilhaben können sollten.<br />
182 <strong>de</strong> Digitale Stad (DDS).<br />
126
Die empirischen Untersuchungen <strong>de</strong>s Entwicklungsprozesses <strong>de</strong>r digitalen Stadt<br />
Amsterdam zeigten allerdings, dass und vor allem wie dieses Ziel <strong>de</strong>r Nutzungsfreundlichkeit<br />
durch die „I-Methodology“ unterlaufen wur<strong>de</strong>. So wur<strong>de</strong> beispielsweise die<br />
Metapher <strong>de</strong>r Stadt, auf <strong>de</strong>r die Benutzungsoberfläche basierte und die eine leichte Bedienbarkeit<br />
för<strong>de</strong>rn sollte, von <strong>de</strong>n GestalterInnen weniger konsequent umgesetzt als<br />
mit <strong>de</strong>r US-amerikanischen Software intendiert. Zwar ist bei <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Interface<br />
eine technische Sprache vermie<strong>de</strong>n und sind fast alle Begriffe ins Nie<strong>de</strong>rländische<br />
übersetzt wor<strong>de</strong>n, jedoch blieb die Tastensteuerung dabei aus Zeitgrün<strong>de</strong>n sprachlich<br />
unverän<strong>de</strong>rt. Noch schwerwiegen<strong>de</strong>re Konsequenzen hatte es, dass das Entwicklungsteam<br />
das System um sechs weitere, zuvor nicht vorgesehene Softwarepakete<br />
ergänzte. Diese funktional-technische Erweiterung machte die Bedienung <strong>de</strong>r<br />
Benutzungsoberfläche viel komplexer als die <strong>de</strong>r ursprünglichen Software, da die<br />
Tasten in <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Teilprogrammen nun unterschiedliche Funktionen hatten.<br />
Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> implizit erwartet, dass die NutzerInnen selbst ihren Weg durch die<br />
digitale Stadt fän<strong>de</strong>n und im Zweifelsfall eine „trial and error“-Strategie anwen<strong>de</strong>ten,<br />
<strong>de</strong>nn das Hilfemenü erschien erst nach vier Schritten auf <strong>de</strong>r Bildschirmoberfläche.<br />
Dieses Design setzte voraus, dass die NutzerInnen bereits wussten, wie Menüs und<br />
Baumstrukturen funktionieren, so dass auf diese Weise die Zielgruppe <strong>de</strong>r wenig o<strong>de</strong>r<br />
gar nicht erfahrenen NutzerInnen ten<strong>de</strong>nziell ausgegrenzt wur<strong>de</strong>.<br />
Oudshoorn, Rommes und Stienstra ver<strong>de</strong>utlichen, dass die angeführten Designentscheidungen<br />
auf <strong>de</strong>r I-Methodology basieren – „a <strong>de</strong>sign practice in which <strong>de</strong>signers<br />
consi<strong>de</strong>r themselves as representative of the user“ (ebd., 41). So habe etwa <strong>de</strong>r Autor<br />
<strong>de</strong>s Handbuchs seine eigenen Erfahrungen zugrun<strong>de</strong> gelegt: „I have <strong>de</strong>cribed how I<br />
learned it myself“ (ebd., 42). Ebenso wür<strong>de</strong> die Strategie <strong>de</strong>s „trial and error“ <strong>de</strong>n<br />
Lernstil <strong>de</strong>r EntwicklerInnen wi<strong>de</strong>rspiegeln. Dieser Stil sei jedoch unter Frauen seltener<br />
anzutreffen als unter Männern. Insofern sei <strong>de</strong>m System ein „gen<strong>de</strong>r bias“ eingeschrieben.<br />
Neben diesen Verschiebungen auf <strong>de</strong>r Technikgestaltungsebene, die von<br />
<strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>s Zugangs für alle wegführten, wur<strong>de</strong>n die in Bibliotheken, in<br />
Seniorenhäusern, im Rathaus, in Museen und an<strong>de</strong>rnorts aufgestellten öffentlichen<br />
Terminals ab Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre wie<strong>de</strong>r abgebaut (Oudshorn et al. 2004, 40). 183<br />
Gleichzeitig wur<strong>de</strong> das System auf eine grafische Benutzungsoberfläche umgestellt,<br />
die eine umfangreiche technische Ausstattung auf <strong>de</strong>m zu dieser Zeit neuesten Stand<br />
<strong>de</strong>r Technik erfor<strong>de</strong>rte, 184 welche nur wenige private NutzerInnen besaßen. Damit<br />
bewirkte <strong>de</strong>r Abbau öffentlicher Zugänge einen weiteren, <strong>de</strong>r Absicht eines „Design für<br />
alle“ entgegen gesetzten Ausschluss von NutzerInnen, insbeson<strong>de</strong>re von Frauen.<br />
Darüber hinaus verfolgten, wie die Autorinnenherausarbeiteten, auch die politischen<br />
Entscheidungsträger und InitiatorInnen <strong>de</strong>r digitalen Stadt Amsterdam ab Mitte <strong>de</strong>r<br />
1990er Jahre neue Ziele. Statt nutzungsfreundlich sollte das System primär innovativ<br />
sein und zum Trendsetter für an<strong>de</strong>re digitale Städte wer<strong>de</strong>n. Verschiebungen auf <strong>de</strong>r<br />
Mikroebene <strong>de</strong>r Technikgestaltung gingen somit einher mit Verschiebungen auf <strong>de</strong>r<br />
183 Als Begründung für die Beseitigung <strong>de</strong>r Terminals wur<strong>de</strong>n nicht nur ökonomische Grün<strong>de</strong> angegeben<br />
(z.B. die hohen Wartungskosten) o<strong>de</strong>r dass nicht die neueste, innovativste Technologie repräsentiert sei,<br />
son<strong>de</strong>rn vor allem, dass das Aufstellen an <strong>de</strong>n öffentlichen Plätzen unerwünschte NutzerInnen anzog:<br />
„‚They sat there for hours without or<strong>de</strong>ring anything‘; ‚they gave a tramp-image‘; and ‚they ma<strong>de</strong> the<br />
surroundings look ‚untidy‘“ (Oudshoorn et al. 2004, 40).<br />
184 Gebraucht wur<strong>de</strong>n eine bestimmte Software, ein genügend schneller Rechner, ein Farbmonitor und ein<br />
schnelles Mo<strong>de</strong>m.<br />
127
Makroebene politischer Entscheidungen, die allesamt das Ziel <strong>de</strong>s Zugangs für alle<br />
unterminierten.<br />
Oudshoorn et al. (2004) vergleichen die digitale Stadt Amsterdam mit <strong>de</strong>r kommerziellen<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r virtuellen Stadt New Topia, die in etwa zeitgleich bei <strong>de</strong>r Firma<br />
Philips entstand. New Topia basierte bewusst auf <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren Technologie als <strong>de</strong>m<br />
Computer und Mo<strong>de</strong>m, um Assoziationen mit <strong>einer</strong> jungen, männerdominierten<br />
Hackerszene und damit Ausschlüsse zu vermei<strong>de</strong>n. Die Nutzung erfor<strong>de</strong>rte nur einen<br />
Fernseher und Telefon, d.h. Geräte, die so gut wie alle Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>rInnen besaßen.<br />
Jedoch berücksichtigten die EntwicklerInnen dabei nicht, dass für die Anwendung<br />
letztendlich auf die Technologie <strong>de</strong>s Teletexts zurückgegriffen wur<strong>de</strong>, die weitaus<br />
seltener von Frauen und älteren Menschen genutzt wur<strong>de</strong> als von verschie<strong>de</strong>nen<br />
Gruppen von Männern und <strong>de</strong>shalb einen strukturellen Ausschluss markierte. Damit<br />
konnten Oudshoorn et al. (2004) auch hier eine nicht intendierte Ausgrenzung auf <strong>de</strong>r<br />
Ebene <strong>de</strong>r benötigten Hardware nachweisen.<br />
Ein weiterer Unterschied zum Gestaltungsprozess <strong>de</strong>r digitalen Stadt Amsterdam<br />
bestand darin, dass die EntwicklerInnen von New Topia Tests mit NutzerInnen durchführten,<br />
zunächst nur mit MitarbeiterInnen <strong>de</strong>r eigenen Firma, nach <strong>de</strong>r Genehmigung<br />
als Patent auch mit einem breiteren Spektrum an Fernsehzuschauern. Dabei wur<strong>de</strong><br />
primär das technische Funktionieren überprüft. Erst ein dritter umfangreicher Usability-<br />
Test <strong>de</strong>s Prototypen zeigte schließlich, dass die von <strong>de</strong>n GestalterInnen intendierte<br />
Zielgruppe nicht <strong>de</strong>njenigen entsprach, die sich von <strong>de</strong>r Technologie angesprochen<br />
fühlten. Denn New Topia wur<strong>de</strong> diesen Testergebnissen zufolge primär von Männern<br />
genutzt, insbeson<strong>de</strong>re von weniger gebil<strong>de</strong>ten, 18- bis 35-jährigen Singles, die keinen<br />
eigenen Computer besaßen. Ferner zeigten Interviews, dass speziell Hausfrauen und<br />
RentnerInnen kein Interesse an <strong>de</strong>n Unterhaltungsangeboten und Spielen hatten,<br />
son<strong>de</strong>rn sich Informationen wünschten, z.B. über regionale Veranstaltungen. Daraufhin<br />
wur<strong>de</strong>n durch das Projektteam neue Zielgruppen <strong>de</strong>finiert, die mit an<strong>de</strong>ren, zu<br />
integrieren<strong>de</strong>n Informationsangeboten angesprochen wer<strong>de</strong>n sollten: Hausfrauen,<br />
RentnerInnen und Arbeitslose. Grundlegen<strong>de</strong>re Verän<strong>de</strong>rungen im Design, die aus<br />
<strong>de</strong>m letzten Test abgeleitet wer<strong>de</strong>n konnten, fan<strong>de</strong>n zu diesem Zeitpunkt, da <strong>de</strong>r<br />
Prototyp bereits fest stand, jedoch nicht mehr statt. 185<br />
In ihrer Zusammenschau <strong>de</strong>uteten die bei<strong>de</strong>n Fallstudien darauf hin, dass „configuring<br />
the user as everybody is an ina<strong>de</strong>quate strategy to account for the diversity of<br />
users. Both case studies show how <strong>de</strong>signers failed to operationalize this user<br />
representation into more specific <strong>de</strong>sign requirements. Our reconstructions of the<br />
<strong>de</strong>sign practices of the DDS and New Topia show a huge gap between the objective to<br />
<strong>de</strong>sign for everybody and the actual strategies, which did not adjust for differences in<br />
interest and skills among users. Due to this lack of differentiation and the use of the Imethodology,<br />
the virtual cities were <strong>de</strong>signed not for everybody but primarily for men”<br />
(ebd., 54).<br />
185 Aufgrund <strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>s dritten Tests sollten zunächst auch junge Mädchen als Zielgruppe aufgenommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Teenager erschienen jedoch letztendlich aus ökonomischen Interessen uninteressant,<br />
dass die Nutzung hohen Telefonkosten verursachte, die die jungen Mädchen nicht aufzubringen<br />
vermögen.<br />
128
Aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>s Vorhabens <strong>kritisch</strong>er bzw. feministischer Technikgestaltung<br />
zeigen die bei<strong>de</strong>n ethnografischen Fallstudien, dass es nicht genügt, ausschließlich ein<br />
breites Spektrum von NutzerInnen bei <strong>de</strong>r Problem<strong>de</strong>finition <strong>einer</strong> Technologie anzustreben,<br />
wie Bergs Studie intelligenter Häuser vermuten ließe. Selbst wenn die<br />
Zielvorstellung darin besteht, dass eine Technologie „von je<strong>de</strong>r und je<strong>de</strong>m“ genutzt<br />
wer<strong>de</strong>n können soll, manifestieren sich häufig soziale Ausschlüsse im Laufe <strong>de</strong>s<br />
technischen Gestaltungsprozesses – sei es, dass an<strong>de</strong>re politische Interessen in <strong>de</strong>n<br />
Vor<strong>de</strong>rgrund treten und sich durchsetzen (z.B. Innovation), bestimmte implizite<br />
Annahmen über die Hardware <strong>de</strong>n Zugang zur Technologie beschränken (z.B. Teletext<br />
o<strong>de</strong>r Computer mit grafischer Benutzungsoberfläche) o<strong>de</strong>r die „I-Methodology“ bei<br />
bestimmten Designentscheidungen so stark durchschlägt, dass die inkludieren<strong>de</strong><br />
Absicht unterlaufen wird. 186 Das be<strong>de</strong>utet, dass auf je<strong>de</strong>r Stufe <strong>de</strong>s Designs von Technologie<br />
eine gesellschafts<strong>kritisch</strong>e und geschlechtertheoretische Analyse notwendig<br />
ist, wenn es darum gehen soll, Technologien einschließend zu gestalten. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
das letzte Fallbeispiel <strong>de</strong>r kommerziellen virtuellen Stadt New Topia <strong>de</strong>utet darauf hin,<br />
dass Tests mit NutzerInnen ein erster Schritt sein können, um nicht intendierte<br />
Ausschlüsse von NutzerInnen zu i<strong>de</strong>ntifizieren, zumin<strong>de</strong>st wenn diese Tests früh im<br />
Entwicklungsprozess durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Diese Erkenntnis erscheint nützlich und<br />
spricht für <strong>de</strong>n grundlegen<strong>de</strong>n Ansatz <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit, Metho<strong>de</strong>n für<br />
einefeministische Technikgestaltung zu entwickeln, die im nächsten Kapitel vorgestellt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz ist <strong>de</strong>r Zugang von Rommes, Oudshoorn und Stienstra zugleich<br />
<strong>einer</strong> geschlechtertheoretisch <strong>kritisch</strong>en Analyse zu unterziehen, die auf Verkürzungen<br />
verweist. Die Autorinnen verorten sich in <strong>de</strong>r feministischen konstruktivistischen Technikforschung.<br />
187 Damit unterschei<strong>de</strong>t sich ihr Vorgehen <strong>de</strong>utlich von <strong>de</strong>m zur Essentialisierung<br />
von Geschlecht neigen<strong>de</strong>n Ansatz, „geschlechtsspezifische“ Vorlieben in <strong>de</strong>r<br />
Nutzung von Technologien anzunehmen und damit Zweigeschlechtlichkeit zu reproduzieren,<br />
<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Abschnitten 4.1.1. und 4.1.2. vorgestellt wur<strong>de</strong>. Ebenso vermei<strong>de</strong>n<br />
sie die unzulässige Gleichsetzung von Frauen mit Hausfrauen, zu <strong>de</strong>r Bergs Analyse<br />
im vorangegangen Abschnitt 4.1.3. tendiert. Um das anhand <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n virtuellen Städte<br />
beobachtete Design und die diesem zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Entscheidungen als<br />
„männliche“ charakterisieren zu können, führen sie dieses jedoch direkt auf die<br />
Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen zurück: „Since the project teams of<br />
New Topia and DDS consisted mainly of men, and the few women involved in the<br />
<strong>de</strong>sign of the DDS largely adopted a masculine <strong>de</strong>sign style, the interests and<br />
competencies inscribed in the <strong>de</strong>sign were predominantly masculine. The fact that the<br />
DDS and New Topia failed to attract the audience they inten<strong>de</strong>d to reach must<br />
therefore also be un<strong>de</strong>rstood in terms of the gen<strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntity of the <strong>de</strong>signers.“ (Oudshoorn<br />
et al. 2004, 53). Dieses Argument birgt – wie Catharina Landström (2007) betont<br />
– eine „analytische Asymmetrie“. Die Schlussfolgerung, dass die Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>r Designer die beschriebenen Effekte produziert, erscheint inkonsistent, wenn die<br />
Autorinnen behaupten, dass sich die Frauen einen „männlichen Gestaltungsstil“ angeeignet<br />
hätten. Denn die „männliche“ Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität wird dabei als ein stabiler<br />
186 Auch die Annahmen über die Hardware lassen sich als „I-Methodology“ <strong>de</strong>uten, wird doch von <strong>de</strong>n<br />
Designern angenommen, dass NutzerInnen dieselbe neueste Hardware besitzen wie sie selbst.<br />
187 Vgl. Kapitel 2.1.<br />
129
Faktor unterstellt, <strong>de</strong>r die Kraft besäße, das Design <strong>de</strong>r Technologie zu bestimmen. Die<br />
„weiblichen“ Ingenieurinnen verfügten <strong>de</strong>mgegenüber nicht über eine gleich starke<br />
Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität, da sie sich an die erfor<strong>de</strong>rliche Männlichkeit anpassten, während<br />
die „weibliche“ Position <strong>de</strong>r Nicht-NutzerInnen wie<strong>de</strong>rum durch ihre Geschlechteri<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>terminiert sei. So betrachtet läuft <strong>de</strong>r ansonsten produktive Ansatz von<br />
Rommes, Oudshoorn und Stienstra Gefahr, Geschlecht entlang traditioneller Achsen<br />
<strong>de</strong>s Geschlechter-Technik-Verhältnisses als gegeben anzunehmen. Wenn diese Kategorie<br />
jedoch als ein unverän<strong>de</strong>rliches Element vorausgesetzt wird, kann sie nur als<br />
Ursache <strong>de</strong>r Gestalt sozial konstruierter Technologie fungieren. Demgegenüber reklamiert<br />
Landström eine „doppelt konstruktivistische Analyse“, die <strong>de</strong>n Blick darauf zu<br />
lenken vermag, dass in <strong>de</strong>m Prozess <strong>de</strong>r Konstruktion von Technologie und von<br />
NutzerInnenbil<strong>de</strong>rn auch das Geschlecht <strong>de</strong>r IngenieurInnen mit hergestellt wird. „This<br />
is something Oudshoorn, Rommes and Stienstra hint at in their observations of female<br />
software <strong>de</strong>signers, who do things in the same way as their male colleagues do, but it<br />
does not influence their conclusion. To address this they would have to approach<br />
gen<strong>de</strong>r not as an i<strong>de</strong>ntity trait that comes from the individual and <strong>de</strong>termines their<br />
relationship with others, but as something emerging in the processes in which people<br />
and technology enmeshed“ (Landström 2007, 10).<br />
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Studien, die mit <strong>de</strong>m Ausschluss bestimmter<br />
NutzerInnen durch das Design von Technologien argumentieren, wertvolle Hinweise<br />
darauf geben, wie Technologiegestaltungsprozesse organisatorisch, methodisch und<br />
theoretisch so ausgerichtet wer<strong>de</strong>n können, dass sie eine größere Vielfalt von Menschen<br />
ansprechen. Dabei wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass für <strong>de</strong>n Nachweis <strong>de</strong>r Ausgrenzung<br />
sorgfältige empirische Studien notwendig ist, das nachvollziehbar macht, warum<br />
gewisse NutzerInnen strukturell ausgegrenzt wer<strong>de</strong>n. Solche Begründungen lieferte<br />
beispielsweise die Studie zu <strong>de</strong>n digitalen Städten, um aufzuzeigen, dass <strong>de</strong>r Zugang<br />
von Ressourcen (z.B. Hardware) abhängt, über die nicht alle Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>rInnen zu <strong>de</strong>r<br />
betrachteten Zeit verfügten, insbeson<strong>de</strong>re nicht die weiblichen. Sobald die Studien<br />
jedoch versuchen, einen durchaus kritikwürdigen Ausgrenzungsprozess als Ausschluss<br />
„von Frauen“ zu begrün<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r auf einem „männlichen Design“ beruht, greifen<br />
sie auf fest gefügte Geschlechtsi<strong>de</strong>ntitäten von NutzerInnen und von TechnologiegestalterInnen<br />
zurück – eine Festschreibung, die aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Gen<strong>de</strong>r<br />
Studies äußerst problematisch ist, da ein einheitliches, feststehen<strong>de</strong>s Subjekt<br />
angenommen wird. Während die Konstruktion abstrakter Vorlieben und Interessen von<br />
Frauen bereits auf <strong>de</strong>n ersten Blick als unzulässige Setzung aufgezeigt wer<strong>de</strong>n kann<br />
und auch die Reduktion von Frauen auf Hausfrauen zweifelhaft erscheint, ver<strong>de</strong>utlichen<br />
die differenzierteren Studien aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r feministischen<br />
Technikforschung, wie schwierig es ist, eine konstruktivistische Perspektive konsequent<br />
beizubehalten. Um <strong>de</strong>m Argument <strong>de</strong>s Ausschlusses Nachdruck zu verleihen,<br />
tendieren sie dazu, in Technologie inkorporierte Ungerechtigkeit auf eine abstrakte<br />
Basis von feststehen<strong>de</strong>r, einheitlicher Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität zu grün<strong>de</strong>n und Geschlechterdifferenz<br />
dort herzustellen, wo es gar nicht notwendig ist. Die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Ko-Produktion<br />
von Technik und Geschlecht ernst zu nehmen, wür<strong>de</strong> dagegen be<strong>de</strong>uten, <strong>de</strong>n<br />
unterstellten Ursache-Wirkungszusammenhang umzukehren. Nicht die Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität<br />
<strong>de</strong>r Designer wäre dann verantwortlich für das „männliche Design“ <strong>de</strong>r<br />
Technologie. Vielmehr stellten die TechnologiegestalterInnen auch ihre eigene<br />
130
Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität während <strong>de</strong>s Technologiegestaltungsprozesses ständig erneut<br />
her. Dabei kann es zu Bestätigungen <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n Geschlechter-Technik-Ordnung<br />
kommen, aber auch zu Brüchen und Verschiebungen, die es differenziert zu untersuchen<br />
gilt. Der Ansatz <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht, <strong>de</strong>r im<br />
letzten Kapitel theoretisch dargelegt wur<strong>de</strong>, ruft dazu auf, <strong>de</strong>r Versuchung zu<br />
wi<strong>de</strong>rstehen, das politisch gerechtfertigte Argument <strong>de</strong>s Ausschlusses mit fest<br />
gefügten binären geschlechtlichen I<strong>de</strong>ntitäten von Subjekten und Objekten zu<br />
begrün<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien als<br />
einen Prozess <strong>de</strong>r gleichzeitigen und gegenseitigen Konstitution <strong>de</strong>r beteiligten<br />
Subjekte (DesignerInnen und NutzerInnen) und Objekte (informatische Artefakte) zu<br />
begreifen.<br />
.<br />
4.2. Digitale Materialisierung strukturell-symbolischer Ungleichheit:<br />
geschlechtlich markierte Arbeitsplätze, Kompetenzen und Körper<br />
Neben <strong>de</strong>m Ausschluss von Frauen als NutzerInnen besteht eine zweite Form <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Technologie in <strong>de</strong>r Einschreibung Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong>r Kompetenzen und geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung in<br />
informatische Artefakte. Während die im letzten Abschnitt 4.1. betrachteten Studien<br />
kritisierten, dass Frauen zugeschriebene Vorlieben und Fähigkeiten sowie die<br />
beschränkte Verfügbarkeit von Ressourcen in Bezug auf <strong>de</strong>n Umgang mit <strong>de</strong>m<br />
Computer im Design <strong>de</strong>r Technologie nicht berücksichtigt wur<strong>de</strong>n, wird im Folgen<strong>de</strong>n<br />
die Fort- und Festschreibung bestehen<strong>de</strong>r Ungleichheitsstrukturen im Erwerbsleben via<br />
Technologie in <strong>de</strong>n Blick genommen. Dabei beschränke ich mich auf die Ansätze,<br />
welche die technische Unterstützung so genannter „Frauenarbeitsplätze“ analysieren.<br />
In<strong>de</strong>m Erwerbstätigkeiten im Mittelpunkt stehen, die vorwiegend von Frauen ausgeübt<br />
wer<strong>de</strong>n, rekurriert dieser Abschnitt weniger auf vermeintliche Merkmale von Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität<br />
(bzw. Fragen <strong>de</strong>r Konstitution <strong>de</strong>r Subjekte), son<strong>de</strong>rn fokussiert auf<br />
die strukturellen Dimensionen <strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse.<br />
Studien, die auf dieser Ebene Gen<strong>de</strong>ringprozesse nachweisen, stehen in <strong>einer</strong><br />
langen Tradition. Bereits En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1970er Jahre, als Personalcomputer zunehmend an<br />
Arbeitsplätzen Einzug hielten, fingen gesellschafts<strong>kritisch</strong> orientierte SozialwissenschaftlerInnen<br />
an, Zusammenhänge zwischen Klassengegensätzen und neuen Technologien<br />
zu untersuchen. Es wur<strong>de</strong> befürchtet, dass die Einführung von Computern im<br />
Rahmen kapitalistischer Produktionsverhältnisse dazu beitragen wür<strong>de</strong>, Arbeit zu fragmentieren,<br />
Löhne zu drücken und eine stärkere Kontrolle über die Beschäftigten zu<br />
erhalten. Vertreterinnen <strong>de</strong>s sozialistischen Feminismus wiesen darauf hin, dass im<br />
Zuge dieser Entwicklungen insbeson<strong>de</strong>re die Arbeit von Frauen betroffen war. Sie argumentierten,<br />
dass durch die neuen Technologien „geschlechtsspezifische“ Arbeitsteilung<br />
hergestellt und zementiert wür<strong>de</strong>. Insbeson<strong>de</strong>re in Bezug auf die Büroarbeit wur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Verdacht geäußert, dass die traditionelle Segregation von Schreibarbeit und Sachbearbeitung<br />
auf die computergestützte Textproduktion übertragen wer<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Arbeitsplätze<br />
wegrationalisiert wür<strong>de</strong>n.<br />
131
Die organisatorische Neustrukturierung von Arbeitsprozessen im Zuge <strong>de</strong>r Einführung<br />
von Computer- und Informationssystemen ist in <strong>de</strong>r Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r<br />
Informatik, die auf die Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte fokussiert, <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r am<br />
umfangreichsten untersuchten Bereiche. 188 In <strong>de</strong>n 1980er und 1990er Jahren stand<br />
dabei nicht nur die Büroarbeit im Mittelpunkt (vgl. u.a. Webster 1993, 1995, 1996, Winker<br />
1995, Clement 1991, 1993, Vehviläinen 1991) son<strong>de</strong>rn auch die Tätigkeiten von<br />
Krankenschwestern (vgl. u.a. Wagner 1989, 1991, 1993, Feldberg 1993, Gregory<br />
2000) 189 und Bibliotheksangestellten (vgl. etwa Green et al. 1993b). Denn diese Berufe<br />
wer<strong>de</strong>n nicht nur vorwiegend von Frauen ausgeübt, son<strong>de</strong>rn weisen Merkmale typischer<br />
„Frauenarbeit“ auf: Während Schreibarbeit aufgrund ihrer Monotonie und Routine<br />
als „weiblich“ gilt, wer<strong>de</strong>n Pflegeberufe aufgrund <strong>de</strong>s Charakters, für an<strong>de</strong>re Sorge zu<br />
tragen (care), stark mit „Weiblichkeit“ assoziiert. Demgegenüber sind Bibliothekstätigkeiten<br />
Dienstleistungen, die weitgehend hinter <strong>de</strong>n Kulissen ablaufen und aufgrund<br />
<strong>de</strong>ssen als typische „Frauenarbeit“ betrachtet wer<strong>de</strong>n. 190<br />
Ausgangspunkt <strong>de</strong>r frühen feministischen Studien war die Frage, welchen Einfluss<br />
<strong>de</strong>r Einsatz von Computern auf die Erwerbsarbeit in frauentypischen Tätigkeitsbereichen<br />
hat. Diese gingen zunächst von technikpessimistischen bzw. entfremdungstheoretisch<br />
geprägten Erwartungshaltungen aus. Bei <strong>de</strong>r Entwicklung von Krankenhausinformationssystemen<br />
etwa bestand das <strong>kritisch</strong>e Argument darin, dass Krankenschwestern<br />
durch die Einführung von IT von ihrer eigentlichen Aufgabe, <strong>de</strong>r Pflege<br />
<strong>de</strong>r Kranken, abgehalten wür<strong>de</strong>n. Dieses nahm Bezug auf die Aussagen <strong>de</strong>s Pflegepersonals,<br />
das die eigene Tätigkeit primär als Sorge um die PatientInnen <strong>de</strong>finierte, die<br />
einen ständigen direkten Kontakt erfor<strong>de</strong>rte (vgl. Wilson 2002). Aus <strong>einer</strong> konstruktivistischen<br />
Geschlechter- und Technikforschungsperspektive erscheinen diese Aussagen<br />
jedoch fragwürdig, nicht nur, weil sie dazu neigen, von Krankenschwestern als<br />
<strong>einer</strong> homogenen Gruppe von Frauen auszugehen. In<strong>de</strong>m sie einen Dualismus von<br />
zwischenmenschlicher Interaktion und <strong>de</strong>r Interaktion mit <strong>de</strong>r Maschine herstellen, <strong>de</strong>r<br />
geschlechtlich markiert ist, laufen sie vielmehr Gefahr die dichotome Geschlechterkonstruktion<br />
zu reproduzieren, welche das hegemoniale Geschlechter-Technik-Verhältnis<br />
aufrechterhält: nämlich die Annahme, dass Frauen (in diesem Fall Krankenschwestern)<br />
mit Menschen und nicht mit Maschinen arbeiteten. 191<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r Büroarbeit war die Ausgangssituation – und damit die Argumentation<br />
– etwas an<strong>de</strong>rs gelagert. Dort bestand in <strong>de</strong>n 1980er Jahren die Befürchtung primär<br />
darin, dass die vorwiegend von Frauen geleistete Schreibtätigkeit durch die Computerisierung<br />
<strong>de</strong>qualifiziert, standardisiert und in eine monotone Fließbandarbeit umstrukturiert<br />
wür<strong>de</strong>. „Word processing, it was argued, was a mechanism for the introduction<br />
of Taylorism into the office and as such, would be associated with the <strong>de</strong>gradation,<br />
188 Darauf verweisen unter an<strong>de</strong>rem die Namen <strong>de</strong>r internationalen Konferenzen: „Women, Work, and<br />
Computerization“ (seit 1984), aber auch <strong>de</strong>r Fachgruppe „Frauenarbeit und Informatik“ <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />
Gesellschaft für Informatik e.V. (seit 1987).<br />
189 In Deutschland haben vor allem Christiane Floyd, Anita Krabbel, Sabine Ratuski und Ingrid Wetzel<br />
umfangreiche Studien über Krankenhausinformationssysteme durchgeführt; vgl. etwa Floyd et al. 1997.<br />
Allerdings war ihr Ansatz stärker durch evolutionäre Systementwicklungsmetho<strong>de</strong>n als durch eine<br />
Geschlechterperspektive motiviert.<br />
190 Dabei ist die symbolische Ebene geschlechtlicher Zuschreibungen schwer von <strong>de</strong>r strukturellen zu<br />
trennen, nach <strong>de</strong>r diese Berufe tatsächlich fast nur von Frauen ausgeübt wer<strong>de</strong>n und sie zugleich<br />
benachteiligt wer<strong>de</strong>n.<br />
191 Vgl. hierzu auch die Kritik an <strong>de</strong>r Herstellung stereotyper Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität durch die Studien selbst,<br />
die im letzten Abschnitt 4.1. diskutiert wur<strong>de</strong>.<br />
132
<strong>de</strong>skilling and intensification of office work.“ (Webster 1993, 115). Eine dritte Kritik<br />
richtete sich dagegen, dass durch die Einführung von Software Arbeitsplätze überflüssig<br />
wür<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re die von Frauen.<br />
Untersuchungen aus <strong>de</strong>r feministischen (Technik-)Soziologie fokussierten somit in<br />
<strong>de</strong>n 1980er und frühen 1990er Jahren primär auf die Auswirkungen <strong>de</strong>s Computereinsatzes<br />
auf die Arbeit und das Leben von Frauen. Diese Orientierung tendiert jedoch<br />
zu technik<strong>de</strong>terministischen Positionen, <strong>de</strong>nen zufolge das Technische das Soziale<br />
bestimmt. Sie versteht Frauen als Opfer, somit wird Geschlecht letztendlich essentialisiert.<br />
Kritische InformatikerInnen dagegen strebten eher danach, Technologien so<br />
zu gestalten, dass sie bestehen<strong>de</strong>n hierarchischen und vergeschlechtlichten Ungleichheitsstrukturen<br />
in <strong>de</strong>n von ihnen betrachteten Bereichen entgegenwirken. Sie saßen<br />
damit häufig <strong>de</strong>nselben Annahmen auf, <strong>de</strong>m Technik<strong>de</strong>terminismus wie <strong>de</strong>m binären<br />
Geschlechteressentialismus, nur dass diese nun positiv gesellschaftsverän<strong>de</strong>rnd<br />
gewen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n. Studien, welche im Gegensatz zu diesen bei<strong>de</strong>n Linien Einschreibungen<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung in Informationstechnologien sorgfältig<br />
empirisch nachweisen, ohne bei <strong>de</strong>r verallgem<strong>einer</strong>n<strong>de</strong>n Analyse <strong>de</strong>r Folgen für<br />
Frauen stehen zu bleiben o<strong>de</strong>r sofort auf eine alternative Technikgestaltung zu zielen,<br />
sind relativ rar. In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Abschnitten arbeite ich aus <strong>de</strong>m vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Material <strong>informatischer</strong> und techniksoziologischer Fallstudien heraus, auf welche<br />
Weise die hegemoniale geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung in informationstechnologischen<br />
Artefakten repräsentiert ist und welche Aspekte sich dabei unterschei<strong>de</strong>n<br />
lassen. Ich i<strong>de</strong>ntifiziere zunächst drei 192 verschie<strong>de</strong>ne Facetten dieses Gen<strong>de</strong>ring, die<br />
ich ausführlicher diskutieren wer<strong>de</strong>:<br />
1. die ambivalente Konfigurierung von NutzerInnen durch Software als Frauen (4.2.1.)<br />
2. die Einschreibung bestehen<strong>de</strong>r geschlechtlich kodierter Strukturen und<br />
Hierarchieverhältnisse in Informationstechnologien (bspw. die Festschreibung <strong>de</strong>r<br />
Hierarchie zwischen ÄrztInnen und Krankenschwestern) (4.2.2.) und<br />
3. das Ausblen<strong>de</strong>n so genannter unsichtbarer Arbeit aus <strong>de</strong>r informatischen<br />
Mo<strong>de</strong>llierung (4.2.3)<br />
4. In einem vierten Abschnitt über neuere Studien zur Dienstleistungsökonomie,<br />
insbeson<strong>de</strong>re zum Einsatz von Informationstechnologien in Callcentern (4.2.4.), lege<br />
ich dar, dass diese Erkenntnisse <strong>de</strong>r feministischen Technikforschung zur geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung noch immer höchst aktuell sind.<br />
5. Der fünfte Abschnitt (4.2.5.) greift die Repräsentation vergeschlechtlichter Körper auf<br />
<strong>de</strong>n Bildschirmoberflächen auf, die aufgrund verbesserter Grafik und Animation möglich<br />
gewor<strong>de</strong>n sind und bisher vor allem kultur- und medienwissenschaftlich diskutiert<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
192 Eine weitere Ebene <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte besteht in <strong>de</strong>r Hierarchisierung <strong>de</strong>s<br />
Wissens, das in Informationssysteme eingeschrieben ist. So gelten beispielsweise die Diagnosen von<br />
ÄrztInnen mehr als die <strong>de</strong>r KrankenpflegerInnen, obwohl letztere <strong>de</strong>n direkten Kontakt zu <strong>de</strong>n PatientInnen<br />
und Erfahrungen im Umgang mit diesen haben. Dieses Ungleichheitsverhältnis bil<strong>de</strong>t sich oft auch in<br />
Krankenhausinformationssystemen ab. Die Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>s Wissens im Krankenhaus trägt zwar<br />
zur geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n Arbeitsteilung bei, es wird hier jedoch allgem<strong>einer</strong> unter <strong>de</strong>r dritten<br />
Kategorie <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte, <strong>de</strong>r epistemologische Voraussetzungen <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llierung und Strukturierungen von Wissen, verhan<strong>de</strong>lt.<br />
133
4.2.1. Die ambivalente Konfigurierung von NutzerInnen als Frauen<br />
Die erste Ebene <strong>de</strong>r Einschreibung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung und<br />
Kompetenzen knüpft an die im letzten Abschnitt diskutierten impliziten Vorstellungen<br />
<strong>de</strong>r DesignerInnen über die NutzerInnen an. Eine mangeln<strong>de</strong> Klarheit und eine<br />
fehlen<strong>de</strong> experimentelle Überprüfung von Annahmen über <strong>de</strong>n AdressatInnenkreis<br />
eines Produktes kann jedoch nicht nur dazu führen, dass NutzerInnenbil<strong>de</strong>r in die<br />
Software eingeschrieben wer<strong>de</strong>n, die zum Ausschluss bestimmter potentieller NutzerInnen<br />
bspw. bestimmter Gruppen von Frauen beitragen, wie im letzten Abschnitt<br />
aufgezeigt wur<strong>de</strong>. Es wer<strong>de</strong>n dadurch häufig auch implizite Zuschreibungen<br />
geschlechtsstereotyper Fähigkeiten und Qualifikationen sowie stillschweigen<strong>de</strong> Festschreibungen<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung vorgenommen.<br />
Jeanette Hofmann (1997, 1999) hat in <strong>einer</strong> historischen Studie aufgezeigt, in<br />
welchem Ausmaß unreflektierte Annahmen über zukünftige NutzerInnen, ihr<br />
Geschlecht und ihre (technischen) Kompetenzen die Designentscheidungen von<br />
Technologen bestimmen. Sie untersuchte dazu drei Textverarbeitungssysteme, welche<br />
die Entwicklung von Benutzungsoberflächen als Schnittstellen zwischen Mensch und<br />
Computer seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1970er Jahre wi<strong>de</strong>rspiegeln. Anhand von Interviews sowie<br />
Originaldokumenten rekonstruierte sie die jeweiligen Vorstellungen <strong>de</strong>r SoftwareentwicklerInnen<br />
von ihren Adressaten. Sie legt damit die <strong>de</strong>r Gestaltung von Textverarbeitung<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n impliziten NutzerInnenbil<strong>de</strong>r offen.<br />
Hofmann betrachtet als erstes Beispiel menügesteuerte Textautomaten (<strong>de</strong>n IBM-<br />
Displaywriter von 1980 bzw. 1984 und <strong>de</strong>n Wang WPS von 1976 bzw. Wang Writer<br />
von 1981), die sie als „eine Art Zwitterprodukt aus Schreibmaschine und Computer“<br />
(Hofmann 1997, 75) beschreibt. Maschine und Programm stellen dabei eine fest<br />
verdrahtete Einheit dar. Die Tätigkeit <strong>de</strong>s Schreibens ist im Textautomaten als eine<br />
Abfolge von Auswahlprozeduren simuliert, organisiert nach <strong>de</strong>m „verb-noun approach“.<br />
Die Schreibkraft hatte zunächst aus <strong>de</strong>m Menü auszuwählen, was sie mit <strong>de</strong>m Text zu<br />
tun beabsichtigt (verb), um daran anschließend <strong>de</strong>n betreffen<strong>de</strong>n Textkörper (noun) zu<br />
bestimmen. 193 In diese Sequenzen waren zusätzliche Menüs, Abfragen und<br />
Auffor<strong>de</strong>rungen eingebaut, die sich <strong>de</strong>r gemachten Angaben vergewissern und<br />
systembedingte Pausen erzeugen. Da Textautomaten <strong>de</strong>n NutzerInnen eine strikt<br />
sequentielle und hierarchische Handlungsabfolge abverlangten, die nicht durchbrochen<br />
o<strong>de</strong>r umgangen wer<strong>de</strong>n konnten, galten diese Systeme für AnfängerInnen als<br />
beson<strong>de</strong>rs gut geeignet. „We wanted to make something for the really dummy user<br />
who doesn’t have any i<strong>de</strong>a of the technology“ (nach Hofmann 1999, 227) beschreibt<br />
<strong>de</strong>r damalige leiten<strong>de</strong> Systemgestalter bei Wang die <strong>de</strong>r Entwicklung zugrun<strong>de</strong><br />
liegen<strong>de</strong> Intention.<br />
Nicht nur je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>nkbare Bedienungsfehler war ausgeschlossen, einige <strong>de</strong>r<br />
untersuchten Systeme verwehrten <strong>de</strong>n Schreibkräften sogar <strong>de</strong>n Zugriff auf das eigene<br />
Produkt, in<strong>de</strong>m Texte zwar erstellt und editiert, jedoch nicht kopiert, umbenannt o<strong>de</strong>r<br />
gelöscht wer<strong>de</strong>n konnten. Der Ansatz führte vor <strong>de</strong>m Hintergrund damaliger Rechenkapazität<br />
nicht nur zu <strong>einer</strong> extremen Langsamkeit <strong>de</strong>s computergestützten<br />
193 Im Gegensatz dazu funktionieren die heutzutage gängigen Textverarbeitungssysteme nach <strong>de</strong>m „nounverb“-Prinzip,<br />
bei <strong>de</strong>m zunächst <strong>de</strong>r Textabschnitt ausgewählt wird, um dann entschei<strong>de</strong>n zu können,<br />
welcher „Befehl“ auf diesen angewandt wer<strong>de</strong>n soll.<br />
134
Schreibens, son<strong>de</strong>rn hielt die NutzerInnen dauerhaft „dumm“: „Die imaginierte<br />
Adressatin <strong>de</strong>s Textautomaten erweist sich als ewige Anfängerin, <strong>de</strong>ren technische<br />
Kompetenz so gering erschien, dass durch unproduktives Schreiben entstehen<strong>de</strong><br />
Kosten niedriger veranschlagt wur<strong>de</strong>n als jene durch mögliches Fehlverhalten“<br />
(Hofmann 1997, 78).<br />
Wür<strong>de</strong> allein dieses Fallbeispiel herangezogen, so läge eine ein<strong>de</strong>utige Folgerung<br />
auf <strong>de</strong>r Hand: Softwareentwickler reproduzieren und verstärken sogar die bestehen<strong>de</strong><br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung durch konkrete Gestalt <strong>de</strong>r IT, in diesem Fall<br />
die Funktionalität <strong>de</strong>r Technologie und das User-Interface-Design. Denn Geschlecht<br />
wird durch die menügesteuerten Textautomaten gleich in einem doppelten Sinne strukturell<br />
hergestellt. Einerseits dadurch, dass als Frauen angenommene Schreibkräfte<br />
aufgrund <strong>de</strong>r „Idiotensicherheit“ <strong>de</strong>s Programms als technologisch inkompetent<br />
unterstellt wer<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>rerseits wer<strong>de</strong>n sie zugleich in <strong>de</strong>r betrieblichen Hierarchie<br />
niedrig gehalten, in<strong>de</strong>m sie keine Entscheidungsbefugnis über das Produkt ihrer<br />
Tätigkeit erhalten und Möglichkeiten <strong>de</strong>s Lernens und <strong>de</strong>r technischen Weiterbildung<br />
ausgeschlossen sind.<br />
Demgegenüber kommt im zweiten Fallbeispiel, Textverarbeitungsprogrammen mit<br />
Tastatursteuerung (WordStar von 1978 und WordPerfect von 1979), ein ganz an<strong>de</strong>res<br />
Bild von Frauen als Schreibkräften zum Ausdruck. Denn es wird ihnen dort die<br />
Fähigkeit „blind“ tippen zu können unterstellt und zugleich für die Simulation <strong>de</strong>s<br />
Schreibens genutzt. In<strong>de</strong>m die Editierfunktionen wie auch das Wechseln zwischen<br />
Schreib- und Editiermodus durch Kombinationen von Buchstaben- und Steuerungstasten<br />
realisiert waren, konnten die Schreibkräfte ihre Hän<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Tastatur belassen<br />
und brauchten ihren Schreibfluss nur geringfügig zu unterbrechen. Auf Gedächtnishilfen<br />
wie Menüs wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Programms ebenso verzichtet wie auf<br />
langwierige Frage-Antwort-Dialoge. Vorkehrungen gegen mögliche „Dummheiten“ <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen beschränkten sich im Wesentlichen auf ein Design, bei <strong>de</strong>m häufig<br />
genutzte Funktionen durch einfache, folgenreiche Aktionen dagegen wie das Löschen<br />
durch eher schwere Erreichbarkeit <strong>de</strong>r Tastenkombinationen realisiert waren.<br />
Gegenüber Fehlbedienungen wur<strong>de</strong>n hier also keine beson<strong>de</strong>ren Präventionen<br />
getroffen.<br />
Daraus lässt sich ablesen, dass die Schreibkräfte <strong>de</strong>n EntwicklerInnen nicht – wie<br />
im Fall <strong>de</strong>r Textautomaten – als technisch min<strong>de</strong>rbemittelt galten, son<strong>de</strong>rn als qualifiziert<br />
und eigenständig. Das Programm stellte aufgrund <strong>de</strong>r komplexen Programmsyntax<br />
und s<strong>einer</strong> teils wenig eingängigen Kodierung von Funktionalitäten hohe Erwartungen<br />
an die Lernbereitschaft <strong>de</strong>r NutzerInnen. Die Bedienung war eher an <strong>de</strong>rjenigen<br />
von ProgrammiererInnen orientiert, wie sich einem Interview mit <strong>de</strong>m Informatiker van<br />
Dam entnehmen lässt: „Once you memorize the key combinations – people on ‚VI‘ or<br />
‚Emacs‘ 194 are good at theat – it can go much faster than experienced [operators<br />
working on] word processors“ (nach Hofmann 1999, 232). Als NutzerInnen wur<strong>de</strong>n<br />
professionelle Typistinnen angenommen, <strong>de</strong>ren Haupttätigkeit zuvor im Maschinenschreiben<br />
bestand. Das Nutzerbild ist das <strong>einer</strong> „technischen Expertin“.<br />
194 Der VI (Visual Interface) und Emacs sind frühe Texteditoren, die primär von Unix- und Linux-Nutzer-<br />
Innen und ProgrammiererInnen gebraucht wur<strong>de</strong>n. Charakteristisch ist, dass sie in verschie<strong>de</strong>nen Modi<br />
funktionieren, <strong>de</strong>r VI hat beispielsweise einen Befehls-, einen Einfügemodus und einen Kommandozeilenmodus.<br />
135
Die Studie zeigt, dass auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s gleichen Adressatinnenkreises, hier<br />
<strong>de</strong>r Gruppe von Frauen als Schreibkräfte, stark differieren<strong>de</strong> Softwareentwürfe<br />
entstehen können. Die Unterschie<strong>de</strong> lassen sich vor allem an Kompetenzen, welche<br />
die EntwicklerInnen <strong>de</strong>r Zielgruppe zuschreiben, und an <strong>de</strong>n Vorsichtsmaßnahmen<br />
gegenüber möglichen Fehlbedienungen ablesen. Im ersten Fall wer<strong>de</strong>n die User als<br />
als Frauen „konfiguriert“, 195 <strong>de</strong>nn die Umsetzung <strong>de</strong>r Interpretation dieses Nutzerbil<strong>de</strong>s<br />
strukturiert und beschränkt ihre Handlungsoptionen im Sinne hegemonialer<br />
Geschlechterkonstruktionen. Im zweiten Fall wird die Verknüpfung von technischer<br />
Inkompetenz und „Weiblichkeit“ aufgebrochen. Dem Design liegt implizit die Annahme<br />
zugrun<strong>de</strong>, dass die als Schreibkräfte tätigen Frauen einen ähnlichen Umgang mit <strong>de</strong>m<br />
Computer hätten, wie die als Programmierer tätigen Männer. Die <strong>de</strong>r Software eingeschriebenen<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n NutzerInnenbil<strong>de</strong>r, die <strong>de</strong>n Individuen beson<strong>de</strong>re<br />
Kompetenzen zu- o<strong>de</strong>r abschreiben, variieren somit stark. Auf <strong>einer</strong> strukturellen<br />
Ebene betrachtet, bleibt das zweigeschlechtlich differenzierte Konzept <strong>de</strong>r Schreibarbeit<br />
jedoch auch bei <strong>de</strong>m zweiten Fallbeispiel erhalten. „The traditional division of<br />
labour within writing, which separates the process of composing text from that of<br />
typing, became the mo<strong>de</strong>l for the <strong>de</strong>sign of word processing software.“ (Hofmann 1999,<br />
224). Sowohl die menügesteuerten Textautomaten wie die tastaturgesteuerte Textverarbeitung<br />
setzen voraus, dass die Schreibkräfte ausschließlich tippen, während <strong>de</strong>r<br />
kreative Akt <strong>de</strong>s Schreibens <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Hierarchie höher stehen<strong>de</strong>n WissensarbeiterInnen,<br />
zumeist Männern überlassen bleibt. Hofmann führt allerdings ein weiteres<br />
Beispiel an, bei <strong>de</strong>r auch diese Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung technischer Artefakte<br />
aufgeweicht wird.<br />
Die dritte von ihr untersuchte Textverarbeitungssoftware (<strong>de</strong>r Xerox Star Computer<br />
von 1981) basiert auf <strong>einer</strong> grafischen Benutzungsoberfläche. 196 Im Vergleich zu <strong>de</strong>n<br />
stark strukturieren<strong>de</strong>n Menüs und <strong>de</strong>r Tastatursteuerung <strong>de</strong>r vorangegangenen<br />
Beispiele wer<strong>de</strong>n hier die als wesentlich betrachteten Funktionen <strong>de</strong>r Textproduktion<br />
durch bildhaften Symbole (Icons) dargestellt. Die Entwickler beschränkten das<br />
Ausdrucksvermögen auf wenige Operationen wie „move“, „copy“, „<strong>de</strong>lete“, und „again“,<br />
<strong>de</strong>ren grafische Darstellung ein geringes Erinnerungsvermögen von Seiten <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen erfor<strong>de</strong>rt. Komplexere Funktionen wie das Suchen/Ersetzen, die im tastaturgesteuerten<br />
Programm zur Verfügung stan<strong>de</strong>n, waren hier nicht vorgesehen. Denn<br />
die Zielgruppe <strong>de</strong>s Programms waren „Manager“ und Wissensarbeiter, die we<strong>de</strong>r über<br />
eine eigene Sekretärin verfügten noch Zeit hätten und Willens wären, die Eigenheiten<br />
komplizierter Betriebssysteme o<strong>de</strong>r Textverarbeitungsprogramme zu studieren (vgl.<br />
Hofmann 1997, 89). „Star’s <strong>de</strong>signers assumed that the target users were interested in<br />
getting their work done and not at all interested in computers. Another important<br />
assumption was that Star’s users would be casual, occasional users rather than people<br />
who spent most of their time at the machine. This assumption led to the goal of having<br />
Star easy to learn and remember“ (Johnson 1989, 11, nach Hofmann 1999, 236)<br />
195<br />
Das Verständnis, dass NutzerInnen konfiguriert wer<strong>de</strong>n, geht auf Woolgar 1991b zurück. Vgl. hierzu<br />
genauer die Ausführungen in Kapitel 3.7.<br />
196<br />
Der Star Computer, von <strong>de</strong>m hier die Re<strong>de</strong> ist, wur<strong>de</strong> bereits 1981 von Xerox auf <strong>de</strong>n Markt gebracht.<br />
Er war <strong>de</strong>r erste kommerzielle Rechner, <strong>de</strong>r zur Bedienung die sogenannte „direkte Manipulation“ nutzte.<br />
Dieses Konzept <strong>de</strong>r Benutzungsoberflächen wur<strong>de</strong> von Apple und Windows übernommen und ist bis<br />
heute gängig.<br />
136
Hofmann bezeichnet diese Zielgruppe als „Gelegenheitsschreiber“ bzw. als<br />
„Dilettanten“ (Hofmann 1999, 233).<br />
Während mit Hilfe <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n betrachteten Textverarbeitungsprogramme<br />
die vorgefun<strong>de</strong>ne, geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung von Denken und Tippen in<br />
<strong>de</strong>n Büros abgebil<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, setzte das Design <strong>de</strong>s Xerox Star Computers eine neue<br />
Konzeption <strong>de</strong>s Schreibens technisch um, die von Doug Engelbarts Vision inspiriert<br />
war, dass innovative Systeme „<strong>de</strong>signed for augmenting human intellectual capabilities“<br />
(Engelbart 1984, 1, nach Hofmann 1999, 237) sein sollten. Es ging nicht mehr nur<br />
um die routineförmige Erstellung und Bearbeitung von Texten, vielmehr sollte die<br />
Software nun primär kreative Tätigkeiten wie das Planen, Analysieren und Entwerfen<br />
unterstützen. Statt Automatisierung wur<strong>de</strong> versucht, die Augmentation (Erweiterung)<br />
zum neuen Leitbild <strong>de</strong>r Software- und Systementwicklung einzusetzen.<br />
Hofmanns Studie zu frühen Textverarbeitungssystemen zeigt insgesamt, dass die<br />
Kategorie Geschlecht auf die Gestaltung <strong>de</strong>r Benutzungsoberflächen einen stark<br />
entwicklungsleiten<strong>de</strong>n, zugleich jedoch wi<strong>de</strong>rsprüchlichen Einfluss hat. Denn zwei <strong>de</strong>r<br />
drei betrachteten Systeme brechen mit <strong>de</strong>r hegemonialen Gleichsetzung von Technikkompetenz<br />
mit Männlichkeit. Insgesamt jedoch spiegeln die Differenzen zwischen <strong>de</strong>n<br />
Textverarbeitungssystemen nicht nur verschie<strong>de</strong>ne, geschlechtlich konnotierte NutzerInnenbil<strong>de</strong>r<br />
wi<strong>de</strong>r, son<strong>de</strong>rn auch Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r prinzipiellen Konzeption und<br />
Organisation von Textverarbeitung. Während die ersten bei<strong>de</strong>n Fallbeispiele von <strong>de</strong>r<br />
zur dieser Zeit vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n Arbeitsteilung in <strong>de</strong>n<br />
Büros ausgingen und diese durch die erneute Mo<strong>de</strong>llierung verfestigten, setzte sich<br />
das dritte Fallbeispiel davon ab. Bemerkenswert ist, dass gera<strong>de</strong> letztere I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r<br />
grafischen Benutzungsoberflächen, die sich durchgesetzt hatte und bis heute<br />
dominiert, an als „männlich“ imaginierten Wissensarbeitern orientiert war. Die dieser<br />
Zielgruppe unterstellten Bedürfnisse und Fähigkeiten wur<strong>de</strong>n generalisiert, so dass ein<br />
icon-basiertes, nutzungsfreundliches User-Interface als geschlechtsneutral gilt.<br />
Insgesamt zeigt die Analyse Hofmanns zwei Vergeschlechtlichungsprozesse von<br />
Technologien auf. Die NutzerInnen können <strong>einer</strong>seits durch die Software als Frauen<br />
konfiguriert wer<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m die Bedienung entlang <strong>de</strong>r „Frauen“ zugeschriebenen Kompetenzen<br />
eingeschränkt wird. An<strong>de</strong>rerseits vermögen Technologien die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung fortzusetzen, in<strong>de</strong>m strukturelle Bedingungen (wie die<br />
Trennung und Hierarchisierung von Wissens- und Schreibarbeit) in die Software eingeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n. Die empirischen Untersuchungen weisen allerdings <strong>de</strong>utlich darauf<br />
hin, dass das Gen<strong>de</strong>ring in <strong>de</strong>r Zusammenschau betrachtet ambivalent und wi<strong>de</strong>rsprüchlich<br />
ist. Technologien bestätigen o<strong>de</strong>r durchbrechen die gesellschaftliche<br />
Arbeitsteilung, je nach<strong>de</strong>m, welche Artefakte und welcher Kontext betrachtet wer<strong>de</strong>n<br />
und ob <strong>de</strong>r Blick auf die Zuschreibung geschlechtlich markierter Kompetenzen o<strong>de</strong>r auf<br />
die strukturellen Ebenen <strong>de</strong>s Geschlechterverhältnisses gerichtet wird. Insofern ruft<br />
Hofmanns Untersuchung indirekt dazu auf, sorgfältige empirische Fallstudien durchzuführen<br />
statt etwa generalisiert davon auszugehen, dass Textverarbeitung im Büro zur<br />
Rationalisierung o<strong>de</strong>r Dequalifizierung von Frauen als Schreibkräfte führt. Ziel solcher<br />
Analysen wäre <strong>de</strong>mnach eine Differenzierung, Kontextualisierung und Situierung von<br />
Technologie.<br />
137
4.2.2. Festschreibung geschlechtlich kodierter Strukturen in und durch IT:<br />
Von „Shaping women’s work“ 197 zu Machtverhältnissen zwischen <strong>de</strong>n<br />
AkteurInnen<br />
Eine weitere Variante <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte ist in <strong>de</strong>r<br />
betrieblichen Organisation von Arbeit verortet und in <strong>de</strong>n kulturellen Vorstellungen, die<br />
mit <strong>de</strong>m Einsatz von Technologie verknüpft wer<strong>de</strong>n. Dies belegt die empirische Studie<br />
von Gabriele Winker (1995), die sich primär gegen die frühen, feministischen Argumente<br />
wen<strong>de</strong>te, dass <strong>de</strong>r Einsatz von Informationstechnologie in erster Linie zum<br />
Abbau von Arbeitsplätzen führen wür<strong>de</strong>. Winker zeigte anhand <strong>de</strong>r Untersuchung von<br />
Schreibarbeitsplätzen in <strong>de</strong>r Bremischen Verwaltung auf, dass die Rationalisierungseffekte<br />
<strong>de</strong>r Computerisierung aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive insgesamt differenziert<br />
zu beurteilen sind. Negativ bewertet wer<strong>de</strong>n müssten die Auswirkungen, die zu<br />
einem Wegfall von Arbeitsplätzen o<strong>de</strong>r gar ganzen Berufsgruppen durch Automatisierung<br />
führten. Davon seien jedoch diejenigen Entwicklungen zu unterschei<strong>de</strong>n,<br />
welche die Geschlechterhierarchie eher aufweichen, beispielsweise in<strong>de</strong>m sie Sekretärinnen<br />
Aufstiegschancen bieten o<strong>de</strong>r sie von <strong>de</strong>r Monotonie <strong>de</strong>r Schreibtätigkeit ein<br />
Stück weit entlasten.<br />
Im Bremer Fall sollte die Einführung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>zentralen Informationssystems aufgrund<br />
<strong>einer</strong> Dienstvereinbarung durch ein Konzept qualifizierter Mischarbeit begleitet wer<strong>de</strong>n.<br />
Diese Organisationsform be<strong>de</strong>utet, dass die SachbearbeiterInnen einen Teil <strong>de</strong>r<br />
Schreibarbeiten selbst übernehmen, während die Schreibkräfte über Technologie vermittelt<br />
die Möglichkeit erhielten, neben <strong>de</strong>m Schreiben auch an<strong>de</strong>re, qualifizierte<br />
Arbeiten (z.B. Sach- und Verwaltungstätigkeiten) auszuführen. Ziel dieser strukturellen<br />
Maßnahme war es <strong>einer</strong>seits, <strong>de</strong>n Abbau von Arbeitsplätzen, insbeson<strong>de</strong>re jener von<br />
Frauen zu verhin<strong>de</strong>rn. An<strong>de</strong>rerseits sollte <strong>de</strong>r hohen Gesundheitsbelastung durch<br />
Schreibarbeit entgegengewirkt wer<strong>de</strong>n, die sich aus <strong>de</strong>r spezifischen Merkmalen dieser<br />
Tätigkeit ergaben – <strong>de</strong>r starken Zerglie<strong>de</strong>rung von Arbeit, <strong>de</strong>r sich wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong>n<br />
Tätigkeiten, einförmigen Bewegungsabläufe, <strong>de</strong>r hohen Arbeitsgeschwindigkeit und<br />
wenig inhaltlicher Abwechslung bei hoher Konzentration. 198<br />
Winkers empirische Untersuchung zeigte jedoch, dass <strong>de</strong>r Plan qualifizierter Mischarbeit<br />
für die meisten Arbeitsplätze nicht umgesetzt wor<strong>de</strong>n ist. Die Tätigkeit <strong>de</strong>r<br />
Schreibarbeiterinnen bestand weiterhin maßgeblich darin, Texte für Dritte zu schreiben,<br />
nur das Arbeitsmittel än<strong>de</strong>rte sich. Winker beobachtete allerdings einen neuen<br />
Arbeitsstil in <strong>de</strong>r Interaktion mit <strong>de</strong>n Vorgesetzten, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>n Potentialen informationstechnischer<br />
Textverarbeitung ergab (z.B. die Möglichkeit nachträglicher und<br />
mehrfacher Än<strong>de</strong>rungen von Textentwürfen), welche letztendlich zu höheren Belastungen<br />
für die Schreibkräfte und neuen Anfor<strong>de</strong>rungen an die Gestaltung <strong>de</strong>r Texte<br />
führten. Immerhin gelang es, bei einem Viertel <strong>de</strong>r ehemaligen Schreibkräfte<br />
tatsächlich eine qualifizierte Mischarbeit umzusetzen. Einige stiegen sogar ganz in die<br />
Sachbearbeitung auf. Winker zeigte auf, dass die erfolgreiche Einführung <strong>de</strong>s arbeitsorganisatorischen<br />
Konzeptes im Zuge <strong>de</strong>s Technikeinsatzes auf zwei Voraussetzungen<br />
grün<strong>de</strong>te. Es wur<strong>de</strong> von einem hohen Rationalisierungspotential durch IT ausgegangen<br />
und zugleich angenommen, dass die SachbearbeiterInnen und Vorgesetzten<br />
197 So <strong>de</strong>r Titel <strong>einer</strong> Monografie von Juliet Webster 1996.<br />
198 Diese Merkmale gelten als Kennzeichen typischerweise Frauen zugeschriebener Arbeit.<br />
138
Texte zunehmend selbst am Computer schreiben. Dort, wo diese bei<strong>de</strong>n Bedingungen<br />
erfüllt waren, ist die von <strong>de</strong>r Verwaltung angestrebte Mischarbeit erfolgreich umgesetzt<br />
wor<strong>de</strong>n. Die Studie zeigt, dass <strong>de</strong>r Einsatz von IT an Arbeitsplätzen stets an eine<br />
Umstrukturierung von Arbeit gebun<strong>de</strong>n ist, durch die bestehen<strong>de</strong> schlechte Bedingungen<br />
für Frauen in diesen Tätigkeiten aufrechterhalten o<strong>de</strong>r verschärft wer<strong>de</strong>n können.<br />
Die strukturelle geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>mnach für viele<br />
Schreibkräfte zementiert, konnte aber auch für einige aufgrund gewerkschaftlicher<br />
Aushandlung aufgeweicht wer<strong>de</strong>n. Damit bestätigt Winkers Studie die Aussage Websters,<br />
dass die Büroarbeit vor und nach <strong>de</strong>m Computereinsatz hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
strukturellen Bedingungen starke Kontinuitäten aufweist: “[W]e have seen the<br />
continuation of different patterns of work organization which have been shaped less by<br />
purely technological influences, than by long-term management practices in particular<br />
firms, strategies of control of women’s work, national economic and local labour market<br />
conditions, and in this context, corporate objectives in introducing new technologies”<br />
(Webster 1993, 115f). Die Festschreibung bzw. das Unterlaufen geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung ließ sich diesen Beobachtungen zufolge stärker auf organisatorische<br />
Maßnahmen zurückführen als auf die Technologie und ihre Funktionalitäten.<br />
Insofern liegt hier keine Einschreibung von Geschlecht in informatische Artefakte im<br />
engeren Sinne vor.<br />
Der betrieblich-organisatorische Kontext und die jeweiligen gesellschaftlichen<br />
Zusammenhänge stehen jedoch häufig in enger Wechselwirkung mit <strong>de</strong>r spezifischen<br />
Gestaltung von Software. So zeigt etwa Ina Wagner (1989, 1991) anhand <strong>einer</strong><br />
umfangreichen internationalen Vergleichsstudie von Krankenhausinformationssystemen<br />
auf, wie stark Technologien von kulturell-organisatorischen Rahmenbedingungen<br />
geprägt sein können. Wagner arbeitet heraus, dass <strong>de</strong>n Krankenhausinformationssystemen<br />
län<strong>de</strong>rspezifisch jeweils sehr unterschiedliche Vorstellungen <strong>de</strong>r sozialen<br />
Organisation von Pflege und eingeschrieben sind. Während das von ihr untersuchte<br />
US-amerikanische Krankenhausinformationssystem auf Kostenminimierung und Rationalisierung<br />
ausgerichtet war und in s<strong>einer</strong> Architektur verschie<strong>de</strong>ne Funktionen und<br />
Akteursinteressen integrierte, zerfiel das französische in ein Patienteninformationssystem,<br />
ein Verwaltungssystem und ein Pflegeinformationssystem. Beson<strong>de</strong>rs das<br />
französische Pflegeinformationssystem ist hinsichtlich <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
von IT beachtenswert. Denn es diente primär dazu, die Belastungen<br />
<strong>de</strong>s (vorwiegend von Frauen gestellten) Pflegepersonals zu erfassen, um <strong>de</strong>n<br />
Stationen eigene Personalplanungen zu ermöglichen. Dabei waren die Pflegehandlungen,<br />
die elektronisch dokumentiert wer<strong>de</strong>n sollten, von <strong>de</strong>n NutzerInnen nicht – wie<br />
im US-amerikanischen System – im Einzelnen zu spezifizieren. Statt<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong> pro<br />
Krankheitstyp von <strong>einer</strong> fiktiven Arbeitsbelastung ausgegangen, die von <strong>de</strong>n PflegerInnen<br />
im Vorhinein gemeinsam ausgehan<strong>de</strong>lt wor<strong>de</strong>n ist. Dies hatte <strong>de</strong>n Effekt, dass in<br />
<strong>de</strong>r Zuordnung <strong>de</strong>r Pflegehandlungen durch das Pflegepersonal Spielräume<br />
zugelassen waren ebenso wie Ausnahmen von standardisierten Verfahren <strong>de</strong>r Pflege<br />
ermöglicht wur<strong>de</strong>n. Zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Untersuchung hatte allein das Stationspersonal<br />
Zugriff auf das Pflegeinformationssystem, doch soll die Verwaltung bereits <strong>de</strong>n Wunsch<br />
nach Datenzugang geäußert haben.<br />
Das französische System ist ein Beispiel dafür, dass Technologien <strong>de</strong>r betrieblichen<br />
und zweigeschlechtlich geprägten Hierarchie bis zu einem gewissen Grad entgegen-<br />
139
wirken können. Denn es unterstützt die Interessen <strong>de</strong>r Krankenschwestern, in<strong>de</strong>m es<br />
<strong>de</strong>ren hohe Arbeitsbelastung dokumentierte. In dieser Zielsetzung <strong>de</strong>s Systems<br />
spiegelte sich – Wagner zufolge – die politische Erfahrung vorangegangener Streiks<br />
<strong>de</strong>s Pflegepersonals wi<strong>de</strong>r (vgl. Wagner 1991, 285). Trotz<strong>de</strong>m ist es bemerkenswert,<br />
dass bestehen<strong>de</strong> strukturelle Verhältnisse in diesem Fall abgeschwächt wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re vor <strong>de</strong>m Hintergrund aktueller Maßnahmen <strong>de</strong>r Rationalisierung <strong>de</strong>s<br />
Gesundheitssystems erscheint es erstaunlich, dass sich die Krankenhausverwaltung<br />
nach Aushandlungsprozessen damit zufrie<strong>de</strong>n gab, dass sie ausschließlich zusammengefasste,<br />
<strong>de</strong>-individualisierte Daten erhalten wür<strong>de</strong>n (vgl. Wagner 1993, 299).<br />
Diese lokale Intransparenz ermöglichte <strong>de</strong>m Pflegepersonal ein relativ selbstverantwortliches,<br />
situiertes Han<strong>de</strong>ln im Umgang mit <strong>de</strong>n PatientInnen.<br />
Im Gegensatz dazu entspricht das US-amerikanische System stärker <strong>de</strong>n Erwartungen<br />
aus heutiger Perspektive. Dort wur<strong>de</strong>n die Handlungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Pflegen<strong>de</strong>n durch einen universell-normieren<strong>de</strong>n Katalog von Pflegedienstleistungen<br />
beschränkt. Kontingenz und Ambiguität im Umgang mit <strong>de</strong>n Kranken sollte mit Hilfe<br />
dieser Festschreibungen ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n. Auf diese Weise wur<strong>de</strong> auch die<br />
Position <strong>de</strong>r PatientInnen geschwächt, speziell <strong>de</strong>rer, <strong>de</strong>ren Krankheiten nicht „<strong>de</strong>r<br />
Norm entsprechen“. Der US-amerikanische Ansatz folgte <strong>de</strong>m Leitbild <strong>de</strong>r Effizienz.<br />
Ausgehend von <strong>de</strong>m Primat <strong>de</strong>r Kostenkontrolle und Rationalisierung 199 wur<strong>de</strong>n<br />
Managementkriterien festgeschrieben, die über <strong>de</strong>n Technologieeinsatz im Krankenhaus<br />
etabliert wer<strong>de</strong>n sollten.<br />
In <strong>de</strong>n technischen Produkten spiegelten sich neben <strong>de</strong>n Machtverhältnissen im<br />
Anwendungsfeld, <strong>de</strong>m Gesundheitssystem, zugleich die Machtverhältnisse <strong>de</strong>s<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Software-Entwicklungsprozesses, an <strong>de</strong>m – im Gegensatz zu <strong>de</strong>m<br />
französischen System – das Pflegepersonal nicht beteiligt wur<strong>de</strong>. Während im USamerikanischen<br />
System offenbar eine starke Krankenhausverwaltung im Hintergrund<br />
stand und die Software zu <strong>de</strong>ren Vorteil „top-down“ entwickelt wur<strong>de</strong>, fand in Frankreich<br />
ein technokratischer Schulterschluss zwischen PolitikerInnen, ÄrztInnen und <strong>de</strong>r<br />
Verwaltung statt, <strong>de</strong>r zu <strong>einer</strong> größeren Balance <strong>de</strong>r Akteursinteressen führte und<br />
zugleich <strong>de</strong>n Einsatz partizipativer Entwicklungsverfahren ermöglichte. Die Studie<br />
dokumentiert damit, dass <strong>de</strong>r methodische Zugang zur Softwareentwicklung beeinflusst,<br />
ob das Informationssystem die bestehen<strong>de</strong> geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung<br />
technisch fortsetzt o<strong>de</strong>r unterläuft. Wird ein System – wie im französischen Fall<br />
– partizipativ entwickelt, so besteht die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen wenigstens<br />
für einzelne Gruppen, die strukturell benachteiligt sind, zu verbessern. 200<br />
Wagners Studie ver<strong>de</strong>utlicht insgesamt, wie stark gesellschaftlich-soziale und<br />
organisatorische Rahmenbedingungen die Architektur, Entwicklung und Ausprägung<br />
<strong>de</strong>r technischen Artefakte bestimmen. Die Krankenhausinformationssysteme sind<br />
geprägt von <strong>de</strong>n Interessen <strong>de</strong>r AkteurInnen und ihrer jeweiligen Machtverhältnisse<br />
untereinan<strong>de</strong>r sowie von Annahmen über die Organisation von Arbeit, die innerhalb<br />
199 Ina Wagner verweist 1993 mit Feldbergs Studien darauf, dass eine Kostenkontrolle und -reduktion<br />
durch <strong>de</strong>n IT-Einsatz im Krankenhaus zwar ein starkes Bild darstellt, das allerdings nicht empirisch belegt<br />
wer<strong>de</strong>n konnte (Wagner 1993, 297).<br />
200 Es wird im folgen<strong>de</strong>n Kapitel 5 jedoch noch weiter zu diskutieren sein, ob eine Partizipation von Frauen<br />
als NutzerInnen am Systementwicklungsprozess für ein Aufbrechen Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>r<br />
und hierarchisieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung ausreicht bzw. welche Bedingungen dafür notwendig ist.<br />
140
<strong>de</strong>s jeweiligen nationalen Gesundheitssystems situiert sind. 201 Mit diesen Vorstellungen<br />
schreiben sich gesellschaftliche Strukturverhältnisse in die Artefakte ein, welche die<br />
weithin vorherrschen<strong>de</strong> geschlechterhierarchische Ordnung bestätigen o<strong>de</strong>r auch<br />
abschwächen können. Die län<strong>de</strong>rspezifischen Differenzen lassen sich in Bezug auf<br />
strukturell-symbolische Dimensionen von Geschlecht <strong>de</strong>uten. Das französische System<br />
gesteht <strong>de</strong>n KrankenpflegerInnen zwar eine im Vergleich zur Situation in <strong>de</strong>n USA<br />
autonome Stellung gegenüber <strong>de</strong>r Verwaltung zu. Doch än<strong>de</strong>rt dies nichts an <strong>de</strong>r<br />
geringen gesellschaftlichen Anerkennung und Bezahlung ihrer Tätigkeit. Diese<br />
Möglichkeit relativ selbstbestimmten Arbeitens ließe vermuten, dass damit zugleich<br />
eine Stärkung <strong>de</strong>r KrankenpflegerInnen in <strong>de</strong>m zweigeschlechtlich kodierten Verhältnis<br />
gegenüber <strong>de</strong>n ÄrztInnen verbun<strong>de</strong>n sei. In <strong>de</strong>m konkreten Fall relativierte sich diese<br />
Erwartung allerdings durch die Fragmentierung <strong>de</strong>s Systems. Da das Programm für die<br />
Pflegeleistungen wie auch das für die ÄrztInnen für <strong>de</strong>n lokalen Gebrauch bestimmt<br />
war, wur<strong>de</strong> die strukturell hohe Position von ÄrztInnen nicht in Frage gestellt. Das USamerikanische<br />
System setzt dagegen auf Transparenz, mit <strong>de</strong>r die Hoffnung verbun<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>, dass sie traditionelle Machtgefälle im Gesundheitswesen und darüber<br />
hinaus abschwächen könnte. „Wenn etwa das ärztliche Machtmonopol geschwächt,<br />
Entscheidungen sowie Allokation von Ressourcen durchsichtiger, Patientendaten in<br />
je<strong>de</strong>m Winkel <strong>de</strong>r Organisation transportiert und Pflegetätigkeiten ‚verwissenschaftlicht‘<br />
wer<strong>de</strong>n, so berührt dies nicht nur die im Krankenhaus Beschäftigten, son<strong>de</strong>rn alle, als<br />
potentielle Patienten und als engagierte Bürger“ (Wagner 1989, 275).<br />
Selbst wenn die konkreten Aussagen <strong>de</strong>r Studie heutzutage, knapp 20 Jahre später,<br />
sicherlich keine Gültigkeit mehr haben, legen die empirischen Analysen generell dar,<br />
dass die Krankenhausinformationssysteme unter an<strong>de</strong>ren gesellschaftlichen Bedingungen<br />
ganz an<strong>de</strong>rs hätten konstruiert wer<strong>de</strong>n können als diejenigen, die wir mittlerweile<br />
kennen. Vom heutigen Standpunkt aus ist jedoch festzustellen, dass die erhofften<br />
Strukturverän<strong>de</strong>rungen auch hinsichtlich <strong>de</strong>r zweigeschlechtlich kodierten Machtverhältnisse<br />
ausgeblieben sind und statt<strong>de</strong>ssen eine weitreichen<strong>de</strong> Ökonomisierung <strong>de</strong>s<br />
Gesundheitswesens unter neoliberalen Vorzeichen stattgefun<strong>de</strong>n hat.<br />
Das Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte und die Mechanismen, die in diesen<br />
Prozessen zum Tragen kommen, sind komplex, ebenso wie ihre Geschlechterimplikationen<br />
vielschichtig und ambivalent einzuschätzen sind. Die Vergleichsstudie<br />
über Krankenhausinformationssysteme zeigt, dass Aspekte <strong>de</strong>r in IT manifestierten<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n Arbeitsteilung in kulturell geprägten Vorstellungen <strong>de</strong>r<br />
involvierten Tätigkeiten, in <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Anerkennung <strong>de</strong>s Berufs, strukturellsymbolischen<br />
Machtverhältnissen unter <strong>de</strong>n AkteurInnen sowie in <strong>de</strong>r spezifischen<br />
Situation im untersuchten Betrieb liegen, die sich überlagern und verstärken o<strong>de</strong>r auch<br />
gegenseitig entlasten und damit entkräften können. Es kann nicht simpel davon<br />
ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass InformatikerInnen bestehen<strong>de</strong> Strukturen geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung stets nachbil<strong>de</strong>n und dieses Mo<strong>de</strong>ll in das Informations-<br />
201 Insofern sind diese Studien sind nicht – wie etwa Rammert et al. 1998, 10 verengt interpretieren – als<br />
reine Wirkungsforschung zu verstehen, welche die sozialen und organisatorischen Folgen <strong>de</strong>s Einsatzes<br />
von Informationssystemen, z.B. für die Schreibkräfte o<strong>de</strong>r Krankenpflegerinnen, einzuschätzen versucht.<br />
Vielmehr heben sie die Abhängigkeit technologischer Entwicklungen von ihrem sozialen Kontext hervor<br />
und verweisen damit auf die soziale Formung bzw. Konstruktion von Technologien.<br />
141
system hinein abbil<strong>de</strong>n. 202 In einem heterogenen Netzwerk von AkteurInnen ist<br />
Technologie nicht einfach Verstärker bereits existieren<strong>de</strong>r Verhältnisse. Strukturelle<br />
Instrumente <strong>de</strong>r Organisationsentwicklung (z.B. die Einführung von Mischarbeit) o<strong>de</strong>r<br />
partizipative Verfahren <strong>de</strong>r Softwareentwicklung (z.B. die Beteiligung von KrankenpflegerInnen)<br />
verweisen auf Strategien <strong>de</strong>r Intervention, die das Potential besitzen, <strong>de</strong>r<br />
Festschreibung von Ungleichheitsstrukturen durch Technologien entgegenzuwirken.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz bleibt zunächst festzuhalten, dass Strukturen geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung, die bereits vor <strong>de</strong>r Einführung von IT im Anwendungsfeld<br />
bestan<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r im Zuge <strong>de</strong>r Technikgestaltung re-etabliert wur<strong>de</strong>n, häufig erneut in<br />
informationstechnologische Artefakte eingeschrieben wer<strong>de</strong>n. Insofern wirken<br />
Technologien mit an <strong>de</strong>r Aufrechterhaltung struktureller Macht- und Hierarchieverhältnisse.<br />
Die Fallstudien ver<strong>de</strong>utlichen ferner, dass die Software, die im Erwerbsarbeitsbereich<br />
zur Unterstützung o<strong>de</strong>r Automatisierung von Tätigkeiten eingesetzt wird,<br />
neben hierarchischen Organisationsstrukturen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
auch auf Definitionen von Arbeit grün<strong>de</strong>t, welche diese normieren und festschreiben<br />
können. Die Bestimmung von Arbeit durch IT wird im folgen<strong>de</strong>n Abschnitt<br />
unter <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Perspektive ihrer Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit<br />
sowie <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen geschlechterbinären Konnotation beleuchtet. Damit wird<br />
eine dritte Variante <strong>de</strong>r Einschreibung Zweigeschlechlichkeit konstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung in Software aufgezeigt, zugleich aber auch weitere Optionen <strong>de</strong>r<br />
Intervention gegen die Festschreibung diskutiert.<br />
4.2.3. „Invisible Work “ und <strong>de</strong>r Versuch, „Frauenarbeit“ sichtbar zu machen<br />
„What counts as work is a matter of <strong>de</strong>finition“ (Star/ Strauss 1999, 9)<br />
Die Frage, was Arbeit ist, wie sie funktioniert und inwieweit sie sich formal beschreiben<br />
lässt, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Informatik thematisiert, seit <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n war, dass Arbeit<br />
durch die Produkte <strong>informatischer</strong> Tätigkeit wesentlich mitgestaltet wird (vgl. etwa Coy<br />
1992). Dabei zeigte sich relativ früh, dass die (explizite) informationstechnologische<br />
Mo<strong>de</strong>llierung ein tief gehen<strong>de</strong>s Verständnis erfor<strong>de</strong>rt, was an <strong>de</strong>n Arbeitsplätzen<br />
tatsächlich passiert und wie bestimmte Aufgaben unter z.T. komplexen Bedingungen<br />
konkret ausgeführt wer<strong>de</strong>n. Eine grundsätzliche Schwierigkeit, Arbeit, „so wie sie ist“<br />
o<strong>de</strong>r wie sie sein sollte, angemessen informationstechnologisch zu erfassen und zu<br />
mo<strong>de</strong>llieren, lässt sich darauf zurück führen, dass viele Tätigkeiten, die zum Funktionieren<br />
von Arbeit beitragen, ‚unsichtbar‘ sind. 203 Insbeson<strong>de</strong>re das Fachgebiet<br />
„Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW), <strong>de</strong>ssen Forschungen auf eine<br />
angemessene Unterstützung kooperativer Arbeitsformen gerichtet sind, beschäftigt<br />
sich mit <strong>de</strong>r Frage, inwieweit ‚unsichtbare Arbeit‘ i<strong>de</strong>ntifiziert, mo<strong>de</strong>lliert und damit<br />
sichtbar gemacht wer<strong>de</strong>n kann und soll. Aus dieser Perspektive fassen Bonnie Nardi<br />
202 In <strong>de</strong>r Wirtschaftsinformatik wird von Re-Organisationsprozessen gesprochen und damit vorausgesetzt,<br />
dass je<strong>de</strong> Technologieeinführung an Arbeitsplätzen die Abläufe und strukturellen Zusammenhänge dieser<br />
Tätigkeiten neu organisiert.<br />
203 Vor allem arbeitswissenschaftliche und soziologische Ergebnisse wiesen darauf hin, dass eine gute<br />
Kenntnis dieser ‚invisible work‘ notwendig ist, um Informationstechnologie so zu gestalten, dass sie<br />
Arbeitsprozesse unterstützt o<strong>de</strong>r automatisiert.<br />
142
und Yrjö Engeström die mit <strong>de</strong>m Phänomen <strong>de</strong>r ‚invisible work‘ verbun<strong>de</strong>ne<br />
Problematik zusammen: „Much work is visible. It yields to being mapped, flow charted,<br />
quantified, measured. When planning for restructuring or new technology, visible work<br />
is the focus of attention. […], so efforts to restructure center on how visible work can be<br />
manipulated, redrawn, reorganized, automated or supported with new technology. But<br />
a growing body of empirical evi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>monstrate that there is more to work than is<br />
captured in flow charts and conventional metrics“ (Nardi/ Engeström 1999, 1).<br />
Demnach sind nur gewisse Teilbereiche von Arbeit sichtbar und lassen sich mit Hilfe<br />
formaler Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Informatik erfassen. An<strong>de</strong>re Tätigkeiten, die oft gera<strong>de</strong> wesentlich<br />
zu einem „reibungslosen“ Ablauf beitragen, sind dagegen innerhalb <strong>de</strong>r Organisation<br />
kaum wahrnehmbar. „[T]he better the work is done, the less visible is it to those<br />
who benefit from it.“ (Suchman 1995, 58) beschreibt Suchman dieses Phänomen.<br />
Hinzu kommt, dass die Aspekte unsichtbarer Arbeit oft nicht einmal von <strong>de</strong>n Beteiligten<br />
selbst formuliert wer<strong>de</strong>n können. Arbeit ist somit für unterschiedliche AkteurInnen als<br />
solche erkennbar – o<strong>de</strong>r nicht.<br />
Nardi und Engeström unterschei<strong>de</strong>n insgesamt vier Typen unsichtbarer Arbeit: 1.<br />
Arbeit, die an unsichtbaren Orten geleistet wird (z.B. die <strong>de</strong>r BibliothekarInnen), 2.<br />
Arbeit, die als Routine o<strong>de</strong>r manuelle Tätigkeit betrachtet wird, doch durchaus ein<br />
qualifiziertes Wissen und Problemlösungsfähigkeiten erfor<strong>de</strong>rt (z.B. die <strong>de</strong>r TelefonoperatorInnen),<br />
3. Arbeit, die von „unsichtbaren“ Menschen ausgeführt wird (etwa im<br />
Bereich persönlicher Dienstleistungen) und 4. informelle Arbeitsprozesse, die zwar<br />
nicht Teil <strong>einer</strong> formalen Stellenbeschreibung sind, wohl aber zum Funktionieren von<br />
Arbeit wesentlich sind (z.B. informelle Gespräche, Humor) (vgl. ebd.). 204 Diese<br />
Charakterisierung <strong>de</strong>utet darauf hin, dass unsichtbare Arbeit häufig Frauenarbeit ist.<br />
Zwei <strong>de</strong>r vier Kategorien wer<strong>de</strong>n durch einen typischen Frauenberuf veranschaulicht<br />
(Bibliothekarin, Telefonoperateurin), eine weitere rekurriert auf die Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong> Trennung von Produktions- und Reproduktionsarbeit, wobei letztere<br />
gering geschätzt und häufig als un(ter)bezahlte Frauenarbeit ausgeübt wird (so<br />
genannte Hausarbeit und private Pflege-/Dienstleistungen). Die vierte Kategorie ist auf<br />
<strong>einer</strong> symbolischen Ebene als „weiblich“ kodiert (Kommunikationsfähigkeit, „Klatsch“).<br />
GeschlechterforscherInnen verweisen seit langem darauf, dass häufig gera<strong>de</strong> diejenige<br />
Arbeit unsichtbar ist, die vorwiegend von Frauen geleistet o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m als „weiblich“<br />
angenommenen Rollenverhalten zugeschrieben wird (vgl. etwa Star 1991a, Suchman/<br />
Jordan 1989). Die Korrelation von Frauenarbeit und Unsichtbarkeit ist zwar nicht<br />
ungebrochen, beispielsweise gilt auch die als „männlich“ konnotierte Tätigkeit von<br />
TechnikerInnen als unsichtbar (vgl. Shapin 1989). Dennoch kann sie strukturell als ein<br />
Element geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Segregation <strong>de</strong>s Arbeitsmarktes und von Tätigkeiten<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>r Regel mit geringer Bezahlung, Anerkennung und<br />
Status verbun<strong>de</strong>n sind. Die Verschiebung <strong>de</strong>s analytischen Blickwinkels von <strong>de</strong>r<br />
204 Aus <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren, stärker theorieorientierten Perspektive unterschei<strong>de</strong>n Susan Leigh Star und Anselm<br />
Strauss drei Ebenen <strong>de</strong>s Verhältnisses von sichtbarer und unsichtbarer Arbeit: 1. creating a non-person<br />
(das Produkt <strong>de</strong>r Arbeit ist sichtbar, die Arbeiten<strong>de</strong>n dagegen nicht), 2. disembedding background work<br />
(die Arbeiten<strong>de</strong>n sind sichtbar, dagegen nicht ihre geleistete Arbeit) und 3. abstracting and manipulation of<br />
indicators (dabei sind bei<strong>de</strong>, die Arbeiten<strong>de</strong>n und ihre Arbeit, unsichtbar); vgl. Star/ Strauss 1999, 15ff. Es<br />
wür<strong>de</strong> hier jedoch über das Anliegen <strong>de</strong>r Systematisierung <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Informationstechnologien<br />
hinausführen, verschie<strong>de</strong>ne Klassifizierungen unsichtbarer Arbeit ausführlicher zu<br />
diskutieren.<br />
143
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n Arbeitsteilung zur unsichtbaren Arbeit birgt <strong>de</strong>n Vorteil,<br />
dass nicht bereits von Seiten <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong> gemeinten Untersuchung heraus a priori eine<br />
erneute Festschreibung von Geschlecht auf <strong>de</strong>r strukturellen Ebene vorgenommen<br />
wird. Dennoch verweist Susan Leigh Star letztendlich auf unsichtbare Frauenarbeit als<br />
Form <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Arbeitsteilung, wenn sie nach <strong>de</strong>r Repräsentation von<br />
Arbeit bei <strong>de</strong>r Entwicklung von Informationstechnologien fragt: „Whose work is it that<br />
gets represented? How formal can or should that work become in representation?<br />
What’s the role of behind-the-scenes and <strong>de</strong>valued labor in the manufacture of<br />
knowledge?“ (Star 1991a, 82). 205<br />
Suchman (1996) ging diesen Fragen anhand <strong>einer</strong> Fallstudie zum Einsatz eines<br />
Dokumentenmanagementsystems innerhalb <strong>einer</strong> großen Rechtsanwaltskanzlei nach.<br />
In dieser Firma fand sie eine klare geschlechterdifferenzieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung vor. Die<br />
RechtsanwältInnen waren vorwiegend Männer. Dagegen wur<strong>de</strong>n die für <strong>de</strong>n Einsatz<br />
<strong>de</strong>s Dokumentenmanagementsystems in <strong>de</strong>r Firma notwendigen Tätigkeiten, genannt<br />
‚litigation support‘, von Frauen durchgeführt. Deren Hauptaufgabe bestand in <strong>de</strong>r<br />
Erstellung eines Datenbankin<strong>de</strong>x, die <strong>de</strong>n Zugang zu <strong>einer</strong> großen Zahl von Dokumenten<br />
sicherstellte. Der systematische Zugang zu <strong>de</strong>n Rechtsfällen und die strukturierte<br />
Suche innerhalb <strong>de</strong>s Systems stellte zwar eine grundlegen<strong>de</strong> Voraussetzung für<br />
die Tätigkeit <strong>de</strong>r RechtsanwältInnen dar. Jedoch fand die Kodierung <strong>de</strong>r Daten für das<br />
System bei <strong>de</strong>n RechtsanwältInnen keine Anerkennung. Sie betrachteten diese als<br />
eine Routinetätigkeit, die keinen Verstand benötige. Der ‚litigation support‘ war<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Organisation unter <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong>n Machtverhältnissen unsichtbar,<br />
auch in <strong>de</strong>m Sinne, dass er in ein an<strong>de</strong>res Stockwerk <strong>de</strong>r Kanzlei ausgelagert war. Um<br />
Kosten zu sparen, schlugen die RechtsanwältInnen vor, diese Tätigkeiten zu automatisieren<br />
o<strong>de</strong>r an einen an<strong>de</strong>ren Standort zu verlagern.<br />
Tatsächlich trug die qualifizierte Kodierung <strong>de</strong>r Dokumente, wie Suchman mittels<br />
ethnografischer Verfahren herausarbeitete, wesentlich zum reibungslosen Funktionieren<br />
<strong>de</strong>r Rechtsanwaltskanzlei bei. Sie erfor<strong>de</strong>rte ein umfangreiches Wissen, fundierte<br />
Interpretationen, Urteilskraft und unabhängige Entscheidungen, um die jeweiligen<br />
Dokumente referenzieren und für die Suche in <strong>de</strong>r Datenbank geeignet verknüpfen zu<br />
können. Im Gegensatz zu ihrer mangeln<strong>de</strong>n Anerkennung in <strong>de</strong>r Firma stellte diese<br />
Tätigkeit also eine qualifizierte Form <strong>de</strong>r Wissensarbeit dar, die <strong>de</strong>r Soziologe Anselm<br />
Strauss als „Artikulationsarbeit“ (vgl. Strauss 1985, 1993) bezeichnet hat. 206 Suchman<br />
wirft damit die Frage auf, welche Deskriptionen <strong>de</strong>r betrachteten Arbeitsprozesse<br />
ArbeitswissenschaftllerInnen, TechnikforscherInnen und InformatikerInnen <strong>de</strong>r Firma<br />
liefern sollen und wie sie sich mit Hilfe dieser Beschreibungen innerhalb <strong>de</strong>r<br />
bestehen<strong>de</strong>n Macht- und Organisationsstrukturen verorten. So musste sich Suchman<br />
205 Sie gibt drei Grün<strong>de</strong> an, warum für diese Fragen für die Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
relevant sind: “Our knowledge and work have been ma<strong>de</strong> invisible in the public record, yet that ‚invisible<br />
work’ contributes to any venture; women have as a group <strong>de</strong>veloped a set of skills for juggling real-time<br />
work that escape formal representation but are essential to knowledge work; as ‘the Other’, we have had<br />
access to informal ways of knowing, including the simultaneous knowledge of being insi<strong>de</strong>rs and<br />
outsi<strong>de</strong>rs.” (Star 1991a, 81). Heutzutage lässt sich zwar aus feministisch-konstruktivistischer Perspektive<br />
nicht mehr so ungebrochen von <strong>einer</strong> homogenen Gruppe von Frauen sprechen, wie Star es hier tut.<br />
Dennoch sind die angesprochenen Problematiken <strong>de</strong>s Unsichtbarmachens von Frauenarbeit, ihrer<br />
formalen Repräsentierbarkeit und <strong>de</strong>r Potentiale von Grenzüberschreitungen zwischen Zugehörigkeit und<br />
Außenseitertum für die Wissensrepräsentation in Informationssystemen noch immer offen.<br />
206 Für weitere Arbeiten, Artikulationsarbeit in Technikgestaltungsprozessen zu unterstützen, vgl. Schmidt/<br />
Bannon 1992 sowie Suchman 1996.<br />
144
etwa entschei<strong>de</strong>n, ob sie auf die Seite <strong>de</strong>r beschäftigten Frauen stellen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />
Wunsch <strong>de</strong>r RechtsanwältInnen, die interne Abteilung <strong>de</strong>r Kanzlei abzubauen, folgen<br />
wollte.<br />
Suchman spricht an an<strong>de</strong>rer Stelle von <strong>einer</strong> „Politik <strong>de</strong>r Repräsentation“ (Suchman<br />
1995, 34), die mit je<strong>de</strong>r Systemgestaltung zur Unterstützung bzw. Automatisierung von<br />
Arbeit einhergeht. Denn dabei wird zwangsläufig eine spezifische Konstellation von<br />
sichtbarer und unsichtbarer Arbeit wie<strong>de</strong>rherstellt bzw. neu produziert. Ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<br />
Punkt dabei sei, wer die Definitionsmacht darüber besitzt o<strong>de</strong>r für sich in<br />
Anspruch nimmt, was als wertvolle Arbeit gilt und welche abgewertet wird. Wer<br />
bestimmt, welche Tätigkeiten gut bezahlt und welche als informelle Hintergrundarbeit<br />
abqualifiziert wer<strong>de</strong>n? Vor allem stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise diejenigen,<br />
die Arbeitsprozesse beobachten und mo<strong>de</strong>llieren, auf die strukturelle Entwicklung<br />
dieser Prozesse <strong>kritisch</strong> Einfluss nehmen können. Denn die Außenperspektive auf die<br />
untersuchte Organisation, die ArbeitswissenschaftllerInnen, TechnikforscherInnen und<br />
InformatikerInnen mitbringen, verspricht zunächst, in existieren<strong>de</strong>n Macht- und<br />
Geschlechterverhältnissen intervenieren und für die Betroffenen Partei ergreifen zu<br />
können.<br />
Suchman gelang es auf einfühlsame Weise, <strong>de</strong>n RechtsanwältInnen <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s<br />
‚litigatation support‘ für die Kanzlei zu ver<strong>de</strong>utlichen. Es wur<strong>de</strong> damit nicht nur die von<br />
Frauen in <strong>de</strong>r Firma geleistete Arbeit sichtbarer und damit aufgewertet, son<strong>de</strong>rn später<br />
aufgrund von Initiativen <strong>de</strong>r Betroffenen selbst möglich, <strong>de</strong>ren Arbeitsplätze vor <strong>de</strong>m<br />
Outsourcing zu bewahren (vgl. Suchman 2002a). Der Fall zeigt, dass formale<br />
Beschreibungen von Arbeit, seien sie von InformatikerInnen o<strong>de</strong>r ArbeitswissenschaftlerInnen<br />
erstellt, nicht „unschuldig“ sind. Vielmehr liefern diese häufig Entscheidungskriterien<br />
dafür, ob bestimmte Arbeitsplätze abgebaut und verlagert o<strong>de</strong>r im Zuge technologischer<br />
Prozesse durch eine entsprechen<strong>de</strong> Software unterstützt wer<strong>de</strong>n – und<br />
damit die bestehen<strong>de</strong> geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung aufrechterhalten o<strong>de</strong>r<br />
unterlaufen wird.<br />
Die prinzipielle I<strong>de</strong>e, unsichtbare Arbeit, die typischerweise und überproportionalvon<br />
Frauen geleistet wird, durch Sichtbarmachung im Zuge von Technologieentwicklungsprozessen<br />
aufzuwerten, wur<strong>de</strong> insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r 1980er und 1990er Jahren vielfach<br />
proklamiert. Die bekanntesten Studien über <strong>de</strong>n Versuch <strong>einer</strong> solchen Intervention<br />
liegen wie<strong>de</strong>rum aus <strong>de</strong>m Feld <strong>de</strong>r Krankenhausinformationssysteme vor. In diesem<br />
Bereich war – wie bereits in <strong>de</strong>n im vorangehen<strong>de</strong>n Abschnitt skizzierten Fallstudien<br />
ange<strong>de</strong>utet – mit <strong>de</strong>r Einführung von IT vor etwa 20 Jahren eine grundlegen<strong>de</strong><br />
Transformation eines traditionellen Frauenberufes zu beobachten. „‚What nurses really<br />
do‘ has for a long time been <strong>de</strong>fined as being to a large extent interactive, interpretive,<br />
intuitive, shared and collaborative with strong experiential basis.“ (Wagner 1993, 295)<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r IT-Einführung wur<strong>de</strong>n, wie anhand <strong>de</strong>r Fallstudien zu <strong>de</strong>n Krankenhausinformationssystemen<br />
bereits dargestellt wur<strong>de</strong> (vgl. Abschnitt 4.2.2.), im Tätigkeitsprofil<br />
<strong>de</strong>r Krankenpflege Managementkompetenzen integriert. Die neue professionelle<br />
I<strong>de</strong>ntität erfor<strong>de</strong>rte zunehmend organisatorische und administrative Aufgaben. 207<br />
Gleichzeitig stellte die angestrebte Verwissenschaftlichung <strong>de</strong>r Pflege einen Ansatz-<br />
207 Während diese Studien in Abschnitt 4.2.2. als Beleg für die Einschreibung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung in Informationssysteme ge<strong>de</strong>utet wur<strong>de</strong>, wer<strong>de</strong>n in diesem Abschnitte Ansätze zur Sichtbarmachung<br />
„unsichtbarer Arbeit“ diskutiert.<br />
145
punkt dar, um <strong>de</strong>r Fortschreibung hierarchischer Strukturen durch <strong>de</strong>n IT-Einsatz<br />
entgegenzuwirken.<br />
Geoffrey Bowker und Susan Leigh Star begleiteten während <strong>de</strong>r 1980er Jahre eine<br />
Initiative von Pflegewissenschaftlerinnen und Krankenpflegerinnen in <strong>de</strong>n USA, die<br />
gemeinsam eine „Nursing Intervention Classification“ (NIC) entwickelten (vgl. Bowker/<br />
Star 2000, 229f). In diesem Klassifikationssystem sollten sämtliche Pflegehandlungen,<br />
die nicht von <strong>de</strong>n ÄrztInnen vorgenommen wer<strong>de</strong>n, aufgeführt und beschrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
Es wur<strong>de</strong> partizipativ mit <strong>de</strong>m Pflegepersonal entwickelt. Die Einträge reichten<br />
von „Airway Management“ (d.h. Unterstützung <strong>de</strong>r PatientInnen beim Atmen, einschießlich<br />
<strong>de</strong>s Einsatzes von Atemtechnologien und Medikamenten) bis hin zur<br />
spirituellen Unterstützung, die als „assisting the patient to feel balance and connection<br />
with a greater power“ (vgl. Bowker/ Star 2000, 235) <strong>de</strong>finiert wur<strong>de</strong>. Je<strong>de</strong> einzelne<br />
Kategorie wur<strong>de</strong> kurz charakterisiert, verschie<strong>de</strong>ne mögliche Pflegeleistungen angegeben<br />
sowie weiterführen<strong>de</strong> Literatur.<br />
Bowker und Star fassen insgesamt drei Ziele <strong>de</strong>s Vorhabens zusammen. Erstens<br />
sollte ein Korpus wissenschaftlichen Wissens über die Pflege produziert wer<strong>de</strong>n.<br />
Zweitens ging es darum, <strong>de</strong>n Tätigkeitsbereich mit <strong>de</strong>r Etablierung und Anerkennung<br />
von Pflegearbeit als einem Bereich wissenschaftlichen Wissens zu professionalisieren<br />
und professionelle Autonomie zu garantieren. Ein drittes Argument bestand darin, dass<br />
die Pflege mit <strong>de</strong>n damals noch neuen Informationstechnologien Schritt halten sollte,<br />
die bereits in medizinische Berufe anfingen einzudringen. Da sich das Repräsentationsmedium<br />
wan<strong>de</strong>lte, „it was important to be able to talk about nursing in a language<br />
that computers could un<strong>de</strong>rstand, else nursing would not be represented at all in the<br />
future. It would risk being even further marginalized than it is at present.“ (vgl. Bowker/<br />
Star 2000, 237)<br />
Die angestrebte Verwissenschaftlichung <strong>de</strong>r Pflege 208 setzte an<br />
berufssoziologischen Erkenntnissen über Professionalisierungsprozesse an. Deutlich<br />
wird dies anhand <strong>de</strong>r Pflegehandlung „Humor“. 209 In <strong>de</strong>m von Bowker und Star<br />
untersuchten Klassifikationssystem ist eine Analyse, was es heißt, humorvoll zu sein,<br />
enthalten sowie ein theoretisches Konzept, was Humor bei <strong>de</strong>n PatientInnen bewirken<br />
soll. Dazu wird die „Pflegehandlung Humor“ in verschie<strong>de</strong>ne Teilaspekte unterglie<strong>de</strong>rt.<br />
Das Pflegepersonal solle zunächst bestimmen, welche Art von Humor die PatientIn<br />
schätzt und wie sie o<strong>de</strong>r er typischerweise darauf reagiert (z.B. Lachen o<strong>de</strong>r Lächeln),<br />
um dann geeignete Themen auszuwählen, welche bei <strong>de</strong>m Individuum eine<br />
entsprechen<strong>de</strong> Reaktion hervorzurufen vermögen, o<strong>de</strong>r Verspieltheit und Albernheit<br />
unterstützen etc. Im Klassifikationssystem sind unter <strong>de</strong>r Kategorie „Humor“ fünfzehn<br />
Teilaktivitäten aufgeführt, die wissenschaftlich relevant erscheinen. „A feature tra<strong>de</strong>tionally<br />
attached to the personality of the nurse (being a cheerful and supportive<br />
person) is now attached through the classification to the job <strong>de</strong>scription as an<br />
intervention that can be accounted for“ (Bowker/ Star 2000, 233ff). Um <strong>de</strong>r impliziten<br />
Erwartungshaltung, dass KrankenpflegerInnen stets fröhlich zu sein und die<br />
PatientInnen aufzubauen haben, entgegenzuwirken, wur<strong>de</strong> Humor in die Arbeitsbe-<br />
208 Vgl. hierzu auch das im letzten Abschnitt von Wagner 1989, 1991 skizzierte US-amerikanische System.<br />
209 Die “Nursing Intervention Classification” <strong>de</strong>finiert die Pflegehandlung Humor folgen<strong>de</strong>rmaßen:<br />
„Facilitating the patient to perceive, appreciate, and express what is funny, amusing, or ludicrous in or<strong>de</strong>r<br />
to establish relationship“ (Bowker/ Star 2000, 233).<br />
146
schreibung aufgenommen. Damit wird auf Tätigkeiten, die bisher als persönliche<br />
Eigenschaften und selbstverständliche Voraussetzungen für die Ausübung eines<br />
Pflegeberufs galten, im Sinne ihrer Professionalisierung aufmerksam gemacht. Das<br />
Beispiel ver<strong>de</strong>utlicht, dass mit <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntifizierung von Pflegeleistungen eine<br />
statusrelevante und monetäre Anerkennung von Tätigkeiten erhofft wur<strong>de</strong>, die <strong>de</strong>m<br />
sich mehrheitlich aus Frauen zusammensetzen<strong>de</strong>n Pflegepersonal bislang qua<br />
Geschlecht (und nicht qua Ausbildung) zugeschrieben wur<strong>de</strong>.<br />
Ingesamt sollte mit Hilfe <strong>de</strong>r „Nursing Intervention Classification“ (NIC) ein Bereich<br />
bislang generalisierend Frauen zugeschriebener Arbeit symbolisch wie materiell aufgewertet<br />
wer<strong>de</strong>n. Es galt, bisher gering bewertete bzw. wenig wahrgenommene<br />
Tätigkeiten im Zuge <strong>de</strong>r IT-Entwicklung sichtbar zu machen und in Status und<br />
Bezahlung zu erhöhen. Die beteiligten Krankenschwestern waren zuversichtlich, dass<br />
die elektronische Dokumentation ihrer Tätigkeiten dazu beitragen wür<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n Aufwand<br />
und die Komplexität von Pflegearbeit transparent zu machen. Bereits Wagner stellte<br />
jedoch ernüchternd fest, dass „the reality of computerized care plans – even when the<br />
nurses themselves have a voice in their <strong>de</strong>velopment – may lag far behind this i<strong>de</strong>a,<br />
given the authority structures in hospitals. With management focusing on care plans as<br />
instruments that may help them with their legal and accreditation issues, and nurses<br />
having to continue documenting their work […], care plans cannot unfold their<br />
potential.“ (Wagner 1993, 305). Das Argument, dass ökonomische Bewertung und<br />
Arbeitsbedingungen dadurch verbessert wer<strong>de</strong>n könnten, dass die Komplexität <strong>de</strong>r<br />
Arbeit und Kompetenz <strong>de</strong>r Krankenpflegerinnen sichtbar wird, drohe sich also ins<br />
Gegenteil zu verkehren, sobald es in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Managements gerät (vgl. Wagner<br />
1989, 174ff). Ein besserer Status <strong>de</strong>r Tätigkeit <strong>de</strong>s Pflegepersonals wur<strong>de</strong> bis heute<br />
nicht erreicht.<br />
Bowker und Star verweisen darüber hinaus auf fundamentale Probleme, die <strong>de</strong>r<br />
Versuch, spezifische Formen und Inhalte von Arbeit sichtbar zu machen, beinhaltet.<br />
Ein Problem bestehe darin, dass es – politisch betrachtet – nicht per se erstrebenswert<br />
sein muss, unsichtbare Tätigkeiten durch Technikeinsatz sichtbar zu machen. Denn die<br />
Unsichtbarkeit bestimmter Aspekte von Arbeit innerhalb eines IT-Systems führe häufig<br />
dazu, die Selbstbestimmung <strong>de</strong>r Arbeiten<strong>de</strong>n über die konkrete Ausführung ihrer Tätigkeiten<br />
zu erhalten. Eine Ambivalenz gegenüber einem zwar <strong>kritisch</strong> gemeinten, aber<br />
letztendlich verkürzten Imperativ <strong>de</strong>r Sichtbarmachung ergäbe sich ferner aus <strong>de</strong>r vereinfachten<br />
Kontrollmöglichkeit <strong>de</strong>r Arbeiten<strong>de</strong>n durch das Management, die durch eine<br />
elektronische Sichtbarkeit von Arbeit beför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann. Vor allem aber ließe sich<br />
durch die explizite Beschreibung von Tätigkeiten die Taylorisierung von Arbeit forcieren.<br />
Im Fall <strong>de</strong>r Pflegearbeit bestehe etwa die Gefahr, dass die ungelernten Tätigkeiten<br />
aus <strong>de</strong>m Aufgabenbereich <strong>de</strong>r Krankenpflege heraus genommen wer<strong>de</strong>n, die<br />
Profession ihre Autonomie verliert und <strong>de</strong>r „common sense“ im Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r KrankenpflegerInnen<br />
durch festgeschriebene, rigi<strong>de</strong> Formeln <strong>de</strong>r Arbeitsausführung ersetzt<br />
wird (vgl. Bowker/ Star 2000, 30).<br />
Die Pflege steht somit – wie Wagner betont – in einem „Spannungsfeld zwischen<br />
<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Pflegeprofession angestrebten Verwissenschaftlichung ihrer Tätigkeit und<br />
ihrer Standardisierung und damit auch Entwertung“ (Wagner 1989, 175). Die<br />
Fallstudien zur Professionalisierung und Verwissenschaftlichung <strong>de</strong>r Krankenpflege<br />
zeigen, dass eine Sichtbarmachung von Arbeit in Informationssystemen nicht<br />
147
notwendigerweise dazu führt, Machtpositionen und vergeschlechtlichte Hierarchien<br />
abzuschwächen. Es kann we<strong>de</strong>r davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass Intransparenz<br />
einzig dazu dient, strukturelle Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Noch lässt sich generell<br />
annehmen, dass InformatikerInnen mit gesellschafts<strong>kritisch</strong>er o<strong>de</strong>r feministischer<br />
Intention tatsächlich via Technikgestaltung strukturelle Verbesserungen – beispielsweise<br />
im Sinne <strong>einer</strong> Aufhebung o<strong>de</strong>r Abschwächung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung – für die Beteiligten erreichen können. 210 Ob die Sichtbarmachung von<br />
Tätigkeiten dazu beiträgt, dass Arbeitsplätze (wie im Fall <strong>de</strong>r Kodierung von<br />
Rechtsfällen in <strong>einer</strong> Kanzlei) erhalten bleiben, die ansonsten abgebaut wür<strong>de</strong>n, o<strong>de</strong>r<br />
zur Kontrolle und Taylorisierung von Arbeitsschritten führt (wie im Fall <strong>de</strong>r Krankenhausinformations-<br />
und Klassifikationssysteme zu befürchten ist), lässt sich nicht<br />
allgemein beantworten, son<strong>de</strong>rn nur im Einzelfall überprüfen. 211 Wichtig erscheint<br />
insgesamt, im Rahmen von Technikgestaltung zunächst eine Sensibilität dafür zu entwickeln,<br />
dass die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit bestimmter Tätigkeiten in informatischen<br />
Artefakten eine Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong> Segregation <strong>de</strong>s<br />
Arbeitsmarktes verstärken kann.<br />
4.2.4. Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung in <strong>de</strong>r<br />
Dienstleistungsgesellschaft: Callcenter-Arbeit und virtuelle<br />
AssistentInnen<br />
Mit <strong>de</strong>r Entwicklung hin zur Dienstleistungsgesellschaft fin<strong>de</strong>n sich sämtliche bis<br />
hierher i<strong>de</strong>ntifizierten Mechanismen <strong>de</strong>r Reproduktion geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung durch Informationstechnologien wie<strong>de</strong>r. Aktuell beobachten lassen sich<br />
im Bereich <strong>de</strong>s Kun<strong>de</strong>nservice zum einen die Konfigurationen <strong>de</strong>r NutzerInnen durch<br />
Technologie als „weiblich“, zum zweiten die Aufrechterhaltung von Machtstrukturen<br />
durch Arbeitsorganisation, Standardisierung und Technisierung sowie drittens die<br />
Unsichtbarkeit von Servicetätigkeiten, wie nachfolgend ausgeführt wird. Dienstleistungen<br />
wur<strong>de</strong>n überwiegend von Frauen ausgeführt und wer<strong>de</strong>n diesen zugleich auf <strong>einer</strong><br />
symbolischen Ebene zugeschrieben. So korrespondieren die für <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nservice<br />
als erfor<strong>de</strong>rlich gelten<strong>de</strong>n Fähigkeiten wie Kommunikativität, Einfühlungsvermögen und<br />
Fürsorglichkeit mit genau <strong>de</strong>n Eigenschaften, die weithin als „weiblich“ gelten.<br />
Vorgesetzte wünschen sich Angestellte, die bereit sind, <strong>de</strong>n KundInnen Service und<br />
selbstlose Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei wird häufig davon ausgegangen, dass<br />
Frauen die verlangten sozialen Fähigkeiten qua Geschlecht mitbringen. In diesem<br />
Sinne lässt sich behaupten, dass eine bestimmte Form von „Weiblichkeit“ die<br />
210 Das Beispiel <strong>de</strong>r „Nursing Intervention Classification“ verweist darüber hinaus auf ein weiteres<br />
fundamentales Problem, das mit <strong>de</strong>m Versuch, unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen einhergeht: die<br />
Problematik <strong>de</strong>r Grenzen von Formalisierbarkeit. Dieses Argument ist jedoch eher ein<br />
wissenschaftstheoretisch-epistemologisches und wird <strong>de</strong>shalb im folgen<strong>de</strong>n Kapitel 4.3. diskutiert.<br />
211 Die Tätigkeit <strong>de</strong>r Kodierung von Rechtfällen gehört zum 2. Typ unsichtbarer Arbeit nach <strong>de</strong>r eingangs<br />
skizzierten Klassifizierung von Nardi/ Engeström. Sie wird als Routine o<strong>de</strong>r manuelle Tätigkeit betrachtet,<br />
die tatsächlich jedoch ein qualifiziertes Wissen und Problemlösungsfähigkeiten erfor<strong>de</strong>rt. Die Pflegeleistung<br />
Humor dagegen ist ein informeller Arbeitsprozess, <strong>de</strong>r bisher zwar nicht Teil <strong>de</strong>r formalen<br />
Stellenbeschreibung ist, <strong>de</strong>nnoch notwendig zum Funktionieren von Arbeit beiträgt. Sie zählt damit zum 4.<br />
Typ unsichtbarer Tätigkeit. Zur Arbeit, die an unsichtbaren Orten geleistet wird (1. Typ); vgl. die Ausführungen<br />
zu <strong>de</strong>n Callcenter-AgentInnen im nächsten Abschnitt, zur Arbeit, die von „unsichtbaren“ Menschen<br />
ausgeführt wird (3. Typ), die Diskussion um Softwareagenten dort.<br />
148
Marktanfor<strong>de</strong>rung schlechthin in <strong>de</strong>r gegenwärtigen fortgeschrittenen Dienstleistungsgesellschaft<br />
darstellt (vgl. etwa Woodfield 1998 nach Belt et al. 2002).<br />
Ein relativ gut untersuchter Bereich <strong>de</strong>r Dienstleistungsarbeit, in <strong>de</strong>m die engen<br />
Zusammenhänge von Arbeitsanfor<strong>de</strong>rungen, Technikgestaltung und Geschlecht aufgezeigt<br />
wur<strong>de</strong>n, ist die Tätigkeit von Callcenter-AgentInnen. Tatsächlich sind die in Callcentern<br />
Beschäftigten mehrheitlich Frauen, selbst wenn ihr Anteil je nach Branche<br />
variiert. So fin<strong>de</strong>n sich in Großbritannien, Irland und <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n Hotlines<br />
für Computerservices knapp 50% Frauen und bis zu 80% im Finanzdienstleistungsbereich<br />
(vgl. Belt et al 2002). 212 Dass die Callcenter-AgentInnen in <strong>de</strong>r Regel Teilzeit<br />
arbeiten, 213 verfestigt die Vorstellung von einem „Frauenarbeitsplatz“. Ferner bestehen<br />
für die Callcenter-AgentInnen kaum berufliche Entwicklungs- o<strong>de</strong>r betrieblichen<br />
Aufstiegsmöglichkeiten. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass hier eine Frauen<br />
typisieren<strong>de</strong> Tätigkeit vorliegt. Den empirischen Studien zufolge legen die BetreiberInnen<br />
von Callcentern wenig Wert auf formale Abschlüsse. Statt<strong>de</strong>ssen sind kommunikative<br />
Kompetenzen und Spaß am Telefonieren gefor<strong>de</strong>rt. Für <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>nkontakt<br />
erwartet wür<strong>de</strong> ein „Lächeln in <strong>de</strong>r Stimme“ – eine Fähigkeit, die insbeson<strong>de</strong>re<br />
„Frauen“ unterstellt wird. Demgegenüber sei das notwendige technische Wissen auf<br />
die Kenntnis gängiger PC-Software reduziert (vgl. Maaß 2003). Angesichts dieser<br />
Ausgangslage stellt sich die Frage, ob die in Callcentern eingesetzte Technologie – wie<br />
in <strong>de</strong>n in Kapitel 4.2.2. und 4.2.3. dargestellten Studien – die vorherrschen<strong>de</strong><br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung reproduziert.<br />
Die technische Infrastruktur von Callcentern umfasst in <strong>de</strong>r Regel ein Anrufverteilsystem,<br />
Datenbanken mit Informationen über Produkte und ggf. AuftraggeberIn/<br />
Unternehmen sowie ein Customer-Relationsship-Management-System (CRM), das die<br />
Kun<strong>de</strong>nhistorie enthält. Die Callcenter-AgentInnen müssen während ihrer Tätigkeit<br />
zwischen <strong>de</strong>r Software mit ihren Möglichkeiten und Einschränkungen, <strong>de</strong>n organisatorischen<br />
Bedingungen und <strong>de</strong>m Verhalten <strong>de</strong>r KundInnen vermitteln. Die Anfor<strong>de</strong>rung<br />
besteht darin, dass sie „diese Softwaresysteme routiniert bedienen, an <strong>de</strong>n richtigen<br />
Stellen Eingaben machen, Systemausgaben schnell erfassen, sachgerecht interpretieren<br />
und ins Gespräch umsetzen [müssen]“ (Maaß 2003, 224). Dabei wird <strong>de</strong>r<br />
Spielraum <strong>de</strong>r Beschäftigten organisatorisch durch die Standardisierung <strong>de</strong>r Dienstleistung<br />
eingeschränkt, beispielsweise durch Regelungen über die Gesprächsdauer,<br />
Vorgaben zur Gesprächsführung bis hin zu festgelegten Gesprächsskripten mit<br />
wörtlichen Formulierungen (vgl. ebd., 225).<br />
Diese Reglementierungen wer<strong>de</strong>n häufig in die Software eingeschrieben und von<br />
dieser zugleich überwacht. Insofern lässt sich die These aufstellen, dass die technische<br />
Infrastruktur die AgentInnen als „Frauen“ konfiguriert. In ihr sind die typischen<br />
Merkmale von für Frauen als typisch angenommenen Tätigkeiten materiell-technisch<br />
manifestiert: Sie drängt die AgentInnen in eine passive, abhängige Rolle und verengt<br />
<strong>de</strong>ren Arbeit zu <strong>einer</strong> sich wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong>n Routinetätigkeit, bei <strong>de</strong>r sie keine Kontrolle<br />
über ihre eigene Arbeit besitzen. Bei dieser Konfigurierung von <strong>einer</strong> für Frauen als<br />
typisch angenommenen Tätigkeit durch Software und Arbeitsorganisation wird jedoch<br />
nicht mehr – wie beim von Hofmann untersuchten Textautomaten – auf das Bild <strong>de</strong>r<br />
212 In Deutschland sind Frauen – nach Maaß 2003– im Mittel zu zwei Dritteln in Callcentern vertreten.<br />
213 Es heißt, dass diese Tätigkeit nur maximal 4-5 Stun<strong>de</strong>n täglich leistbar ist; vgl. Maaß 2003, 220.<br />
149
„technisch inkompetenten Frau“ zurückgegriffen (vgl. hierzu auch Kapitel 4.2.1.).<br />
Vielmehr wer<strong>de</strong>n hier Arbeitsabläufe <strong>de</strong>r Callcenter-AgentInnen durch die Technologie<br />
als <strong>de</strong>qualizierte Fließband- bzw. Fabrikarbeit strukturiert (vgl. etwa Belt et al. 2002,<br />
22). Statt geschlechtlich konnotierter Kompetenz (bzw. Inkompetenz) wird hier eine<br />
spezifische prozessuale Struktur <strong>de</strong>r Arbeit in <strong>de</strong>r Technologie festgeschrieben, die<br />
<strong>de</strong>n Arbeitsplatz zu einem „typischen Frauenarbeitsplatz“ konfiguriert.<br />
Der technisch vorgegebene Arbeitsablauf erweist sich empirischen Studien zufolge<br />
jedoch als ein stark i<strong>de</strong>alisierter. Die organisatorischen und technischen Bedingungen<br />
erschweren die Nutzung <strong>de</strong>r Software. So weisen Maaß, Theissing und Zallmann<br />
(2002) aus <strong>einer</strong> arbeitspsychologischen Perspektive starke Belastungen bei <strong>de</strong>r<br />
Callcenterarbeit nach, die durch Wi<strong>de</strong>rsprüche zwischen <strong>de</strong>n rigi<strong>de</strong>n betrieblichen<br />
Vorgaben und <strong>de</strong>n Flexiblitätsanfor<strong>de</strong>rungen von Seiten <strong>de</strong>r KundInnen entstehen. Die<br />
Callcenterarbeit sei geprägt durch starken Zeitdruck (z.B. quantitative Vorgaben zu<br />
Anzahl und Dauer von Gesprächen) und hohe Konzentrationsanfor<strong>de</strong>rungen, die sich<br />
u.a. aufgrund <strong>de</strong>r gleichzeitigen Arbeit in zwei unterschiedlichen Kontexten (Kun<strong>de</strong>ngespräch<br />
und Systembedienung) ergäbe. Die Konzentrationsfähigkeit <strong>de</strong>r AgentInnen<br />
wer<strong>de</strong> zum einen durch die technische Infrastruktur enorm erschwert, da sie gravieren<strong>de</strong><br />
ergonomische Mängel aufweise. Denn die Callcenter-Software sei „einseitig an <strong>de</strong>r<br />
sachlichen Aufgabe orientiert und berücksichtigt die sozialen und kommunikativen<br />
Aspekte ihrer Bearbeitung nicht. Die Interaktion mit KundInnen wird wie ein rein<br />
sachlogisch bestimmter Datenaustausch behan<strong>de</strong>lt, nicht aber als ein sozialer Prozess<br />
mit all seinen Unwägbarkeiten und Aktionsmöglichkeiten“ (Maaß et al. 2002, 8).<br />
Aufgrund mangeln<strong>de</strong>r Flexibilität behin<strong>de</strong>re die Software die Kun<strong>de</strong>ninteraktion. Sie sei<br />
damit nicht „interaktionsangemessen“ (Maaß et al. 2002). Die <strong>de</strong>r Software zugrun<strong>de</strong><br />
liegen<strong>de</strong> Annahme, dass Callcenter-Tätigkeit durch simple Routine geprägt sei, mithin<br />
eine für Frauen als typisch angenommenene Arbeit darstelle, erwies sich somit in <strong>de</strong>r<br />
Praxis als kontraproduktiv.<br />
An<strong>de</strong>re Studien zum Dienstleistungsbereich betonen einen zweiten Aspekt, <strong>de</strong>r die<br />
Konzentration auf die Arbeit stark beeinflusst. Für die interaktive Dienstleistungstätigkeit<br />
sei auch Emotionsarbeit notwendig. (vgl. etwa Hampson/ Junor 2005). Emotionsarbeit<br />
lässt sich <strong>de</strong>finieren als „effort, planning and control nee<strong>de</strong>d to express<br />
organisationally <strong>de</strong>sired emotions during interpersonal transaction“ (Morris/ Feldmann<br />
1996, 987, zitiert nach: ebd., 174). Das Konzept geht zurück auf die renommierte<br />
Studie Hochschilds (1983), die am Beispiel <strong>de</strong>r Tätigkeit von Stewar<strong>de</strong>ssen erstmals<br />
aufzeigte, dass von Angestellten bei ihrer alltäglichen Arbeit häufig erwartet wird,<br />
bestimmte Emotionen öffentlich zu zeigen, die die Beschäftigten jedoch selbst nicht<br />
notwendigerweise fühlten. Dies kann enormen Stress verursachen und zu<br />
entsprechen<strong>de</strong>n gesundheitlichen Belastungen führen (vgl. Zapf 2002 für einen Überblick).<br />
Denn gera<strong>de</strong> im Dienstleistungsbereich gerät die von Seiten <strong>de</strong>s Managements<br />
erwünschte emotionale Reaktion <strong>de</strong>r DienstleisterIn häufig in Wi<strong>de</strong>rspruch mit <strong>de</strong>n<br />
KundInnenanfor<strong>de</strong>rungen. Die o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Beschäftigte hat dann drei Möglichkeiten zu<br />
reagieren, von <strong>de</strong>nen keine attraktiv erscheint. Entwe<strong>de</strong>r vertritt sie/er die Sicht <strong>de</strong>s<br />
Managements auf Kosten persönlicher Integrität und nimmt Spannungen mit <strong>de</strong>r<br />
KundIn in Kauf. O<strong>de</strong>r sie/er stellt sich auf die Seite <strong>de</strong>r KundIn, womit sie Spannungen<br />
mit <strong>de</strong>m Management riskiert bis hin zur eigenen Entlassung. Die dritte Möglichkeit<br />
besteht darin, die Interaktion mit <strong>de</strong>r KundIn möglichst kurz zu halten und <strong>de</strong>m<br />
150
vorgegebenen Skript entsprechend durchzuführen, um somit <strong>de</strong>n emotionalen<br />
Aufwand zu reduzieren. Hampson und Junor sprechen hierbei von einem „strategic<br />
disengagement“ (Hampson/ Junor 2005, 176).<br />
In Callcentern dominiert <strong>de</strong>n empirischen Untersuchungen zufolge die zweite Strategie.<br />
Die Beschäftigten gewinnen Zufrie<strong>de</strong>nheit mit <strong>de</strong>r Arbeit primär dadurch, dass sie<br />
versuchen, möglichst hochqualitative Dienstleistungsarbeit zu erbringen (vgl. Belt et al.<br />
2002, 29). Auch die von Wray-Bliss (2001) interviewten Callcenter-AgentInnen betonen<br />
die emotionale Qualität ihrer Arbeit. Sie nutzen damit <strong>de</strong>n Diskurs <strong>de</strong>s „Dienstes an <strong>de</strong>r<br />
KundIn“, um <strong>de</strong>r im Management vorherrschen<strong>de</strong>n Auffassung, dass Service<br />
ausschließlich anhand <strong>einer</strong> hohen Anzahl beantworteter Anrufe zu messen sei, ihre<br />
eigene Definition entgegenzusetzen. Das Argument dient <strong>de</strong>n Beschäftigten folglich<br />
dazu, die eigenen Fähigkeiten zu bekräftigen und einen gewissen Grad an Autonomie<br />
zu wahren. An dieser Stelle wird <strong>de</strong>utlich, dass die Frage, was „guter Service“ im<br />
Callcenter darstellt, eine politische ist. Die technische Infrastruktur (in diesem Fall die<br />
Anrufverteilanlage, die zugleich die Dauer und Anzahl <strong>de</strong>r Anrufe einzelner AgentInnen<br />
protokolliert) lässt sich als Antwort darauf lesen. Sie wirkt daran mit, Machtstrukturen<br />
im Callcenter aufrechtzuerhalten. Eine <strong>de</strong>rartige Absicherung von Ungleichheitsverhältnissen<br />
erfolgt insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Callcenter-Arbeit, in <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Frauenanteil<br />
hoch ist, <strong>de</strong>nn die Hotlines <strong>de</strong>r Computerservices, in <strong>de</strong>nen Männer stärker<br />
vertreten sind, haben zumeist weniger strikte Vorgaben bei <strong>de</strong>r Anrufbearbeitung.<br />
Insofern wird auch im Bereich <strong>de</strong>r Callcenter ten<strong>de</strong>nziell die bestehen<strong>de</strong><br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung durch Technologie untermauert.<br />
In sozialwissenschaftlichen Analysen <strong>de</strong>r Callcenter-Arbeit wird nicht nur die<br />
Konfigurierung von NutzerInnen als „Frauen“ (bzw. <strong>de</strong>r Konfiguration <strong>de</strong>s Arbeitsplatzes<br />
als „Frauenarbeitsplatz“) und die Aufrechterhaltung von Machtstrukturen<br />
thematisiert. Ebenso wird dort <strong>de</strong>r dritte in diesem Abschnitt i<strong>de</strong>ntifizierte Aspekt <strong>de</strong>r<br />
Einschreibung gesellschaftlicher Strukturen in die Software, die Unsichtbarkeit von<br />
Tätigkeiten, diskutiert (vgl. etwa Hampson/ Junor 2005, Maaß/ Rommes 2007). Dabei<br />
zeigte sich jedoch, dass die Ergebnisse differenzierter sind als auf die einfache Formel<br />
reduziert wer<strong>de</strong>n zu können, dass „Frauenarbeit“ unsichtbar sei und <strong>de</strong>shalb we<strong>de</strong>r<br />
gesellschaftlich-ökonomisch anerkannt noch von <strong>de</strong>r Software angemessen unterstützt<br />
wer<strong>de</strong>. Nach Belt et al. (2002) wird beispielsweise die Kommunikationsfähigkeit<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Firma hoch gewertet, obwohl sie speziell von <strong>de</strong>n BetreiberInnen häufig<br />
als Eigenschaft von „Frauen“ naturalisiert wird.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>r Callcenter dagegen bestätigt sich das traditionelle Bild, <strong>de</strong>nn dort<br />
wird die fachliche kommunikative Kompetenz <strong>de</strong>r AgentInnen, die sie sich eigenen<br />
Angaben zufolge hart erarbeitet haben, eher nicht wahrgenommen. Sie gilt gemeinhin<br />
als einfache und unqualifizierte Tätigkeit. Insofern ist die Komplexität <strong>de</strong>r Callcenter-<br />
Arbeit in <strong>de</strong>r gesellschaftlichen Wahrnehmung „unsichtbar“ (vgl. Belt et al. 2002, 31). 214<br />
Noch weniger nach außen hin sichtbar scheint die Emotionsarbeit, die Callcenter-<br />
AgentInnen leisten, <strong>de</strong>nn für diese existiert nicht einmal ein Diskurs innerhalb <strong>de</strong>s<br />
Callcenter-Managements. Sie wird ebenso wie die Fähigkeit zu kommunizieren als<br />
214 Belt et al. 2002 sehen zwar Hinweise darauf, dass die vermeintlich „weiblichen“ Sozialkompetenzen<br />
sichtbarer, breiter anerkannt und vergütet wer<strong>de</strong>n, da sie zunehmend klarer als für die Callcenter-Arbeit<br />
erlernbare Fähigkeiten kategorisiert und formal bestimmt wer<strong>de</strong>n. Dennoch scheint dies bisher wenig am<br />
gesellschaftlichen Bild <strong>de</strong>r Tätigkeit zu än<strong>de</strong>rn.<br />
151
Eigenschaft von „Frauen“ angesehen. Damit wer<strong>de</strong>n erworbene Fertigkeiten als „geschlechtsspezifische<br />
Persönlichkeitsmerkmale“ abgewertet und zugleich <strong>de</strong>ren geringe<br />
Honorierung legitimiert. An dieser Herabwürdigung än<strong>de</strong>rt auch <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong><br />
Technikeinsatz im Callcenter nichts, <strong>de</strong>r prinzipiell zu <strong>einer</strong> symbolischen Aufwertung<br />
dieser Dienstleistungsarbeit führen könnte. Denn die erfor<strong>de</strong>rliche technische Kompetenz<br />
für diese Tätigkeiten wird (abgesehen von Computerhotlines) nur in <strong>de</strong>r<br />
rountinemäßigen Bedienung von Software gesehen und <strong>de</strong>shalb eher gering<br />
geschätzt.<br />
Ebenso wie Pflege durch mangeln<strong>de</strong> Wahrnehmung und Wertschätzung zunächst<br />
nicht in Krankenhausinformationssystemen repräsentiert war (vgl. Abschnitt 4.2.2.)<br />
spiegelt sich die Unsichtbarkeit kommunikativer Fähigkeiten und emotionaler Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
an die Callcenter-AgentInnen in <strong>de</strong>r Software wie<strong>de</strong>r. Demgegenüber zeigten<br />
die differenzierten Arbeitsanalysen im Callcenter, dass die Software übersichtlich,<br />
effizient und flexibel gestaltet sein muss, um die vielfältigen Gesprächsverläufe, d.h.<br />
die Interaktion <strong>de</strong>r Callcenter-AgentInnen mit <strong>de</strong>n KundInnen angemessen unterstützen<br />
zu können (vgl. Maaß et al. 2002). 215 Maaß Arbeiten in diesem Bereich zielen<br />
darauf, die verborgenen sozialen und technischen Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Callcenter-<br />
Tätigkeit sichtbar zu machen und das Bild <strong>de</strong>r einfachen, unqualifizierten Callcenter-<br />
Arbeit, das <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Wahrnehmung <strong>de</strong>r dabei benötigten Kompetenzen bei <strong>de</strong>n<br />
SoftwaregestalterInnen zugrun<strong>de</strong> liegt, zu <strong>de</strong>konstruieren. „It seems that earlier<br />
<strong>de</strong>velopers of the software had overlooked or ignored the complicatedness of the work<br />
done by call center agents. Hence, they have tried to capture and standardise parts of<br />
the work that were too complicated to be formalised and standardised“ (Maaß/<br />
Rommes 2007, 105f). Dass HCI-ExpertInnen und Softwareanbieter die Komplexität <strong>de</strong>r<br />
Callcenter-Arbeit bisher unterschätzt haben, führen Maaß und Rommes (2007) auf <strong>de</strong>n<br />
„gen<strong>de</strong>r bias“ in <strong>de</strong>n analytischen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Informatik zurück. Die herkömmlichen<br />
Instrumente <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse fokussierten primär auf die Bereiche <strong>de</strong>r<br />
Produktions- und Büroarbeit, in <strong>de</strong>nen komplexe Interaktionen kaum eine Rolle<br />
spielten. Zur Ermittlung von Anfor<strong>de</strong>rungen in Bereichen, in <strong>de</strong>nen Interaktions- und<br />
Emotionsarbeit zentral sind, lägen jedoch keine adäquaten Analysemetho<strong>de</strong>n vor (vgl.<br />
Maaß/ Rommes 2007, 102). Die gesellschaftliche Unsichtbarkeit von Tätigkeiten, die<br />
als „weiblich“ gelten – beispielsweise Haus-, Familien- o<strong>de</strong>r personenbezogene Dienstleistungsarbeit<br />
–spiegele sich somit im informatischen Metho<strong>de</strong>nkanon wie<strong>de</strong>r. In <strong>de</strong>r<br />
Folge sind diese Tätigkeiten in <strong>de</strong>r Software nicht repräsentiert und wer<strong>de</strong>n eher behin<strong>de</strong>rt<br />
als technisch angemessen unterstützt. 216 Die GestalterInnen von Callcenter-<br />
Software seien damit ebenso geschlechtsblind wie die informatischen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse (vgl. ebd., 206).<br />
215 Eine für die Interaktion mit <strong>de</strong>n KundInnen angemessene Software wür<strong>de</strong> zwar die kommunikativen<br />
Aspekte <strong>de</strong>r Callcenter-Tätigkeit unterstützen. Jedoch stellt sich die Frage, wie Emotionsarbeit durch<br />
Software sichtbar gemacht und möglichst stressfrei gestaltet wer<strong>de</strong>n kann; vgl. hierzu auch die Diskussion<br />
um die Pflegeleistung Humor im Klassifikationssystem NIC in Kapitel 4.2.2.<br />
216 Maaß und Rommes 2007 verweisen in diesem Kontext auf ein Produktivitätsparadox, das Star und<br />
Strauss 1999 bereits allgemein für die unsichtbare Arbeit i<strong>de</strong>ntifiziert hatten. Dadurch, dass <strong>de</strong>r<br />
Interaktionsspielraum <strong>de</strong>r Callcenter-AgentInnen bei <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r Software ignoriert wür<strong>de</strong>,<br />
benötigen die Callcenter-AgentInnen statt <strong>de</strong>r erhofften Einsparung eher mehr Arbeitszeit z.B. für die<br />
Nachbearbeitung eines Telefonates, um die technischen Defizite auszugleichen, wenn sie eine hohe<br />
Dienstleistungsqualität aufrechterhalten möchten.<br />
152
Diese Argumentation läuft Gefahr, „männliches Design“ o<strong>de</strong>r einen „gen<strong>de</strong>r bias“ in<br />
<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n – ähnlich wie die Untersuchungen zur „I-methodology“ (vgl. Kapitel<br />
4.1.4.) – <strong>einer</strong> durch Technologie festgeschriebenen „weiblichen Sphäre“ gegenüberzustellen.<br />
Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n dargestellten Analysen <strong>de</strong>r digitalen Städte wird hier<br />
jedoch nicht auf eine Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität im Sinne „weiblicher“ Eigenschaften o<strong>de</strong>r<br />
Fähigkeiten rekurriert und damit eine empirisch nicht haltbare Annahme reproduziert,<br />
son<strong>de</strong>rn auf existieren<strong>de</strong> Strukturen <strong>de</strong>r Ungleichheit. Aus <strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
und feministischen Perspektive erscheint es weiterhin notwendig, die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Segregation <strong>de</strong>s Arbeitsmarktes und ihren Erhalt durch technische<br />
Artefakte am konkreten Fall empirisch nachzuweisen, damit die damit einhergehen<strong>de</strong>n<br />
Prozesse <strong>de</strong>r Kritik zugänglich gemacht und verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n können. Dabei besteht<br />
die Herausfor<strong>de</strong>rung aus Sicht <strong>de</strong>r konstruktivistischen Gen<strong>de</strong>rforschung darin,<br />
strukturelle Ungleichheiten herauszuarbeiten, ohne dabei erneute Zuschreibungen an<br />
typische „Frauenarbeit“ (z.B. Callcenter-Tätigkeit) und „Männerarbeit“ (z.B. Technikgestaltung)<br />
vorzunehmen. Eine Möglichkeit <strong>de</strong>r Vermittlung, die diesen Wi<strong>de</strong>rspruch<br />
zwar nicht vollständig löst, besteht darin, Abstraktionen von jeweiligen Tätigkeiten als<br />
solche aufzu<strong>de</strong>cken. So zielen beispielsweise Maaß’ Untersuchungen auf eine<br />
Dekonstruktion <strong>de</strong>s Bilds <strong>de</strong>r simplen, unqualifizierten Callcenter-Arbeit.<br />
Dass diese Strategie <strong>de</strong>r Dekonstruktion gera<strong>de</strong> in Kontext <strong>de</strong>r Callcenter-Arbeit<br />
sinnvoll und notwendig sein kann, darauf <strong>de</strong>uten neuere Ten<strong>de</strong>nzen zur Automatisierung<br />
von Beratungstätigkeiten, die auf solchen reduktionistischen Vorstellungen<br />
basieren. Um <strong>de</strong>n KundInnen besseren Service zu bieten, wer<strong>de</strong>n seit einigen Jahren<br />
auf kommerziellen Websites Chatbots und menschenähnlich verkörperte Softwareagenten<br />
als virtuelle AssistentInnen eingesetzt. Diese sollen die vermeintlich einfachen<br />
Tätigkeiten von Callcenter-AgentInnen ersetzen o<strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong> sozio-technische<br />
Systeme ergänzen. Ein Hauptziel ist die Einsparung von Kosten gegenüber <strong>de</strong>r<br />
teureren face-to-face-Dienstleistung. Ferner wird erhofft, dass die Softwareagenten die<br />
Kun<strong>de</strong>nbindung steigern und das Markenzeichen stärken. Die virtuellen DienstleisterInnen<br />
erweitern existieren<strong>de</strong> Marketing- und Verkaufsfunktionen von<br />
Onlinediensten. Sie führen KundInnen durch <strong>de</strong>n Online-Kaufprozess o<strong>de</strong>r übermitteln<br />
personalisierte Werbebotschaften. Sie geben medizinische Auskünfte und beraten in<br />
Kreditfragen o<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Einrichtung von Girokonten. Die Charaktere auf <strong>de</strong>m<br />
Bildschirm sind 24 Stun<strong>de</strong>n am Tag für die KundInnen da, sie wer<strong>de</strong>n nicht mü<strong>de</strong>, sind<br />
immer gleich freundlich, auch wenn sie es mit anstrengen<strong>de</strong>n KäuferInnen zu tun<br />
haben o<strong>de</strong>r rauh behan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Sie repräsentieren somit die perfekte DienstleisterIn.<br />
Angesichts <strong>de</strong>ssen stellt sich die Frage, inwiefern die für <strong>de</strong>n offline<br />
Dienstleistungsbereich (und speziell Callcenter) herausgearbeiteten geschlechtsstereotypen<br />
Vorstellungen auch durch diese neue Technologie reproduziert wer<strong>de</strong>n.<br />
Eva Gustavsson (2005) hat eine Reihe dieser neuen „Angestellten“ <strong>de</strong>r Serviceindustrie<br />
empirisch untersucht. 217 Es interessierte sie primär, inwieweit die virtuellen<br />
DienstleisterInnen die Geschlechtsstereotype und die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung <strong>de</strong>r realen Welt abbil<strong>de</strong>ten. Dabei stellte sie bereits auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r<br />
äußerlichen Repräsentation bemerkenswerte Geschlechtsunterschie<strong>de</strong> fest. So war die<br />
217 Sie fand zwischen 2001 und 2003 im Internet ca. 50 anthropomorphe virtuelle AssistentInnen, von<br />
<strong>de</strong>nen sie 30 „interviewte“, d.h. sie führte mit diesen Figuren mittels eines halbstandardisierten Leitfa<strong>de</strong>ns<br />
einen „Chat“.<br />
153
Mehrzahl <strong>de</strong>r als „männlich“ symbolisierten virtuellen Charaktere (13 von 15)<br />
fotorealistisch dargestellt, während es unter <strong>de</strong>n als „weiblich“ symbolisierten nur 5 von<br />
22 waren. Die fotorealistischen virtuellen „Männer“ trugen Anzüge, repräsentierten IT-<br />
und Finanzberater, Beamte, Ärzte und Manager, die „Männer“ verkörpern<strong>de</strong>n Comicfiguren<br />
waren dagegen im Dienstleistungsbereich tätig, etwa im Restaurantbetrieb o<strong>de</strong>r<br />
in <strong>de</strong>r Schönheitsindustrie. Auf Seiten <strong>de</strong>r virtuellen „Frauen“ arbeiteten die fotorealistischen<br />
als virtuelle Beraterinnen und Verkäuferinnen, die fotounrealistischen waren im<br />
Kun<strong>de</strong>ndienstleistungsbereich beschäftigt, etwa im Finanz-, Gesundheits- o<strong>de</strong>r<br />
städtisch-kommunalen Service (vgl. Gustavsson 2005, 408). Während viele <strong>de</strong>r<br />
„Männer“ repräsentieren<strong>de</strong>n virtuellen Assistenten Individuen darstellte, die in <strong>de</strong>r<br />
gesellschaftlichen und organisatorischen Hierarchie hochrangige Positionen beklei<strong>de</strong>n,<br />
übte die Mehrzahl <strong>de</strong>r „Frauen“ repräsentieren<strong>de</strong>n virtuellen AssistentInnen primär<br />
anonyme Dienstleistungsarbeit aus. Damit bestätigt sich die Annahme, dass die bestehen<strong>de</strong><br />
gesellschaftlich-hierarchische Arbeitsteilung direkt auf die Welt <strong>de</strong>r virtuellen<br />
Angestellten <strong>de</strong>r Dienstleistungsindustrie übertragen wird.<br />
Ferner zeigten „Interviews“ mit <strong>de</strong>n virtuellen Charakteren, dass die fotorealistischen<br />
Figuren zumeist auf eine reale Lebenswelt rekurrieren konnten. Sie gaben an, Familie,<br />
Hobbies und an<strong>de</strong>re Interessen als die Arbeit zu haben. Im Vergleich dazu verorteten<br />
sich die fotounrealistischen Figuren ausschließlich in <strong>de</strong>r Online-Welt. Sie sprachen<br />
nicht über sich selbst, hatten keine persönlichen Beziehungen und keine eigene<br />
I<strong>de</strong>ntität. „All they cared about was work. […] There seems to be a ten<strong>de</strong>ncy towards<br />
the perfect (female) employee and away from virtual personalities […] The perfect<br />
worker is being cleansed from personhood and from social influences, which can be<br />
<strong>de</strong>duced from the restrictions in personal repertoire and a growing unwillingness to<br />
chat“ (Gustavsson 2005, 412). Das empirische Material zeigt, dass sich die „Frauen“<br />
repräsentieren<strong>de</strong>n fotounrealistischen virtuellen AssistentInnen stärker <strong>de</strong>r Arbeit<br />
widmen als die an<strong>de</strong>ren Figuren. Sie wur<strong>de</strong>n als die besseren Dienstleistungsangestellten<br />
programmiert: jung und engagiert bei <strong>de</strong>r Arbeit, preiswert und je<strong>de</strong>rzeit<br />
zugänglich.<br />
Die stereotype Auffassung, dass Frauen natürlicherweise für Dienstleistungs-,<br />
Interaktions- und Emotionsarbeit geeignet seien, wird <strong>de</strong>mzufolge in <strong>de</strong>n Online-<br />
Repräsentation nicht nur wie<strong>de</strong>rholt und bestätigt, son<strong>de</strong>rn zugespitzt, da es mit einem<br />
sexistischen Bild von „Frauen“ zugeschriebener Arbeit überlagert wird. Gezeigt wird<br />
hier nicht – wie in pornografischen Darstellungen offline o<strong>de</strong>r online üblich – eine Frau,<br />
die je<strong>de</strong>rzeit für Sex verfügbar ist und hingebungsvoll alle nur er<strong>de</strong>nklichen erotischen<br />
Wünsche erfüllt. Vielmehr bietet sie ihre Dienste nun im Servicebereich an, wo sie<br />
wie<strong>de</strong>rum für die KundInnen allzeit bereit ist, sie berät und ihnen je<strong>de</strong>n Dienstleistungswunsch<br />
erfüllt, <strong>de</strong>vot und altruistisch, aber ohne einen angemessenen Lohn und<br />
arbeitsrechtliche Absicherungen einzufor<strong>de</strong>rn. Für virtuelle Männer scheint eine solche<br />
aufopfern<strong>de</strong> Haltung nicht überzeugend, sie wer<strong>de</strong>n mit einem an<strong>de</strong>ren gesellschaftlichen<br />
Status ausgestattet und wür<strong>de</strong>n sich die beschriebenen Arbeitsbedingungen<br />
vermutlich nicht gefallen lassen. Insofern bil<strong>de</strong>n virtuelle AssistentInnen im Dienstleistungsbereich<br />
die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung <strong>einer</strong>seits ab. An<strong>de</strong>rerseits<br />
verstärken sie diese, in<strong>de</strong>m sie ein längst überholt geglaubtes Bild von „Frauen“<br />
herstellen, nach <strong>de</strong>m sich diese selbst als abhängig, unterwürfig und für <strong>de</strong>n Service<br />
an <strong>de</strong>n KundInnen zuständig inszenieren.<br />
154
Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die These von Maaß und Rommes bestätigt, dass<br />
Dienstleistungen, im Callcenter o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rswo, tatsächlich weitaus komplexere<br />
Tätigkeiten sind als von <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen gedacht und mo<strong>de</strong>lliert. Denn dann<br />
bestün<strong>de</strong> die Chance, dass diese binär vergeschlechtlichten Angebote virtueller<br />
AssistentInnen von <strong>de</strong>r Masse <strong>de</strong>r KundInnen nicht angenommen wer<strong>de</strong>n. Dass das<br />
Konzept <strong>de</strong>r virtuellen AssistentIn als perfekter DienstleisterIn bereits gescheitert sein<br />
könnte, darauf <strong>de</strong>utet, dass mittlerweile einige <strong>de</strong>r virtuellen BeraterInnen vom Netz<br />
genommen wur<strong>de</strong>n. Insgesamt lässt sich jedoch nicht darauf vertrauen, dass marktinterne<br />
Mechanismen <strong>de</strong>r Zementierung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung<br />
entgegenwirken und sich Einschreibungen in die Technik von selbst regulieren wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Gegensatz dazu zeigen sämtliche <strong>de</strong>r in diesem Abschnitt vorgestellten Studien<br />
eher eine Kontinuität <strong>de</strong>r Verstärkung bestehen<strong>de</strong>r gesellschaftlicher Ungleichheitsstrukturen<br />
durch Technologien.<br />
4.2.5. Explizite Repräsentation <strong>de</strong>s Geschlechtskörpers: Avatare, Spielfiguren<br />
und anthropomorphe Softwareagenten<br />
Die virtuellen Assistentinnen bringen eine weitere Dimension möglicher Vergeschlechtlichung<br />
und Normalisierung technischer Artefakte ins Spiel, die mit <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n<br />
Rechenleistung und besseren grafischen Performanz von Computern vor allem im<br />
letzten Jahrzehnt möglich gewor<strong>de</strong>n ist: die Repräsentation geschlechtlicher Körper auf<br />
<strong>de</strong>r Bildschirmoberfläche einschließlich ihrer Animation. Wur<strong>de</strong> die Vergeschlechtlichung<br />
digitaler Figuren bis hierher auf <strong>de</strong>r Folie geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung,<br />
d.h. auf <strong>einer</strong> strukturellen Ebene diskutiert, so soll die Frage nach <strong>de</strong>m<br />
Aufbrechen o<strong>de</strong>r Zementieren dichotomer Geschlechtsmuster nun stärker auf symbolische<br />
Ebenen gewen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, wo sie sich aufgrund <strong>de</strong>s verbesserten technischen<br />
Potentials neu stellt. Reproduzieren digitale Verkörperungen vorherrschen<strong>de</strong> Vorstellungen<br />
von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ o<strong>de</strong>r weichen sie jene auf? Bedienen<br />
sie vornehmlich <strong>de</strong>n „männlichen Blick“ o<strong>de</strong>r bieten sie I<strong>de</strong>ntifikationsmöglichkeiten für<br />
Frauen? Wer<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Auseinan<strong>de</strong>rfallen von gelebtem und digital verkörpertem<br />
Geschlecht tatsächlich Grenzüberschreitungen, Neuentwürfe und Verwirrungen<br />
möglich o<strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong> binäre Muster eher noch verstärkt?<br />
Unter diesem Fragenkomplex lassen sich zumin<strong>de</strong>st drei verschie<strong>de</strong>ne Technologien<br />
analysieren: Figuren aus Computerspielen, Avatare, mit Hilfe <strong>de</strong>rer sich NutzerInnen<br />
in weiteren virtuellen Räumen selbst einen Körper geben können, und anthropomorphe<br />
Softwareagenten, die <strong>de</strong>n NutzerInnen auf <strong>de</strong>m Bildschirm gegenüber treten.<br />
Die Vielfalt <strong>de</strong>r unterschiedlichen Settings virtueller Umgebungen, in <strong>de</strong>nen Avatare<br />
und Spielfiguren mittlerweile eingesetzt wer<strong>de</strong>n, hat eine Masse von (größtenteils<br />
quantitativ ausgerichteten) Untersuchungen hervorgebracht, die in direkter o<strong>de</strong>r<br />
indirekter Weise die Kategorie Geschlecht in <strong>de</strong>n Blick nehmen. Darunter lassen sich<br />
Studien zum Aussehen und Auftreten <strong>de</strong>r Avatare, zur Wahl <strong>de</strong>r Avatare durch die<br />
NutzerInnen, zur Wahrnehmung, Akzeptanz und Überzeugungsfähigkeit <strong>de</strong>r jeweiligen<br />
155
Charaktere sowie solche, die auf <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess <strong>de</strong>r Figuren zielen,<br />
unterschei<strong>de</strong>n. 218<br />
Am bekanntesten sind Analysen <strong>de</strong>r Geschlechtsrepräsentation „weiblicher“ Computerspielheldinnen,<br />
so genannter „Sheroes“, wie Birgit Richard (2004) diese bezeichnet<br />
hat. Allen voran gilt Lara Croft als eine „kulturelle Ikone“ (Deuber-Mankowski 2001),<br />
kaum eine an<strong>de</strong>re Figur wur<strong>de</strong> in feministischen Diskussionen so kontrovers diskutiert.<br />
„Sie gilt vor allem in radikalfeministischen Kreisen aufgrund ihrer weiblichen Körperformen<br />
als Saboteurin <strong>de</strong>r Emanzipation. Auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite repräsentiert sie aufgrund<br />
<strong>de</strong>s toughen Durchsetzungsvermögens auch eine zeitgenössische weibliche Ikone, an<br />
<strong>de</strong>r sich viele Frauen orientieren“ (Richard 2004, 7). Sehen die einen in Lara Croft eine<br />
Ermächtigungsphantasie, die nicht nur Frauen als Rollenmo<strong>de</strong>ll dienen kann, son<strong>de</strong>rn<br />
auch Männer zu einem Geschlechtsrollentausch einlädt, kritisieren an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n<br />
übersexualisierten Frauenkörper bzw. die Zurschaustellung „digitaler Beauties“ generell<br />
(vgl. etwa Deuber-Mankowski 2001, Schl<strong>einer</strong> 2001). Gegenstand <strong>de</strong>r Analyse von<br />
Lara Croft ist ferner die Intersektionalität von Gen<strong>de</strong>r und Race bzw. die Frage nach<br />
<strong>de</strong>r Repräsentation von Transnationalität (vgl. etwa Pritsch 2000). Weitere Untersuchungen<br />
fokussieren dagegen stärker auf die zahlreichen Schwestern, die die<br />
Kunstfigur seit <strong>de</strong>r Veröffentlichung <strong>de</strong>r ersten Version 1996 bekommen hat (Richard et<br />
al. o.J.). Dort wird nach <strong>de</strong>r Autonomie, die <strong>de</strong>n „weiblichen“ Charakteren in Computerspielen<br />
verliehen wird, nach <strong>de</strong>n I<strong>de</strong>ntifikationsmöglichkeiten für Frauen als Nutzerinnen<br />
o<strong>de</strong>r nach möglichen Verschiebungen und Variationen in <strong>de</strong>r kulturellen Kodierung<br />
von Geschlecht gefragt, die durch diese eröffnet wer<strong>de</strong>n. Es geht darum, „polyvalente<br />
Be<strong>de</strong>utungshorizonte“ und „Möglichkeiten <strong>einer</strong> autonomen weiblichen Schaulust ohne<br />
männlichen Blick“ zu i<strong>de</strong>ntifizieren. Richard zufolge reicht die Rezeption <strong>de</strong>r Heldinnen<br />
von purer Konsumption bis hin zu <strong>einer</strong> subversiven Haltung, wobei sich häufig eine<br />
aktive Aneignung beobachten lasse, welche die vorhan<strong>de</strong>nen Markierungen wie die<br />
Überbetonung <strong>de</strong>s „Weiblichen“ transformiere, um eine I<strong>de</strong>ntifikation zu ermöglichen<br />
(ebd.). Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n oben beschriebenen Studien (vgl. die Kapitel 4.1.1. und<br />
4.1.2), die nach Erklärungen suchten, warum sich Mädchen und Frauen weniger für<br />
Computerspiele interessieren als Jungen und Männer, steht in <strong>de</strong>n kulturwissenschaftlichen<br />
Studien eher das Potential zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechterdichotomen<br />
Blickkonstellation im Mittelpunkt: „Men look and women appear“, wobei die<br />
Studien häufig eher ambivalente Ergebnisse liefern. Aufgrund ihrer vielschichtigen<br />
Resultate erscheinen diese <strong>de</strong>konstruktivistischen Ansätze nicht leicht umsetzbar in<br />
Vorschläge zur „besseren“ Konstruktion <strong>de</strong>r Figuren. 219 Dennoch stellen diese<br />
218 Darüber hinaus fin<strong>de</strong>n sich vereinzelt auch psychologisch-kognitionswissenschaftliche<br />
Untersuchungen, die vom Umgang mit Avataren auf Menschen rückschließen. So ergab etwa die<br />
empirische Studie von Kleinsmith et al. 2006, dass Frauen die Emotionen, die durch die Körperhaltungen<br />
von 3D-Avatare ausgedrückt wur<strong>de</strong>n, besser erkannten als Männer. Die AutorInnen schließen daraus auf<br />
vergleichbare zweigeschlechtlich differenzierte Effekte beim Erkennen menschlichen Körperausdrucks.<br />
219 Jutta Weber und ich haben in Bezug auf „soziale Maschinen“ argumentiert, dass sich die<br />
Vielschichtigkeit, die kulturwissenschaftlichen und insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>konstruktivistischen Ansätzen<br />
zugrun<strong>de</strong> liegt, schwer in regelbasierte, <strong>de</strong>terministische Computersysteme übersetzen lassen, da<br />
informatische Artefakte eher mit einem regelhaften sozialen Verhalten kompatibel sind: „Every socially<br />
intelligent machine we can dream of is still based on rule-oriented behavior. Therefore it is rule-oriented<br />
social behavior that is at the core of theoretical approaches, concepts and practices of software agent<br />
researchers and roboticists. The kind of rule might differ in diverse strands of AI, but a standardization of<br />
human behavior is a precondition for every computer mo<strong>de</strong>l and software application“ (Weber/ Bath 2007,<br />
59).<br />
156
differenzierten Analysen insgesamt wichtige Argumentationshilfen dafür zur Verfügung,<br />
dass das Design <strong>de</strong>r Computerspielfiguren aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive<br />
stärker reflektiert wer<strong>de</strong>n muss.<br />
In ihren Implikationen für die Informatik ein<strong>de</strong>utiger erscheinen <strong>de</strong>mgegenüber<br />
soziologisch bzw. psychologisch verankerte Studien zu Avataren, mit <strong>de</strong>nen sich<br />
NutzerInnen nicht nur in Multi-User-Spielen, son<strong>de</strong>rn auch in Zusammenarbeitsumgebungen<br />
verkörpern können. Valeska Lübke (2005) untersuchte beispielsweise Bil<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Kategorie Fantasie auf <strong>de</strong>r ältesten <strong>de</strong>utschen Website über Avatare,<br />
www.avatarpage.<strong>de</strong>, und stellt fest, dass die Figuren hinsichtlich ihrer grafischen<br />
Repräsentation vornehmlich Stereotype bedienen. So hätten über die Hälfte <strong>de</strong>r<br />
Männer repräsentieren<strong>de</strong>n Avatare eine Gesichtsbehaarung und wiesen eine ernste<br />
und kämpferische Mimik auf. Viele seien darüber hinaus mit Waffen o<strong>de</strong>r Werkzeugen<br />
ausgerüstet. Demgegenüber hätten mehr als 80% <strong>de</strong>r Frauen repräsentieren<strong>de</strong>n<br />
Avatare langes Haar, knapp die Hälfte trage tief ausgeschnittene Kleidung und sei<br />
stark geschminkt. Auch die Mimik <strong>de</strong>r Figuren sei zweigeschlechtlich geprägt. Die<br />
Mehrzahl <strong>de</strong>r Avatarfrauen blicke lächelnd, freundlich o<strong>de</strong>r lasziv. Zwar wer<strong>de</strong> eine<br />
nicht geringe Anzahl Frauen repräsentieren<strong>de</strong>r Avatare entgegen <strong>de</strong>n vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
Geschlechtserwartungen kämpferisch inszeniert, jedoch bedienten diese virtuellen<br />
Figuren an<strong>de</strong>re „weibliche“ Stereotype umso mehr (Lübke 2005, 77f). Avatarkörper<br />
müssten zwar – insbeson<strong>de</strong>re innerhalb <strong>de</strong>r Kategorie Fantasie – nicht notwendigerweise<br />
mit bestehen<strong>de</strong>n materiellen Körperlichkeiten korrespondieren, so könnten<br />
Frauen mit Brusthaaren, Muskeln und Lanzen ausgestattet wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Männer sich<br />
mit Brüsten, Klei<strong>de</strong>rn und langen Haaren präsentieren. Jedoch zeigt Lübkes<br />
Bildanalyse, dass sich die Konstruktion <strong>de</strong>r Avatare eher an vorherrschen<strong>de</strong>n Stereotypen<br />
orientiert, welche oft sogar noch überzeichnet wür<strong>de</strong>n.<br />
Während diese Untersuchung auf das Aussehen <strong>de</strong>r Avatare fokussiert, fragen<br />
an<strong>de</strong>re Studien danach, welches Avatargeschlecht Frauen und Männer als NutzerInnen<br />
wählen bzw. wie sie dieses gestalten. Demnach statteten sowohl Frauen wie auch<br />
Männer ihre Avatare in Spielszenarien mit „männlich“ kodiertem Anfor<strong>de</strong>rungsprofil<br />
vorwiegend mit maskulinen Eigenschaften und in solchen mit weiblichem Anfor<strong>de</strong>rungsprofil<br />
überwiegend mit femininen Eigenschaften aus (vgl. Trepte 2009) Dennoch<br />
wür<strong>de</strong>n sowohl Frauen wie auch Männer generell dazu tendieren, Avatare <strong>de</strong>r eigenen<br />
Genusgruppe zu wählen. Daraus schließen die AutorInnen, dass bei <strong>de</strong>r Wahl <strong>de</strong>s<br />
Avatars in <strong>de</strong>r Regel eine Mischstrategie verfolgt wer<strong>de</strong>, bei <strong>de</strong>r zwischen Anfor<strong>de</strong>rungsprofil<br />
<strong>de</strong>s Spiels und Anlehnung an die geschlechtliche Verortung <strong>de</strong>r NutzerIn<br />
abgewogen wer<strong>de</strong>. Weitere empirische Untersuchungen belegen ferner, dass sehr<br />
spezifische Repräsentationen <strong>de</strong>s Selbst bevorzugt wer<strong>de</strong>n und diese Muster je nach<br />
Kontext, Land und Kultur variieren. In <strong>einer</strong> Internet-basierten Flirtumgebung etwa<br />
wählten KroatInnen eher extrovertierte digitale Charaktere, die BritInnen dagegen introvertierte,<br />
während die Grenze zwischen introvertierten und extrovertierten StellvertreterInnen<br />
in Österreich entlang <strong>de</strong>r Geschlechtergrenzen verlief (vgl. Krenn/ Gstrein<br />
2006). Die NutzerInnen <strong>de</strong>r untersuchten Online-Flirtgemeinschaft inszenierten sich als<br />
„friends and family loving, home oriented females and two groups of males, the one<br />
group characterizes as friends and family loving, serious worker and good spouses<br />
(CRO, AUT), and the other one are impulsive, action and technical oriented individuals<br />
(UK).“ (ebd. 4).<br />
157
Diese konservative, <strong>de</strong>m vorherrschen<strong>de</strong>n System <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit<br />
konforme Repräsentation <strong>de</strong>s Selbst ist sicherlich <strong>de</strong>m speziellen Zweck <strong>de</strong>r<br />
Onlineumgebung, <strong>de</strong>m Flirten und Kennenlernen von PartnerInnen <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Genusgruppe, geschul<strong>de</strong>t. Jedoch fin<strong>de</strong>t sich ebenso wenig in <strong>de</strong>r Interaktion mit<br />
virtuellen Menschen ein Durchbrechen vorherrschen<strong>de</strong>r Geschlechterarrangements<br />
und <strong>de</strong>r heterosexuellen Norm. So ermittelten De Angeli und Brahnam (2006), dass<br />
„weiblich“ kodierte Chatterbots fast doppelt so häufig auf sexuelle Themen angesprochen<br />
wer<strong>de</strong>n wie „männlich“ dargestellte Figuren, wobei erstere häufig aggressive<br />
Angebote bekämen, die bis an Vergewaltigungen grenzten und sexuelle Phantasien<br />
evozierten. Die Autorinnen werfen am En<strong>de</strong> die Frage auf, welchen Effekt die<br />
Stereotype, die <strong>de</strong>n virtuellen Menschen eingeschrieben seien, auf die Wahrnehmung<br />
realer Menschen haben wer<strong>de</strong>n: „would the increase in disinhibition extend to real<br />
women?“ (ebd., 4).<br />
Genau diese Frage verweist bereits auf Grenzen solcher aufs Empirische beschränkten<br />
Studien, welche die Problematik <strong>de</strong>r Übergänge zwischen Körperempfin<strong>de</strong>n<br />
(Leib) und Körperverständnissen <strong>einer</strong>seits und Körperrepräsentationen im Netz<br />
an<strong>de</strong>rerseits offen lassen. Um die Resultate <strong>de</strong>r Analysen vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s in<br />
dieser Arbeit gewählten Ansatzes lesen zu können, bedürften sie sowohl <strong>einer</strong> klaren<br />
Kontextualisierung als auch <strong>einer</strong> tiefer gehen<strong>de</strong>n Theoretisierung. Zum einen sind die<br />
Rahmenbedingungen <strong>de</strong>r jeweiligen Studie genau klarzustellen (Wur<strong>de</strong> ein Abenteuerspiel<br />
untersucht, eine virtuelle Umgebung, in <strong>de</strong>r das primäre Ziel in Kommunikation<br />
und Kontakt besteht o<strong>de</strong>r geht es um eine professionelle Zusammenkunft im beruflichen<br />
Kontext, über die Geschäftliches geklärt wer<strong>de</strong>n soll? 220 Ist <strong>de</strong>r Gegenstand <strong>de</strong>r<br />
Untersuchung eine pädagogische AgentIn, eine persönliche AssistentIn o<strong>de</strong>r eine<br />
MarketingberaterIn? In welchem kulturellen Kontext fand die Untersuchung statt? Wie<br />
war die Gruppe <strong>de</strong>r Testpersonen zusammengesetzt?) Zum zweiten ist darzulegen,<br />
welche Wahlmöglichkeiten die NutzerInnen bei <strong>de</strong>r Gestaltung ihres Avatars haben<br />
(Tritt ihnen ein „fertiger“ virtueller Mensch gegenüber, gibt es klar <strong>de</strong>finierte Spielcharaktere<br />
o<strong>de</strong>r eine Reihe vorgefertigter, digitaler StellvertreterInnen, die zur Auswahl<br />
stehen? Können diese modifiziert wer<strong>de</strong>n? Mit welchem Aufwand? O<strong>de</strong>r ist es möglich,<br />
mit selbst kreierten Figuren am Spiel teilzunehmen?). Ferner sind Fragestellungen und<br />
theoretische Grundlagen <strong>de</strong>r Untersuchung offen zu legen (Soll die mangeln<strong>de</strong><br />
Attraktivität eines Spiels/ von Computerspielen generell für Frauen nachgewiesen<br />
wer<strong>de</strong>n? Wird die Nutzung aus <strong>einer</strong> Perspektive <strong>de</strong>r <strong>de</strong>/konstruktivistischen<br />
Geschlechterforschung o<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r von Geschlechterdifferenz 221 untersucht? Geht es<br />
primär um eine Analyse o<strong>de</strong>r um eine bessere – z.B. technische und grafische –<br />
Gestaltung <strong>de</strong>r Avatare? Und zu welchem Zweck? 222 Wird „Qualität“ dabei eher anhand<br />
220 Es ist anzunehmen, dass im beruflichen Kontext weitaus geschlechtsneutralere virtuelle Stellvertreter-<br />
Innen gewählt wer<strong>de</strong>n als im Kontext von Abenteuerspielen.<br />
221 Am Beispiel <strong>de</strong>r Hirnforschung wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>n „publication bias“ (Dickersin/ Min 1993) hingewiesen,<br />
dass Resultate empirischer Studien, die signifikante Unterschie<strong>de</strong> zwischen Männern und Frauen belegen,<br />
nicht nur in populären Medien, son<strong>de</strong>rn auch in Fachzeitschriften eher veröffentlicht wer<strong>de</strong>n als solche, die<br />
auf einen Nicht-Unterschied, also eine Egalität hinweisen; vgl. dazu Nikoleyczik 2004, 139.<br />
222 Khan und De Angeli 2007 berichten etwa von <strong>einer</strong> Studie (Baylor 2004) über als „weiblich“ inszenierte<br />
AgentInnen, die Ingenieure darstellen und gleichzeitig sehr attraktiv und extrovertiert inszeniert sind. Der<br />
Autorin zufolge sollen diese das Interesse von Stu<strong>de</strong>ntInnen an <strong>de</strong>n Ingenieurwissenschaften signifikant<br />
gesteigert haben im Vergleich zu <strong>de</strong>r eher stereotypen Darstellung eines unansehnlichen und sehr<br />
158
kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse, empirischer Nutzungsstudien o<strong>de</strong>r<br />
feministischer bzw. zweigeschlechtlichkeits<strong>kritisch</strong>er Ziele festgemacht?)<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Konzepts <strong>de</strong>r posthumanistischen Performativität von Geschlecht<br />
lässt sich die Kritik an <strong>de</strong>n Studien, die ihren Gegenstand objektivistisch verhan<strong>de</strong>ln, 223<br />
jedoch noch weiter treiben, gehen diese doch sowohl auf Seiten <strong>de</strong>r untersuchten<br />
Avatare als auch auf Seiten <strong>de</strong>r befragten NutzerInnen stets von <strong>einer</strong> klaren Zweigeschlechtlichkeit<br />
aus. 224 Mit <strong>de</strong>n in Kapitel 3 entwickelten theoretischen Grundlagen<br />
wäre dagegen zu fragen, wie Technik und Geschlecht „gemacht wer<strong>de</strong>n“ und diese<br />
Prozesse ineinan<strong>de</strong>r verzahnt sind, wie auch Clau<strong>de</strong> Drau<strong>de</strong> betont: „when it comes to<br />
gen<strong>de</strong>r and related issues within the field of ECA 225 <strong>de</strong>sign one way of addressing<br />
these is to ask for example how men in contrast to women <strong>de</strong>al with the agent – or<br />
which pre<strong>de</strong>termined gen<strong>de</strong>r or ethnicity the <strong>de</strong>signer should ascribe to the agent for<br />
best results […] Another way of approaching gen<strong>de</strong>r, however, is to look at the role of<br />
the productive character of gen<strong>de</strong>r and other categories play within <strong>de</strong>sign engineering<br />
processes themselves“ (Drau<strong>de</strong> 2006, o.S.). Es gilt somit zu fragen, welches (explizite<br />
o<strong>de</strong>r implizite) Wissen über Geschlecht und Körper in die Konstruktion <strong>de</strong>r<br />
informatischen Artefakte eingeht und auf welchen epistemologisch-ontologischen<br />
Prämissen die technische Gestaltung beruht.<br />
Im Bereich <strong>de</strong>r HCI und Informatik dominieren gemäß <strong>de</strong>r wissenschaftstheoretischen<br />
Grundhaltung eher quantitativ ausgerichtete Studien, die auf die Wahrnehmung<br />
und Akzeptanz ausgewählter Prototypen, Bil<strong>de</strong>r und Charaktere bei <strong>de</strong>n NutzerInnen<br />
fokussieren. Inspiriert von <strong>de</strong>r „Computer are social actors“-These wird dabei häufig<br />
davon ausgegangen, dass Menschen mit Computern umgehen, so als ob sie mit Menschen<br />
interagieren wür<strong>de</strong>n (vgl. Reeves/ Nass 1996, Nass et al. 1997). 226 Insbeson<strong>de</strong>re<br />
eine menschliche Gestalt auf <strong>de</strong>m Bildschirm trage dazu bei, dass NutzerInnen<br />
eine persönliche Beziehung zum technischen Artefakt aufzubauen vermögen (vgl. etwa<br />
Biocca 1997, Schroe<strong>de</strong>r 2002). Eine essentielle Frage dieser Forschungsrichtung ist,<br />
welche Merkmale, Eigenschaften und Darstellungen die Avatare glaubwürdig und<br />
überzeugend erscheinen lassen – sei es, um sie als Verkörperungen <strong>de</strong>r InteraktionspartnerInnen<br />
zu akzeptieren o<strong>de</strong>r ihnen als BeraterInnen im Marketing zu vertrauen<br />
bzw. von ihnen als TutorInnen im ELearning zum Lernen motiviert zu wer<strong>de</strong>n. Was<br />
verleiht <strong>de</strong>n virtuellen Figuren <strong>de</strong>n Anschein <strong>de</strong>r Lebendigkeit, Natürlichkeit und<br />
Menschlichkeit?<br />
In <strong>de</strong>r Forschung zu anthropomorphen Softwareagenten wird mittlerweile davon<br />
ausgegangen, dass die Kategorie Geschlecht – wie bei zwischenmenschlichen Interak-<br />
introvertierten virtuellen Nerds. Sie verfolgt damit offenbar ein an<strong>de</strong>res Ziel als die Glaubwürdigkeit <strong>de</strong>r<br />
Figur herzustellen.<br />
223 Dabei ist häufig zu beachten, dass diese Untersuchungen mit nur <strong>einer</strong> geringen Anzahl von<br />
Testpersonen durchgeführt wur<strong>de</strong>n, die noch dazu meist Studieren<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entsprechen<strong>de</strong>n Faches sind,<br />
und damit nicht die suggerierte Repräsentativität erfüllen. Dies wird mittlerweile jedoch im Feld selbst<br />
bereits thematisiert, vgl. etwa Isbister/ Doyle 2004.<br />
224 Beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich wird dies etwa anhand <strong>de</strong>s Ergebnisses <strong>einer</strong> Studie, dass Männer als<br />
Testpersonen als „weiblich“ repräsentierte Avatare überzeugen<strong>de</strong>r fän<strong>de</strong>n und Frauen die als „männlich“<br />
repräsentierten virtuellen Figuren, vgl. Zanbaka et al. 2006.<br />
225 ECAs steht für „Embodied Conversational Agents“, die hier als anthropomorphe Softwareagenten<br />
bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Für eine Definition von ECAs vgl. etwa Cassell et al. 2000.<br />
226 In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass <strong>de</strong>r betrachtete Forschungsstrang gera<strong>de</strong> nicht auf<br />
kultur- und medienwissenschaftliche Erkenntnisse rekurriert, die an eine geschlechtertheoretische<br />
Perspektive anschlussfähig wären, son<strong>de</strong>rn vielmehr auf die Psychologie und Kognitionswissenschaften.<br />
159
tion – auch in <strong>de</strong>r Interaktion zwischen Mensch und Computer und <strong>de</strong>r computervermittelten<br />
Kommunikation eine wesentliche Rolle spielt. Empirischen Untersuchungen<br />
zufolge seien virtuelle Menschen, <strong>de</strong>ren grafisches Erscheinungsbild stark<br />
vergeschlechtlicht ist, überzeugen<strong>de</strong>r als androgyne bzw. geschlechtslose Wesen,<br />
Tiere o<strong>de</strong>r Phantasiefiguren. „An avatar may only be perceived to be anthropomorphic<br />
if its gen<strong>de</strong>r is clearly indicated“ (Nowak/ Rauh 2005, o.S.). Mehr noch scheint die<br />
erkennbare Geschlechtlichkeit für die Attraktivität und Glaubwürdigkeit <strong>de</strong>r Figuren<br />
wichtiger als <strong>de</strong>ren Menschenähnlichkeit: „Previous research has implied that anthropomorphism<br />
would be the main predictor of credibility or attractiveness, but this was<br />
not the case in the present study. Avatars that were more anthropomorphic were<br />
perceived to be more attractive and credible, and people were most likely to choose to<br />
be represented by them. The strongest predictor, however, was the <strong>de</strong>gree of<br />
masculinity and feminity (lack of androgyny) of an avatar. Further, those images with<br />
strong gen<strong>de</strong>r indications (either more masculine or more feminine) were perceived as<br />
more anthropomorphic than images (human or not) without strong indications of<br />
gen<strong>de</strong>r“ (ebd., o.S.).<br />
Verschie<strong>de</strong>ne Studien <strong>de</strong>uten darauf hin, dass insbeson<strong>de</strong>re stereotype Geschlechtsrepräsentationen<br />
die künstliche Figur glaub- und vertrauenswürdiger machen,<br />
ihr mithin Menschlichkeit verleihen (Morena et al. 2002, Lee 2003, Kim et al. 2007).<br />
Dazu passt, dass als „weiblich“ inszenierte Figuren darin als effektiver gelten, Frustrationen<br />
bei <strong>de</strong>n NutzerInnen zu reduzieren (vgl. Hone 2006).<br />
Analysen anthropomorpher Softwareagenten zeigen ferner, dass die Designer <strong>de</strong>r<br />
Figuren hinsichtlich <strong>de</strong>r Überzeugungsfähigkeit unterschiedliche Meßlatten anlegen,<br />
<strong>de</strong>nn die „weiblich“ kodierten Agenten wer<strong>de</strong>n sehr viel häufiger photorealistisch<br />
dargestellt als ihre als „männlich“ dargestellteh Pendants (vgl. etwa Khan/ De Angeli<br />
2007). 227 Dies steht nur scheinbar im Wi<strong>de</strong>rspruch zu <strong>de</strong>n Ergebnissen von<br />
Gustavsson 2005, die im letzten Abschnitt 4.2.4. dargestellt wur<strong>de</strong>n. Denn Gustavsson<br />
untersuchte primär kommerzielle Webseiten, bei <strong>de</strong>nen die virtuellen Menschen als<br />
DienstleisterInnen auftreten, während Khan und De Angeli auf wissenschaftliche<br />
Quellen und die dort entwickelten Prototypen fokussierten. Repräsentierten die<br />
fotounrealistischen Agentinnen eher die anonyme, unsichtbare Dienstleistungsarbeit,<br />
d.h. das gesellschaftliche Muster geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung, so lassen<br />
sich die fotorealistischen Darstellungen als Ausdruck eines allgemeinen sexistischen<br />
Frauenbilds lesen. Letzteres wird auch in Studien über Computerspiele belegt, in<br />
<strong>de</strong>nen Jugendliche, egal welchen Geschlechts, als Repräsentanten ihrer Selbst<br />
insbeson<strong>de</strong>re hypersexualisierte „weiblich“ inszenierte Avatare bevorzugten (vgl.<br />
Waern et al. 2005). Dass die Überzogenheit <strong>de</strong>r „weiblich“kodierten Körperdarstellung<br />
nicht infrage gestellt wird, spiegelt <strong>de</strong>n Autorinnen zufolge wi<strong>de</strong>r, dass hypersexualisierte<br />
Frauendarstellungen u.a. durch ihre Verbreitung im öffentlichen Raum, wie <strong>de</strong>r<br />
Werbung, zur vorherrschen<strong>de</strong>n Norm bei <strong>de</strong>r Repräsentation von Frauen gewor<strong>de</strong>n<br />
seien. Allgemeine Vorstellungen über stereotype Personen (z.B. die Tussi o<strong>de</strong>r die<br />
zugeknöpfte Lehrerin) prägten die Wahrnehmung <strong>de</strong>r Figuren auf <strong>de</strong>m Bildschirm,<br />
227 Dabei unterschei<strong>de</strong>n Khan und De Angeli vier verschie<strong>de</strong>ne Gra<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Anthropomorphisierung: a) Cartoonzeichnungen,<br />
die z.T. zu karikaturistischen Darstellungen neigen b) 2-dimensionale Zeichnungen, c)<br />
3-dimensionale Repräsentationen und d) photorealistische Darstellungen, vgl. Khan/ De Angeli 2007, 150.<br />
160
<strong>de</strong>nen aufgrund ihres Aussehens und ihrer Kleidung oft eine entsprechen<strong>de</strong> stereotype<br />
Persönlichkeit zugeschrieben wer<strong>de</strong> (vgl. Larsson/ Nerén 2005).<br />
Sämtliche <strong>de</strong>r bis hierher rezipierten empirischen Untersuchungen belegen somit<br />
eine Fortsetzung vorherrschen<strong>de</strong>r geschlechtsstereotyper Muster auf <strong>de</strong>r Bildschirmoberfläche,<br />
die teilweise noch überzeichnet wer<strong>de</strong>n. Sie lassen sich jedoch im besten<br />
Falle als Rekonstruktionen <strong>de</strong>r Herstellung von Geschlecht lesen, nicht aber als<br />
Untersuchungen <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht, da von bereits<br />
vorgefertigten, feststehen<strong>de</strong>n technischen Artefakten ausgegangen wird.<br />
Als eine <strong>de</strong>r wenigen Ausnahmen geht Sara John (2006) über solche NutzerInnenstudien<br />
und Analysen <strong>de</strong>r äußerlichen Erscheinung von Avataren hinaus, in<strong>de</strong>m sie die<br />
übersexualisierten Figuren zurück zu ihrem Entstehungsort verfolgt. Anhand von Beobachtungsstudien<br />
in <strong>de</strong>r Spieleindustrie konnte sie aufzeigen, dass Entwickler in ihrem<br />
Bestreben, das beste Abenteuerspiel zu entwickeln, Männer repräsentieren<strong>de</strong> Charaktere<br />
anatomisch korrekt gestalteten (im Gegensatz zu einem Superhel<strong>de</strong>n-Design) und<br />
darüber im Team Einstimmigkeit bestand, während sich über die Darstellung <strong>de</strong>r<br />
einzigen eine Frau repräsentieren<strong>de</strong>n Figur ein Disput entspann. Die Figur sollte<br />
attraktiv und sexy sein, jedoch entsprach k<strong>einer</strong> <strong>de</strong>r realistisch gezeichneten Entwürfe<br />
diesem Anspruch <strong>de</strong>r Entwickler. Am En<strong>de</strong> fand <strong>de</strong>r Grafik<strong>de</strong>signer zwar einen<br />
„character that looked tremendously good“ (John 2006, o.S.). Nichts<strong>de</strong>stotrotz seien<br />
ihre Beine verlängert und verzerrt, d.h. anatomisch inkorrekt dargestellt wor<strong>de</strong>n, um die<br />
Figur – so John – letztendlich an männliche Phantasien und <strong>de</strong>n implizit als männlich,<br />
weiß und heterosexuell imaginierten Nutzer anzupassen.<br />
Angesichts möglicher Rückwirkungen solcher Darstellungen auf das eigene<br />
Körperverständnis und die Körperwahrnehmung, die in <strong>de</strong>r heutigen Zeit nicht<br />
unabhängig von <strong>de</strong>n Versprechen <strong>de</strong>r chirurgischen Schönheitsindustrie gesehen<br />
wer<strong>de</strong>n können (vgl. etwa Es<strong>de</strong>rs 2003, 196), erscheint eine <strong>kritisch</strong>e feministische<br />
Intervention in die gängigen Praktiken technischer Konstruktion virtueller Verkörperungen<br />
dringend notwendig. Einige <strong>de</strong>r referierten Studien schlagen <strong>de</strong>shalb vor, eine<br />
Vielfalt von Körpermo<strong>de</strong>llen zur Selbstrepräsentation anzubieten sei: „<strong>de</strong>signers should<br />
continue to provi<strong>de</strong> a variety of choices. This would not only increase user satisfaction,<br />
but also could provi<strong>de</strong> useful information about people in online interactions. Finally,<br />
providing minorities, such as Hispanic and African American, choices of avatars that<br />
match their ethnicity or race make them feel more comfortable and may also help to<br />
prevent marginalizing minorities and other disenfranchised groups in online<br />
environments by making them obvious, visible participants“ (Nowak/ Rauh 2005, o.S.).<br />
An<strong>de</strong>re Empfehlungen an die DesignerInnen richten sich gegen die übersexualisierten<br />
Figuren und regen statt<strong>de</strong>ssen zu <strong>einer</strong> geschlechtsneutraleren Darstellung an. 228<br />
Solche Vorschläge erscheinen zunächst als ein guter Ausgangspunkt für ein alternatives<br />
Design, das auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r Artefakte zielt. Allerdings gehen sie<br />
ebenfalls von einem fertigen technischen Produkt aus statt vom Herstellungsprozess<br />
und beschränken sich auf die äußerliche Gestalt. Nicht berücksichtigt wer<strong>de</strong>n dabei<br />
performative Aspekte <strong>de</strong>r Avatare, die über die sprachliche (i.d.R. textbasierte)<br />
Interaktion mit <strong>de</strong>n Figuren Geschlecht herzustellen vermögen. Auf dieser Folie rückt<br />
228 Beispielsweise empfehlen Heike Wiesner et al. 2004a, b in ihrem Leitfa<strong>de</strong>n zum Gen<strong>de</strong>rmainstreaming<br />
in ELearning-Umgebungen, virtuelle AssistentInnen, Avatare und Comicfiguren zweigeschlechtlich ausgewogen<br />
zu repräsentieren und geschlechtsneutrale Figuren zu wählen.<br />
161
Lübke im Vergleich zu <strong>de</strong>n plakativen Beispielen <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Körpers durch<br />
die plastische Chirurgie weniger spektakuläre, womöglich jedoch tiefer gehen<strong>de</strong><br />
Wirkungen von Avataren auf das Körperempfin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Blick. Sie argumentiert, dass<br />
bereits die textbasierte Kommunikation im Internet Effekte auf <strong>de</strong>r leiblich-sinnlichen<br />
Ebene hätte: „Virtuelle Erfahrungen wirken auf gelebte Körper: sie beeinflussen die<br />
Körperoberflächengestaltung und berühren die leiblich-affektive Körperebene. […] In<br />
<strong>de</strong>m Moment, in <strong>de</strong>m ‚Daten‘ in <strong>de</strong>r leiblich-subjektiven Körperdimension Platz fin<strong>de</strong>n,<br />
in <strong>de</strong>m Moment sind sie auch sinnlich erfahrbar und lassen die Grenzen zwischen<br />
Virtualität und Realität fragwürdig erscheinen.“ (Lübke 2005, 80)<br />
Angesichts dieser Erkenntnisse, die durch die (feministische) kultur- und medienwissenschaftliche<br />
Forschung gestützt wer<strong>de</strong>n, 229 stellt sich zum einen die Frage, ob<br />
Leitfä<strong>de</strong>n mit einfachen Regeln, wie Technologien gestaltet wer<strong>de</strong>n sollten, genügen,<br />
um aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive unerwünschte Effekte auf das Erleben<br />
– im virtuellen wie im realen Raum – zu vermei<strong>de</strong>n. 230 Zum zweiten bleibt offen,<br />
inwiefern durch die virtuelle Verkörperung nicht nur eine Zementierung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
strukturell-symbolischen Geschlechterordnung stattfin<strong>de</strong>t, son<strong>de</strong>rn ein Aufbrechen<br />
zweigeschlechtlicher Muster möglich wird.<br />
Lübkes Analyse textbasierter und verkörperter Kommunikation geht insgesamt von<br />
<strong>de</strong>n frühen, euphorischen feministischen Debatten um das Internet aus, in <strong>de</strong>nen das<br />
neue Medium als ein Experimentierraum und „Laboratorium für I<strong>de</strong>ntitätskonstruktionen“<br />
gefeiert wur<strong>de</strong> (vgl. hierzu auch Kapitel 2.2.). Denn schon lange bevor verkörperte<br />
Repräsentationen <strong>de</strong>r NutzerInnen technisch möglich waren, hatte Amy Bruckman das<br />
Internet, insbeson<strong>de</strong>re textbasierte Chats und MUDs, 231 als eine „I<strong>de</strong>ntitätswerkstatt“<br />
beschrieben, in <strong>de</strong>m das Erproben neuer sozialer Rollen möglich gewor<strong>de</strong>n ist (vgl.<br />
Bruckman 1992). Dieses Spiel mit <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität hat auch vor <strong>de</strong>n ansonsten streng<br />
gehüteten Geschlechtergrenzen nicht halt gemacht, wie die Option <strong>de</strong>s virtuellen<br />
Gen<strong>de</strong>r-Swappings bzw. Gen<strong>de</strong>r-Bendings, <strong>de</strong>m Auftreten im Netz mit <strong>einer</strong> neuen<br />
geschlechtlichen o<strong>de</strong>r sexuellen I<strong>de</strong>ntität, belegt. Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre griffen<br />
Feministinnen diese Verheißungen auf. Seither wur<strong>de</strong> das Internet immer wie<strong>de</strong>r als<br />
ein i<strong>de</strong>aler Raum beschworen, in <strong>de</strong>m überkommene Geschlechts- und Sexualitätskonzeptionen<br />
endgültig überwun<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Körper wie auch Geschlechtlichkeit reinszeniert<br />
wer<strong>de</strong>n könne (vgl. Bruckman 1993, Reid 1994, Stone 1995). Mit <strong>de</strong>m<br />
Aufkommen digitaler Verkörperung, welche die textbasierte Kommunikation um eine<br />
non-verbale Ebene <strong>de</strong>r Interaktion ergänzt, stellt sich – wie auch Lübke im Einklang mit<br />
<strong>de</strong>m hier gewählten performativen Ansatz betont – die Frage, ob hier eine „Welt nach<br />
<strong>de</strong>n Geschlechtern“ entsteht, neu. „Die ‚digitalen Sprecher‘ bieten sich […] an, subversiv<br />
die alltagstheoretischen Grundannahmen <strong>einer</strong> bipolar, heterosexuell organisierten<br />
Geschlechterwelt in Frage zu stellen. Als Neuschaffungen jenseits <strong>de</strong>r Kategorie<br />
Mensch, könnten sie als frei von irdischen Geschlechterkonstruktionen und<br />
Körperkonzepten konstruiert wer<strong>de</strong>n. Legt man die Butlerschen Annahmen zu Grun<strong>de</strong>,<br />
besitzen konversationsfähige Avatare das Potential, Repetitionen zu variieren und<br />
229<br />
Vgl. etwa Stone 1991, Featherstone/ Burrows 1995, Esposito 2003.<br />
230<br />
Diese Frage wird im nächsten Kapitel 5 über die Möglichkeiten <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring wie<strong>de</strong>r ausgegriffen<br />
und ausführlicher diskutiert.<br />
231<br />
MUDs= Multi User Dungeons (o<strong>de</strong>r Domains) sind Rollenspiele, die auf einem zentralen Server laufen<br />
und über das Internet vermittelt von mehreren Anwen<strong>de</strong>rInnen gleichzeitig gespielt wer<strong>de</strong>n können.<br />
162
normative Geschlechterrituale aufzubrechen, weil sie, so <strong>de</strong>nn es ihre Programmierung<br />
erlaubt, ihr ‚Innen‘ nicht auf ihre ‚Erscheinung’ anpassen müssen“ (Lübke 2005, 180).<br />
Lübke hat nicht nur das Aussehen verkörperter Chatbots genauer untersucht,<br />
son<strong>de</strong>rn ihr interaktives Gesprächsverhalten aus <strong>einer</strong> Geschlechtsperspektive empirisch<br />
qualitativ überprüft. Dabei wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass die Charaktere stark vergeschlechtlichte<br />
Interaktionsmuster zeigen. Der „männlich“ inszenierte Agent begegnete<br />
Frauen sehr freundlich, ebenso wie sein Flirtverhalten vorherrschen<strong>de</strong>n Stereotypen<br />
über Männer entsprach. Dagegen verhielt er sich Männern gegenüber eher<br />
kumpelhaft. Während er auf das Thema Homosexualität „politisch korrekt“ reagierte,<br />
kam in seinen anzüglichen Witzen, die sich vornehmlich auf Frauen bezogen, ein<br />
Sexismus zum Ausdruck, <strong>de</strong>r längst überholt geglaubte Klischees wie<strong>de</strong>r aufleben ließ.<br />
Die „weiblich“ inszenierte Agentin dagegen war mit Ermunterungsfloskeln,<br />
Hilfsangeboten, Selbstherabsetzungen und Abschwächungen (z.B. „ich glaube“), <strong>de</strong>r<br />
Verwendung <strong>de</strong>s Konjunktivs sowie fragen<strong>de</strong>n Gesprächseröffnungen ein „typisch<br />
weiblicher“ Sprachstil einprogrammiert. Sie errötet, zeigt Emotionen und verweigert die<br />
Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit sexuell bela<strong>de</strong>nen Themen. Im Vergleich zum „männlichen“<br />
Chatbot, <strong>de</strong>r humorvoll auf Beschimpfungen reagierte, setzte sie sich we<strong>de</strong>r zur Wehr,<br />
noch leitete sie Ausweichmanöver ein, wenn sie mit Vulgärausdrücken attackiert<br />
wur<strong>de</strong>. Ihre Hintergrundgeschichte zeichnet darüber hinaus aufgrund <strong>de</strong>r Zufrie<strong>de</strong>nheit<br />
mit ihren Rollen als Partnerin und Mutter ein Bild heiler Familienwelt, womit sie Lübke<br />
zufolge eine Persönlichkeit verkörpert, die Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse<br />
beim Gegenüber weckt (ebd., 197). Die einzige Irritation in Bezug auf vorherrschen<strong>de</strong><br />
Glaubensvorstellungen bestün<strong>de</strong> darin, dass sie 24 Stun<strong>de</strong>n am Tag arbeitet und die<br />
Erziehungsarbeit ihrem Mann überließ. Ihre Repräsentation ergänze die bereits<br />
an<strong>de</strong>rorts i<strong>de</strong>ntifizierten Weiblichkeitsmuster <strong>de</strong>s „unnatürlichen Supermo<strong>de</strong>lls“ und <strong>de</strong>r<br />
„Business-Frau“ (vgl. Bath 2001a) um ein weiteres für virtuelle Frauen typisches: <strong>de</strong>n<br />
„unscheinbaren Charakter“ (Lübke 2005, 214). 232<br />
Die bei<strong>de</strong>n untersuchten AgentInnen entsprechen in ihrem „doing gen<strong>de</strong>r“ somit<br />
zwar nicht überzogenen, wohl aber allgemein vorherrschen<strong>de</strong>n Geschlechtervorstellungen.<br />
Lübke arbeitet ferner heraus, dass die Figuren zugleich menschlich erscheinen<br />
und I<strong>de</strong>ntifikationspotentiale für die NutzerInnen bieten. Die Menschlichkeit <strong>de</strong>s „weiblich“<br />
inszenierten Charakters wer<strong>de</strong> durch ihren Familienbezug unterstützt, während<br />
die „männlich“ inszenierte Figur von <strong>einer</strong> gescheiterten Beziehung und s<strong>einer</strong><br />
Einsamkeit berichtete und gera<strong>de</strong> durch offen gelegte Schwächen Sympathie hervorrufe.<br />
Ferner sei <strong>de</strong>m Interaktionsverhalten <strong>de</strong>s virtuellen Mannes (namens Leo) eine<br />
Orientierung an Erwartungs-Erwartungen einprogrammiert, die <strong>de</strong>n Anschein, mit<br />
einem menschlichen Gegenüber zu kommunizieren, verstärkt: „Leo erwartet, dass <strong>de</strong>r<br />
User/ die Userin erwartet, dass Leo erwartet, dass er sein Verhalten vom Verhalten<br />
<strong>de</strong>s Users/ <strong>de</strong>r Userin abhängig macht. Es zeigt sich, dass die Grenzen zwischen<br />
menschlicher Kommunikation und Mensch-Maschine-Kommunikation fließend wer<strong>de</strong>n.“<br />
(Lübke 2005, 207). Die Autorin schließt daraus, dass <strong>de</strong>n anthropomorphen<br />
232 Bemerkenswert, wenngleich nicht erstaunlich erscheint ferner, dass sich <strong>de</strong>r äußerlich geschlechtsneutrale<br />
Charakter, <strong>de</strong>r als Computer dargestellt wur<strong>de</strong>, bei genauerer Betrachtung als „typisch männlich“ erwies.<br />
Er zeigte ein sehr selbstsicheres und dominantes Verhalten. Sein Sprachregister verweist auf einen<br />
machtorientierten und kompetitiven Sprachstil. Lübke wertet dies als einen Beleg für die „Männlichkeit“ <strong>de</strong>s<br />
Computers, vgl. Lübke 2005, 216.<br />
163
Softwareagenten aus <strong>einer</strong> soziologischen Sicht ein zumin<strong>de</strong>st „episodischer<br />
Akteursstatus“ zuzusprechen ist. 233<br />
Sie hält in Bezug auf die Grenzüberschreitungen fest, dass die Übergänge zwischen<br />
Mensch und Maschine zunehmend verschwimmen. Künstliche Menschen wür<strong>de</strong>n<br />
offenbar nicht als eine Bedrohung wahrgenommen, son<strong>de</strong>rn könnten vielmehr als ein<br />
Indiz dafür gewertet wer<strong>de</strong>n, dass die Verwischung <strong>de</strong>r Grenze zwischen Mensch und<br />
Maschine, Natur und Kultur eine akzeptable ist (vgl. ebd., 223). Demgegenüber wer<strong>de</strong><br />
die Grenze zwischen „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ von <strong>de</strong>n technischen Artefakten<br />
streng überwacht – und das, obwohl im virtuellen Raum prinzipiell Geschlechterkonzeptionen<br />
jenseits <strong>de</strong>r alltagstheoretischen Vorstellungen möglich wären. 234 Die Realität<br />
<strong>de</strong>r im Netz verfügbaren Avatare zeigt allerdings – wie Lübkes Analyse und die ihrer<br />
KollegInnen ver<strong>de</strong>utlichten – alles an<strong>de</strong>re als Hoffnungen auf eine „Post-gen<strong>de</strong>r-Welt“<br />
an. 235 Mit <strong>de</strong>r Grenzüberschreitung zwischen Mensch und Maschine wer<strong>de</strong>n we<strong>de</strong>r<br />
vorherrschen<strong>de</strong> Vorstellungen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“, noch das Zweigeschlechtlichkeitsmo<strong>de</strong>ll<br />
an sich in Frage gestellt. 236 Bis hierher lässt sich somit<br />
insgesamt festhalten, dass Geschlecht nicht nur – wie in anfangs in diesem Kapitel 4.2.<br />
ver<strong>de</strong>utlicht wur<strong>de</strong> – vermittelt über Strukturen gesellschaftlicher Arbeitsteilung und<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Kompetenzzuschreibung in informatische Artefakte<br />
eingeschrieben, son<strong>de</strong>rn zugleich explizit als Geschlechtskörper in informatischen<br />
Artefakten repräsentiert wird. Wie am Beispiel von Avataren, Spielfiguren und<br />
künstlichen Menschen aufgezeigt, kann es auch direkt in Form von Annahmen über<br />
das Aussehen von Frauen und Männern sowie über ihr typisches Verhalten<br />
reproduziert wer<strong>de</strong>n.<br />
An dieser Stelle ist ausgehend vom Konzept <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung von Technik<br />
und Geschlecht weiter zu fragen, auf welchen Konzeptionen von Menschlichkeit die<br />
Artefakte basieren, wie diese entstehen und dabei mit <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht<br />
verschränkt wer<strong>de</strong>n. Insbeson<strong>de</strong>re aus <strong>einer</strong> Perspektive, die auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
von Technologien zielt, erscheint „a closer look at the productive character of gen<strong>de</strong>r<br />
itself before one applies it to the construction of technological artefacts“ (Drau<strong>de</strong> 2006,<br />
o.S.) unabdingbar. Solche Analysen erscheinen, wie Drau<strong>de</strong> weiter betont, höchst<br />
relevant vor <strong>de</strong>m Hintergrund, dass I<strong>de</strong>ntität in und durch Technologien konstruiert<br />
wird: „On the one hand, technology incorporates up to date un<strong>de</strong>rstandings of what is<br />
regar<strong>de</strong>d as human, of how social interactions are established and how communities<br />
233 Zur Diskussion <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit von technischen Artefakten vgl. Latour 1998 [1991], 2002<br />
[1999], Rammert/ Schulz-Schaeffer 2002a sowie die Ausführungen in <strong>de</strong>n Abschnitten 3.3 bis 3.6 und die<br />
dort angegebene Literatur.<br />
234 Beispielsweise hatte ich in Bath 2001a vorgeschlagen, Avatare zu konstruieren, die ihre Zugehörigkeit<br />
zu <strong>einer</strong> Genusgruppe während <strong>de</strong>r Interaktion wechseln (ggf. auch häufiger) o<strong>de</strong>r unterschiedliche<br />
Geschlechtsmarkierungen miteinan<strong>de</strong>r kombinieren (z.B. ein weiblicher Körper mit Bart und tiefer<br />
Stimme).<br />
235 Veronika Eisenrie<strong>de</strong>r 2003 kommt in ihrer empirischen Untersuchung <strong>de</strong>s Habitats WorldsAway zu<br />
einem ähnlichen Ergebnis, allerdings vor <strong>de</strong>m Hintergrund eines weniger elaborierten Bezugs auf<br />
Gen<strong>de</strong>rtheorien und die Mensch-Maschine-Grenzziehungen.<br />
236 Interessant erscheint, dass in manchen virtuellen Welten stärker an vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
Geschlechterkonstruktionen festgehalten wird als an <strong>de</strong>r heterosexuellen Norm, wie eine Studie über das<br />
Computerspiel The Sims belegt: „[The analysis] of the game has shown that it goes far beyond charges of<br />
‚widow dressing‘ that are often ma<strong>de</strong> in mainstream media’s treatment of gays, lesbians, and bisexuals<br />
[…] Avatar creation, while fixing gen<strong>de</strong>r and skin sha<strong>de</strong>, leaves sexuality untouched and therefore<br />
unmarked.“ (Consalvo 2003, 33), Die Autorin schließt daraus, dass in The Sims eine queere Welt<br />
entworfen wird: „Sexual orientation in The Sims is set adrift – <strong>de</strong>tached from i<strong>de</strong>ntity or essence – it is<br />
something one does rather than what one is“ (ebd., 34).<br />
164
work – on the other hand, technology itself influences these un<strong>de</strong>rstandings since it<br />
incorporates certain choices that have been favored over others.“ (ebd., o.S.) Demnach<br />
wäre <strong>de</strong>tailliert zu untersuchen, welche Konzepte von Interaktion, Kommunikation,<br />
Sozialität und Geschlecht <strong>de</strong>n virtuellen Verkörperungen eingeschrieben sind, wie<br />
diese bislang menschlichen Fähigkeiten mo<strong>de</strong>lliert und formalisiert wer<strong>de</strong>n und auf<br />
welchen wissenschaftstheoretischen Annahmen die technologische Gestaltung beruht.<br />
Ein solcher Zugang verweist praktisch-empirisch auf ethnografische Untersuchungen<br />
<strong>de</strong>s Forschungsfelds anthropomorpher Softwareagenten und theoretisch auf Fragen<br />
<strong>de</strong>r Epistemologie und Ontologie. Bisher haben jedoch erst wenige Studien versucht,<br />
solche <strong>de</strong>r Technologie eingeschriebenen (impliziten o<strong>de</strong>r expliziten) Konzepte an <strong>de</strong>n<br />
Ort ihrer Herstellung zurückzuverfolgen, so wie das John (2006) am Beispiel <strong>de</strong>r<br />
grafischen Verkörperung „weiblich“ inszenierter Figuren in Computerspielen vorgeführt<br />
hat. 237 Über die Avatare und Softwareagenten hinausgehend wird im nächsten<br />
Abschnitt 4.3 diskutiert, auf welche Weise und wie eng Abstraktion, Klassifizierung und<br />
Formalisierung mit <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r Geschlechter bei <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte verknüpft sind. Im Zuge <strong>de</strong>ssen wird auch die Diskussion über die<br />
Verkörperung, Sozialität und Menschenähnlichkeit <strong>de</strong>r Maschinen auf <strong>de</strong>r Basis<br />
feministischer Theorie und Erkenntnispolitik weiter geführt. 238<br />
4.3. Klassifizieren, Abstrahieren und Formalisieren: (Geschlechter-)Politik<br />
und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen<br />
„The computer scientist’s world is a world of nothing but abstractions“<br />
(Colburn 2004, 322)<br />
Die Frage <strong>de</strong>r Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, die im letzten Abschnitt in Bezug auf<br />
Tätigkeiten diskutiert wur<strong>de</strong>, die primär von Frauen ausgeübt und diesen<br />
zugeschrieben wer<strong>de</strong>n, wird in diesem Abschnitt wie<strong>de</strong>r aufgenommen. Im Zentrum<br />
steht dabei jedoch nicht primär die Diskussion von (Arbeits-)Handlungen, die<br />
formalisiert wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn von Un-/Sichtbarkeiten bei <strong>de</strong>r Repräsentation von<br />
Wissen und <strong>de</strong>r Tätigkeit <strong>de</strong>s Formalisierens selbst. Nachfolgend wer<strong>de</strong>n Wissensrepräsentationen,<br />
Informationssysteme und das Wissen um das Formalisieren in <strong>de</strong>r<br />
Informatik auf jeweilige Prämissen hin untersucht. Mithin wer<strong>de</strong>n das Formale und<br />
<strong>de</strong>ssen Gebrauch sowie die Prozesse und die Subjekte <strong>de</strong>r Formalisierung ins<br />
Zentrum <strong>de</strong>r feministischen wissenschafts- und gesellschaftstheoretischen Kritik<br />
gestellt. Es wird damit eine weitere wesentliche Dimension <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte beschrieben.<br />
Die Informatik lässt sich als eine Disziplin verstehen, die sich primär mit Abstraktion,<br />
Klassifikation und Formalisierung befasst. Statische und dynamische Strukturen eines<br />
237 Ausnahmen hierzu im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum bil<strong>de</strong>n das Dissertationsprojekt von Clau<strong>de</strong> Drau<strong>de</strong><br />
sowie das Forschungsprojekt „Sozialität mit Maschinen. Anthropomorphisierung und Vergeschlechtlichung<br />
in aktueller Agenten- und Robotikforschung“ am Institut für Wissenschaftstheorie <strong>de</strong>r Universität Wien, das<br />
2004-2006 von österreichischen Bun<strong>de</strong>sministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geför<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>.<br />
238 Siehe hierzu etwa Bath 2006a, wo ich verschie<strong>de</strong>ne Konzepte herausgearbeitet hatte, wie Sozialität mit<br />
Maschinen in <strong>de</strong>r „sozialen“ Softwareagentenforschung und Robotik verstan<strong>de</strong>n, formalisiert und in<br />
virtuellen Menschen bzw. sozialen Robotern simuliert wird.<br />
165
Anwendungsbereichs wer<strong>de</strong>n zunächst i<strong>de</strong>ntifiziert und explizit beschrieben sowie<br />
mo<strong>de</strong>lliert, um Prozesse durch Software unterstützen o<strong>de</strong>r sie automatisieren zu<br />
können. Diese Vorstellung <strong>informatischer</strong> Vorgehensweisen spiegelt sich in <strong>de</strong>r Lehre<br />
an Informatik-Fachbereichen <strong>de</strong>r Universitäten wi<strong>de</strong>r: „One of the main things computer<br />
science stu<strong>de</strong>nts are taught is to see structures and to discern recurrent structures in<br />
various areas – to see the same in the diverse. They are trained in abstraction and<br />
formal <strong>de</strong>scription“ (Maaß/ Rommes 2007, 97f, Hervorhebung C.B.). InformatikerInnen<br />
seien dadurch beson<strong>de</strong>rs geübt und effizient darin, Ähnlichkeiten zu erkennen und das<br />
zu übersehen, was an <strong>de</strong>m betrachteten Fall das Beson<strong>de</strong>re sein könnte.<br />
Die Komplexität realweltlicher Probleme soll mit Hilfe ein<strong>de</strong>utiger Formalismen<br />
gemeistert wer<strong>de</strong>n. Crutzen versteht dies als die dominante Grundhaltung in <strong>de</strong>r<br />
Softwaretechnik, die einen zentralen Bereich <strong>de</strong>r Informatik darstellt. Software-<br />
IngenieurInnen versuchten, „die Kompliziertheit <strong>de</strong>r realen Welt und die Mehr<strong>de</strong>utigkeit<br />
zu überwin<strong>de</strong>n (kolonisieren). ‚Abstrahieren‘, ein Fundament vieler Mo<strong>de</strong>lliermetho<strong>de</strong>n<br />
wie Generalisierung, Klassifizierung, Spezialisierung, Teilung und Trennung (zwecks<br />
Strukturierung), wird als unvermeidbar gesehen, um dynamische Weltprozesse in<br />
bereitgelegten Mo<strong>de</strong>llierungsstrukturen abzubil<strong>de</strong>n und diese in das Han<strong>de</strong>ln zu<br />
transformieren. ICT-Professionals entwerfen nicht, son<strong>de</strong>rn verwen<strong>de</strong>n stabilisierte<br />
Metho<strong>de</strong>n und Theorien.“ (Crutzen 2007, 40). InformatikerInnen formalisieren <strong>de</strong>mnach<br />
nicht nur „Realweltliches“, um Software zu konstruieren, son<strong>de</strong>rn zugleich <strong>de</strong>n Prozess<br />
dieser Mo<strong>de</strong>llierungen. Die Softwaretechnik zielt darauf, Vorgehensweisen bei <strong>de</strong>r<br />
informatischen Formalisierung und Gestaltung selbst in formalen Mo<strong>de</strong>llen zu<br />
spezifizieren.<br />
KritikerInnen <strong>de</strong>s Formalen machen <strong>de</strong>mgegenüber seit vielen Deka<strong>de</strong>n auf die<br />
Kontingenzen und die Situiertheit realweltlicher Probleme aufmerksam. Darauf verweisen<br />
insbeson<strong>de</strong>re Diskussionen um die Künstliche Intelligenz-Forschung, in <strong>de</strong>r<br />
Wissen, menschliches Denken und Han<strong>de</strong>ln zum Gegenstand <strong>de</strong>r Formalisierung<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. Neuere Richtungen <strong>de</strong>r KI reagieren auf diese primär von philosophischer<br />
Seite erhobenen Einwän<strong>de</strong> und versuchen zunehmend, das Zufällige, Situierte<br />
o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rweitig bisher als nicht formalisierbar Gelten<strong>de</strong> zu beschreiben und zu simulieren.<br />
Abstraktion, Klassifizierung und Formalisierung sind somit innerhalb <strong>de</strong>r Informatik<br />
sowohl in <strong>de</strong>r Softwaretechnik als auch in <strong>de</strong>r KI zentral, wobei das eine Gebiet<br />
auf die formale Repräsentation von Tätigkeiten und Strukturen eines Gegenstandsbereichs<br />
und von Vorgehensweisen bei <strong>de</strong>r Erstellung von Software zielt, während das<br />
an<strong>de</strong>re versucht, wissenschaftliches und allgemeines Wissen, menschliche Eigenschaften,<br />
Denkweisen und Handlungen formal darzustellen. Die Problematiken und<br />
Grenzen dieser Prozesse wer<strong>de</strong>n zum Teil auch innerhalb <strong>de</strong>r Disziplin umstritten<br />
diskutiert. Viele <strong>de</strong>r konträren Positionen in diesen Debatten lassen sich zumeist grob<br />
auf eine <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Theorielinien zurückführen.<br />
Historisch betrachtet ist das Formale in <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne zunächst als etwas Positives<br />
verstan<strong>de</strong>n und ihr emanzipatorisches Potential herausgestellt wor<strong>de</strong>n. Die Klarheit<br />
und Deutlichkeit, Rationalität und Effizienz formaler Repräsentation – so das seit <strong>de</strong>r<br />
Aufklärung vorherrschen<strong>de</strong> Versprechen, das zugleich Wissenschaft, Technologie und<br />
das Formale selbst zu legitimieren versucht – könne von unbewussten Beschränkungen<br />
und <strong>de</strong>r Herrschaft all <strong>de</strong>ssen befreien, was einstmals als natürlich,<br />
selbstverständlich o<strong>de</strong>r (gott-)gegeben galt. Demgegenüber kritisierten VertreterInnen<br />
166
postmo<strong>de</strong>rnen Denkens das Formale eher als Beschränken<strong>de</strong>s. Formale<br />
Repräsentationen konstituierten Subjekte, in<strong>de</strong>m sie ihnen bestimmte Denk- und<br />
Handlungsweisen aufzwingen. Insofern sei Formalisierung ein Akt <strong>de</strong>r Gewalt.<br />
Mo<strong>de</strong>rate Versionen dieser Denkrichtung wiesen auf Wi<strong>de</strong>rsprüche zwischen <strong>de</strong>m<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r Formalisierung und s<strong>einer</strong> Repräsentation hin und machten auf<br />
Grenzen <strong>de</strong>r Formalisierbarkeit aufmerksam. Im Folgen<strong>de</strong>n wird diskutiert, wie diese<br />
Argumentationen seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren von <strong>kritisch</strong>en InformatikerInnen und<br />
sozialwissenschaftlichen TechnikforscherInnen aufgenommen und in Bezug auf<br />
Informatik, Computer- und Informationssysteme ausgeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
Frühe SkeptikerInnen beriefen sich gegenüber <strong>de</strong>m Formalen auf mathematische<br />
Theorien, die das formalistische Programm und <strong>de</strong>ssen Allgemeingültigkeit in Grenzen<br />
verwiesen (vgl. etwa Star 1991a). Der Logiker Kurt Gö<strong>de</strong>l hatte bereits 1936 gezeigt,<br />
dass eine vollständige, wi<strong>de</strong>rspruchsfreie Formalisierung eines Gegenstandsbereiches,<br />
<strong>de</strong>r die Theorie <strong>de</strong>r natürlichen Zahlen umfasst, prinzipiell nicht möglich sei. Genauer<br />
bewies er diese Unmöglichkeit mit mathematischen Mitteln. Wenn jedoch nicht einmal<br />
die natürlichen Zahlen formalisierbar sind, dann <strong>de</strong>utet dies darauf, dass auch viele<br />
weitere Bereiche <strong>einer</strong> formalen Repräsentation nicht zugänglich sind.<br />
Einen Beleg für das formal Nichtrepräsentierbare sah <strong>de</strong>r Philosoph und<br />
Phänomenologe Hubert Dreyfus (1972, 1992) im „knowing how“ (prozedurales<br />
Wissen), das er vom „knowing that“ (<strong>de</strong>klaratives Wissen) unterschied und damit die<br />
Differenz verschie<strong>de</strong>ner Typen von Wissen betonte. Er kritisierte die frühen symbolorientierten<br />
Ansätze <strong>de</strong>r KI, weil sie <strong>de</strong>n Fokus ausschließlich auf das <strong>de</strong>klarative,<br />
explizite 239 Wissen legten, welches sich in Form logischer Aussagen und Regeln<br />
repräsentieren lässt, und das prozedurale und verkörperte Wissen vernachlässige.<br />
VertreterInnen differenzfeministischer Positionen unterstrichen, dass das „Wissen wie“,<br />
welches <strong>de</strong>r Formalisierung unzugänglich erscheint, häufig ein praktisches Erfahrungswissen<br />
sei, das insbeson<strong>de</strong>re Frauen hätten (vgl. Dalmiya/ Alcoff 1993, Belenki et al.<br />
1989 [1986]). Ein Beispiel dafür, dass ein großer Teil <strong>de</strong>s Wissens nicht sprachlich<br />
erfasst und nie<strong>de</strong>rgeschrieben, geschweige <strong>de</strong>nn formalisiert wer<strong>de</strong>n könne, sei etwa<br />
das <strong>de</strong>r frühen Hebammen. „Historically, much of the skill of midwifery in the Western<br />
world before the present day was of this sort. Knowledge and skills were han<strong>de</strong>d on<br />
orally and by watching and doing […] The skill of midwives was based on an<br />
accumulated body of beliefs and experience of the community of experts of childbirth,<br />
much like science, but unlike the scientific knowledge the practitioners were women<br />
and the knowledge was not written down. Traditional midwifery clearly emphasized<br />
practical experience over propositional knowledge“ (Adam 1995, 367f). 240 Solche<br />
Formen <strong>de</strong>s Wissens wür<strong>de</strong>n jedoch we<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Medizin als adäquates, legitimes<br />
wissenschaftliches Wissen anerkannt noch von InformatikerInnen, die formalisieren,<br />
wahrgenommen und mo<strong>de</strong>lliert. Insofern schließe die formale Repräsentation<br />
wesentliche Aspekte <strong>de</strong>s Wissens „vom in-<strong>de</strong>r-Welt-sein“, insbeson<strong>de</strong>re das<br />
239 Die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen hat Michael Polanyi 1985 eingeführt.<br />
Beispiele für implizites Wissen sind etwa das Fahrradfahren, blin<strong>de</strong>s Tippen o<strong>de</strong>r die Fähigkeit, einen<br />
Nagel in die Wand zu schlagen, d.h. Fähigkeiten, die häufig ein erlerntes Körperwissen (z.B. das<br />
Gleichgewicht zu halten) erfor<strong>de</strong>rten.<br />
240 Zur historischen Herausbildung „wissenschaftlichen Wissens“ über Frauenkörper unter Ausblendung<br />
und Abwertung von Hebammenwissen vgl. Ehrenreich/ English 1978.<br />
167
Erfahrungswissen von Frauen, aus. Die cartesianisch geprägte Auffassung von Wissen<br />
bringe <strong>de</strong>shalb eine geschlechtlich kodierte Wissenshierarchie hervor.<br />
Auch an<strong>de</strong>re Kritiken am Formalismus griffen zunächst primär auf theoretische<br />
Argumente zurück. So hinterfragten frühe VertreterInnen <strong>einer</strong> feministischen Analyse<br />
<strong>de</strong>r Mathematik die Allgemeingültigkeit und die angestrebte Überzeitlichkeit von<br />
Formalismen: „Das Bedürfnis, immer und überall überzeugend zu sein […], die Suche<br />
nach <strong>einer</strong> die Spreu vom Weizen son<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Form, die eine wahrheitsgetreue<br />
Überlieferung mathematischer Aussagen an kommen<strong>de</strong> Generationen gewährt […],<br />
sind die Wunschvorstellungen, die das Fundament <strong>de</strong>r formalistischen Haltung bil<strong>de</strong>n.<br />
Wir erkennen darin <strong>de</strong>n Willen, <strong>de</strong>r Zeit die Stirn zu bieten und die ewige Sehnsucht<br />
nach Ewigkeit. Die Zeit, o<strong>de</strong>r vielmehr ihre Negation, spielt darin die Hauptrolle. Die<br />
mathematischen Erkenntnisse sollen in eine Form gezwängt wer<strong>de</strong>n, die sie vor <strong>de</strong>n<br />
Schä<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r stetig ablaufen<strong>de</strong>n Zeit in Schutz nehmen soll“ (Frougny/ Peiffer 1985,<br />
73). Diejenigen, die sich nicht <strong>de</strong>m Formalen verschrieben hätten – nach <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
1980er Jahren vorherrschen<strong>de</strong>n feministischen Ansätzen insbeson<strong>de</strong>re Frauen –,<br />
hätten an<strong>de</strong>re Erfahrungen mit Zeit, mithin ein an<strong>de</strong>res Zeitgefühl, das dieser<br />
formalistischen Haltung wi<strong>de</strong>rspräche. Dem Vorhaben formaler Repräsentation seien<br />
somit maskulinistische Sehnsüchte eingeschrieben wie die <strong>de</strong>r Überwindung von<br />
Raum und Zeit.<br />
Die Haupteinwän<strong>de</strong> gegen Formalisierung und in <strong>de</strong>r Informatik dominante<br />
Praktiken <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation bestan<strong>de</strong>n insgesamt darin, dass das<br />
repräsentierte Wissen unvollständig sei, da es primär hegemoniale Wissensformen und<br />
-bestän<strong>de</strong> umfasse und <strong>de</strong>ren historische wie kulturell-soziale Situiertheit nicht berücksichtige.<br />
Viele Aspekte <strong>de</strong>r realen Welt, speziell die als „weiblich“ markierten, wür<strong>de</strong>n<br />
nicht formalisiert o<strong>de</strong>r seien prinzipiell nicht formalisierbar. In diesem Sinne als sperrig<br />
erwiesen sich auch in <strong>de</strong>r Informatik immer wie<strong>de</strong>r das verkörperte Wissen, das „tacit<br />
knowledge“, die Kreativität menschlicher Handlungen, das Chaotisch-Ungeordnete,<br />
das „Irrationale“ o<strong>de</strong>r das Emotionale, wie die folgen<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n, informatikbezogenen<br />
Beispiele praktisch aufzeigen.<br />
Suchman macht in ihrem Werk „Plans and Situated Action“ (1987) auf die<br />
Schwierigkeit aufmerksam, situiertes Han<strong>de</strong>ln zu formalisieren. Dabei stellt sie nicht<br />
nur die Möglichkeit infrage, einen bestimmten Typ von Wissen und Handlung, wie etwa<br />
das verkörperte Wissen, formal zu repräsentieren, son<strong>de</strong>rn bezieht grundsätzlich<br />
gegen die damaligen Ansätze <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz-Forschung Stellung. Sie kritisiert<br />
die in <strong>de</strong>r symbolorientierten KI und <strong>de</strong>n Kognitionswissenschaften weit verbreitete<br />
Annahme, dass menschliches Han<strong>de</strong>ln darin bestün<strong>de</strong>, vorgefertigte mentale<br />
Pläne auszuführen. Menschen wür<strong>de</strong>n jedoch üblicherweise in ihrem Han<strong>de</strong>ln nicht<br />
formalen Regeln folgen, d.h. Regeln als eine ausführbare Spezifikation nutzen, son<strong>de</strong>rn<br />
abhängig vom Kontext und seinen spezifischen Bedingungen eigene Vorgehensweisen<br />
entwickeln. Sie han<strong>de</strong>lten nicht so, dass sie zunächst formale, abstrakte Pläne<br />
und Ziele aufstellten, um diese anschließend geregelt und zielgerichtet auszuführen.<br />
Vielmehr nutzten sie dynamische und situierte Improvisationen. Es sei zwar möglich,<br />
dass rationale Pläne einen Bezugsrahmen und eine Ressource für dynamische und<br />
situierte Improvisationen darstellten, aber in Interaktion mit <strong>de</strong>r konkreten, kontingenten<br />
Umgebung wür<strong>de</strong>n sie dann stets <strong>de</strong>n sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Gegebenheiten angepasst.<br />
Kognitive Prozesse stellten <strong>de</strong>mzufolge ein situiertes Unterfangen dar. Suchman<br />
168
argumentiert, dass technische Systeme, die auf einem verengten Verständnis von<br />
Handlung als zuvor festgelegter Spezifikation basieren, die im Individuum stattfin<strong>de</strong>t,<br />
<strong>de</strong>shalb notwendigerweise fehlschlagen müssten. Sie zeigt dieses Scheitern <strong>de</strong>s<br />
formalen Konzepts von Plänen in <strong>de</strong>r KI empirisch überzeugend anhand ethnografischer<br />
Analysen <strong>de</strong>r Benutzung erster „intelligenter“ Kopierer auf, <strong>de</strong>ren frühe Prototypen<br />
in <strong>de</strong>n 1980er Jahren in Xerox Parc entwickelt wur<strong>de</strong>n. Ihr Konzept <strong>de</strong>r ‚situated<br />
action‘ lässt sich als prinzipielle Kritik an <strong>de</strong>r Vorstellung verstehen, dass menschliches<br />
Denken und Han<strong>de</strong>ln vollständig spezifiziert wer<strong>de</strong>n kann. 241<br />
Das zweite Beispiel, das auf Grenzen <strong>de</strong>r Formalisierbarkeit verweist, führt auf die<br />
Repräsentation und Sichtbarmachung <strong>de</strong>r Tätigkeit von Krankenschwestern zurück, die<br />
in Kapitel 4.2.3. bereits als unsichtbare Arbeit diskutiert wor<strong>de</strong>n ist. Bowker und Star<br />
(1999) ver<strong>de</strong>utlichen die Schwierigkeit, diese Pflegehandlungen explizit zu beschreiben<br />
und informatisch zu formalisieren, plakativ am Beispiel <strong>de</strong>s Humors. Die Pflegehandlung<br />
Humor wird in <strong>de</strong>r von ihnen untersuchten „“Nursing Intervention Classification“<br />
(NIC, vgl. 4.2.3) <strong>de</strong>finiert als: „Facilitating the patient to perceive, appreciate, and<br />
express what is funny, amusing, or ludicrous in or<strong>de</strong>r to establish relationship“ (Bowker/<br />
Star 2000, 233). Das Klassifikationssystem grün<strong>de</strong>t auf <strong>einer</strong> Analyse <strong>de</strong>ssen, was es<br />
für eine KrankenpflegerIn be<strong>de</strong>utet humorvoll zu sein, und auf <strong>einer</strong> Theorie, was<br />
Humor bei <strong>de</strong>n PatientInnen bewirkt: Das Pflegepersonal solle zunächst bestimmen,<br />
welche Art von Humor die PatientIn schätzt, wie sie o<strong>de</strong>r er typischerweise darauf<br />
reagiert (Lachen o<strong>de</strong>r Lächeln) und dann ein geeignetes Thema und entsprechen<strong>de</strong><br />
Interaktionsformen auswählen, welche bei <strong>de</strong>m Individuum die gewünschte Reaktion<br />
hervorzurufen vermag, beispielsweise Verspieltheit und Albernheit. Im Klassifikationssystem<br />
wer<strong>de</strong>n unter <strong>de</strong>r Kategorie <strong>de</strong>r Pflegehandlung „Humor“ fünfzehn Teilaktivitäten<br />
angeführt, die aufgrund wissenschaftlicher Literatur als relevant gelten. Bowker und<br />
Star bemerken, dass es jedoch unklar sei, wie diese Handlungen einem zeitlichen<br />
Verlauf zuzuordnen wären, <strong>de</strong>nn KrankenpflegerInnen könnten humorvoll sein, selbst<br />
wenn sie mit an<strong>de</strong>ren Tätigkeiten beschäftigt sind. Es bestehe sogar eine explizite<br />
Erwartungshaltung, dass das Pflegepersonal stets Humor haben solle. Sie problematisieren<br />
allerdings noch grundsätzlicher: „How can one capture humor as a <strong>de</strong>liberate<br />
nursing intervention? Does sarcasm, irony or laughter count as a nursing intervention?<br />
How to reimburse humor; how to measure this kind of care? No one would dispute its<br />
importance, but it is by its nature a situated and subjective action“ (ebd., 247). Bowker<br />
und Star verweisen anhand <strong>de</strong>r Situiertheit und Subjektivität von Humor nicht nur auf<br />
Grenzen <strong>de</strong>r Repräsentierbarkeit von Pflegehandlungen – sei es im Klassifikationssystem<br />
o<strong>de</strong>r s<strong>einer</strong> technischen Realisierung als Informationssystem. Vielmehr gibt ihr<br />
Einwand Hinweise darauf, dass Formalisierung häufig auch eine (wissenschaftliche)<br />
Messbarkeit <strong>de</strong>s Formalisierten voraussetzt und <strong>de</strong>ssen Einbettung in eine ökonomische<br />
Logik von Wert und Tausch impliziert. Insofern be<strong>de</strong>ute Nichtformalisierbarkeit<br />
bestimmter lebensweltlicher Bereiche, dass diese nicht vom vorherrschen<strong>de</strong>n politischökonomischen<br />
System vereinnahmt wer<strong>de</strong>n können.<br />
241 Mike Robinson bezeichnet Suchmans wissenschaftlichen Beitrag als „Unmöglichkeitstheorem“: „there<br />
can be no apriori or algorithmic connection between any particular plan and any specific action“ (Robinson<br />
1991, 15). Dass dieses Theorem jedoch in <strong>de</strong>n meisten Software- und Informationsystem-<br />
Entwicklungsprozessen ignoriert wer<strong>de</strong>, stießen diese Projekte an Grenzen.<br />
169
Feministische Ansätze, die von dieser Form <strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rstands ausgehend<br />
argumentieren, tendieren allerdings häufig dazu, das Formale vollständig abzulehnen.<br />
Vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Fragestellung dieser Kapitels ist eine solche grundsätzliche<br />
Kritik zwar ebenso wie die bisher skizzierten Argumente, die auf die Grenzen <strong>de</strong>r<br />
Formalisierung aufmerksam machen, anzuerkennen. Denn viele Phänomene, die von<br />
InformatikerInnen <strong>de</strong>terministisch, geschlossen und kausal beschrieben wer<strong>de</strong>n, sind<br />
offenbar kontingenter, kreativer und situierter als sie in <strong>de</strong>n informatischen Mo<strong>de</strong>llen<br />
und Informationssystemen repräsentiert wer<strong>de</strong>n. Insbeson<strong>de</strong>re, wenn dabei menschliches<br />
Denken, Han<strong>de</strong>ln und soziale Interaktion formalisiert wer<strong>de</strong>n soll. Insofern ist<br />
eine fundierte Diskussion <strong>de</strong>r Tücken und Grenzen <strong>de</strong>s Formalisierens auf <strong>de</strong>r Basis<br />
traditioneller Erkenntnistheorie, die das Auseinan<strong>de</strong>rklaffen vom Objekt und s<strong>einer</strong><br />
Repräsentation beleuchtet – aufgrund prinzipieller Schranken o<strong>de</strong>r nicht adäquater<br />
Formalisierung – notwendig, um informatische Tätigkeit gesellschafts<strong>kritisch</strong> bzw.<br />
feministisch zu reflektieren.<br />
Da diese Arbeit darauf zielt, auf Basis <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en Analyse von Gen<strong>de</strong>ringprozessen<br />
Vorschläge für eine alternative Gestaltung von Informationstechnologien vorzulegen,<br />
sind diese Ansätze zu konkretisieren und konstruktiv zu wen<strong>de</strong>n. Allgemeine<br />
Kritiken am Formalen bleiben <strong>de</strong>n konkreten Nachweis ihres politischen Charakters<br />
schuldig. Interessant erscheint <strong>de</strong>mgegenüber die <strong>kritisch</strong>e Auseinan<strong>de</strong>rsetzung mit<br />
Abstraktion und Formalisierung, die zeigt, dass die untersuchten formalen Artefakte in<br />
<strong>de</strong>r Informatik politisch sind bzw. genauer zur Geschlechterpolitik beitragen. Dazu sind<br />
grundlegen<strong>de</strong> Annahmen, die in die Formalisierung eingehen und <strong>de</strong>m in Informationssystemen<br />
Repräsentierten Be<strong>de</strong>utung geben, darzulegen. Die Untersuchung zugrun<strong>de</strong><br />
liegen<strong>de</strong>r Ontologien und Epistemologie ist <strong>de</strong>shalb zentral. Insofern schließe ich mich<br />
<strong>de</strong>r Position John Bowers an, <strong>de</strong>r konstatiert: „Repeatingly pointing out the limits of<br />
formalism is not always helpful in either un<strong>de</strong>rstanding the nature of formalism or in<br />
making progress in system <strong>de</strong>sign“ (Bowers 1992, 239).<br />
Bowers führt ein weiteres Argument gegen die allgemeinen Formalismuskritiken an:<br />
viele von diesen basieren auf <strong>einer</strong> essentialistischen Vorstellung von menschlichen<br />
Handlungen. Sie setzen ein spezifisch Menschliches (o<strong>de</strong>r wie wir am Beispiel verkörperten<br />
Hebammenwissens gesehen haben, ein spezifisch „Weibliches“) voraus – eine<br />
Annahme, die auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s im ersten Teil dieser Arbeit herausgearbeiteten theoretischen<br />
Rahmens nicht haltbar erscheint. Solche Argumentationen gehen von <strong>einer</strong><br />
spezifischen Definition menschlichen Han<strong>de</strong>lns aus und schreiten damit fort, dass<br />
diese nicht mit <strong>de</strong>m Formalisierten übereinstimmt, um dann häufig mit <strong>de</strong>r Kritik dort<br />
stehen zu bleiben. Nicht infrage gestellt wird damit <strong>de</strong>r Dualismus von Formalem und<br />
Nichtformalem, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Argument zugrun<strong>de</strong> liegt. Eine Analyse <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung<br />
von Technologie/Formalem und Gesellschaft/Geschlecht, wie sie in dieser Arbeit<br />
angestrebt wird (vgl. Kapitel 3), wür<strong>de</strong> jedoch be<strong>de</strong>uten, die Entstehung <strong>de</strong>r Polarisierung<br />
von Nichtformalem, Situiertem, Beson<strong>de</strong>rem, Kontigentem und zu Interpretieren<strong>de</strong>m<br />
<strong>einer</strong>seits und Formalem, Abstraktem, Durchgeplantem, Deterministischem,<br />
Deskriptivem an<strong>de</strong>rerseits sorgfältig zu rekonstruieren und die gesellschaftlichen<br />
Implikationen dieser Dualismen sichtbar zu machen. Der Dualismus selbst wäre<br />
<strong>de</strong>mnach als Effekt sozialer Konstruktionsprozesse nachzuzeichnen (vgl. hierzu auch<br />
Kapitel 2).<br />
170
Im Folgen<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n drei wesentliche und eng miteinan<strong>de</strong>r verwobene<br />
Perspektiven diskutiert, die Ausgangspunkte feministischer Kritiken am Formalen, an<br />
Formalismen und <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation in <strong>de</strong>r Informatik sind und waren:<br />
1. die Politik <strong>de</strong>s Formalen, die Ausschlüsse, Machtverhältnisse sowie politische<br />
Entscheidungen ver<strong>de</strong>ckt, Handlungen <strong>de</strong>r NutzerInnen beschränkt und dazu eine<br />
angeblich neutrale Sicht als einzige und objektive etabliert (Abschnitt 4.3.1.)<br />
2. die Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen, die diejenigen, die das Formale entwickeln,<br />
unsichtbar macht, jedwe<strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>s Subjekts auf <strong>de</strong>n Akt <strong>de</strong>s Formalisierens<br />
negiert und es damit ermöglicht, bestimmte Ontologien zu etablieren (Abschnitt 4.3.2.),<br />
sowie<br />
3. <strong>de</strong>r Dualismus von Formalem vs. Nichtformalem selbst und an<strong>de</strong>ren Dichotomien,<br />
die eine symbolische Hierarchie fortführen, die stark vergeschlechtlicht sind (Abschnitt<br />
4.3.3.).<br />
Die damit verbun<strong>de</strong>nen Einschreibungen von Geschlecht in informatische Artefakte<br />
wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Abschnitten ausführlich dargestellt und auf <strong>de</strong>r Folie<br />
feministischer Theorie und Erkenntniskritik diskutiert.<br />
4.3.1. Politik <strong>de</strong>s Formalen<br />
„[A]s feminists we are led to battle with abstractions in several ways:<br />
noting that they are historically specific, not timeless; groun<strong>de</strong>d in male<br />
experience, not universal; biased, not neutral. We want to make what the<br />
abstractions have hid<strong>de</strong>n, visible“ (Star 1991a, 82)<br />
John Bowers (1992) plädierte als <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r ersten in <strong>de</strong>r Informatik dafür, <strong>de</strong>n<br />
politischen Charakter <strong>de</strong>s Formalen anzuerkennen. Er knüpft dabei an <strong>de</strong>n berühmten<br />
Aufsatz Langdon Winners (1999 [1980]) an. „[B]y addressing formalisms of the sort that<br />
are used in the <strong>de</strong>sign or implementation of computer systems, or are employed in the<br />
analysis of human action and thought – frequently in ways which make human capacities<br />
computable and simulatable“ (ebd., 233) erweitert er <strong>de</strong>ssen Behauptung, dass<br />
Artefakte politisch sind: „formalisms too can be seen to have politics“ (ebd.).<br />
Formalismen im Gebrauch: Geschlechter-Dichotomie aufgrund von<br />
Schwellenwerten?<br />
Um seine These <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r Formalismen formulieren zu können, führt Bowers die<br />
grundlegen<strong>de</strong> Unterscheidung ein zwischen „Formalismen in Gebrauch“ und Formalismen,<br />
wie sie in <strong>de</strong>r Mathematik und Informatik verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Letztere <strong>de</strong>finiert er<br />
in Anlehnung an mathematische Formulierungen als spezifische Repräsentationssysteme.<br />
Ein Formalismus erzeuge bestimmte Repräsentationen, in<strong>de</strong>m Regeln auf ein<br />
Vokabular angewandt wer<strong>de</strong>n. Dabei repräsentierten die Elemente, aus <strong>de</strong>nen das<br />
Vokabular bestehe, und die Terme, aus <strong>de</strong>nen die Regeln aufgebaut seien, menschliche<br />
o<strong>de</strong>r maschinelle Handlungen. 242 Sowohl das Vokabular als auch die Regeln<br />
wer<strong>de</strong> aus endlich vielen separaten Elementen zusammengesetzt. Die Regeln<br />
beschrieben komplexe Operationen, die aus einfacheren Komponenten aufgebaut<br />
242 Diese Definition ist bewusst so gewählt, dass sie Programmiersprachen, Techniken <strong>de</strong>r<br />
Datenverwaltung sowie Notations- und Repräsentationsschemata umfasst.<br />
171
sind, o<strong>de</strong>r sie formulierten eine zeitliche Ordnung, entlang <strong>de</strong>rer Handlungen<br />
ausgeführt wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Ereignisse stattfin<strong>de</strong>n sollen. Da nur bestimmte<br />
Repräsentationen erlaubt seien, be<strong>de</strong>ute Formalisieren zwischen <strong>de</strong>m Gesetzmäßigen<br />
und <strong>de</strong>m Gesetzwidrigen zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />
Bowers betont, dass jedoch verschie<strong>de</strong>ne praktische Bedingungen erfüllt sein<br />
müssten, damit diese Formalismen erfolgreich angewandt wer<strong>de</strong>n können. Funktionieren<strong>de</strong><br />
„Formalismen im Gebrauch“ erfor<strong>de</strong>rten unter an<strong>de</strong>rem ein Zentrum 243 (z. B. ein<br />
Chip-Design-Labor, ein staatliches Statistikbüro o<strong>de</strong>r einen Softwareworkshop) sowie<br />
zuverlässige, disziplinierte VermittlerInnen, welche die formalen Repräsentationen<br />
erfassten, sammelten und <strong>de</strong>m Zentrum zugänglich machten. Ferner wür<strong>de</strong>n Re-<br />
Repräsentationstechniken 244 benötigt, welche die Lücke zwischen <strong>de</strong>m Objekt und<br />
s<strong>einer</strong> formalen Repräsentation schrittweise überbrückten und nachvollziehbar<br />
machten. Formalismen seien laut Latour „unverän<strong>de</strong>rlich mobile Elemente“ (Latour<br />
2006 [1986]), die Raum und Zeit überbrücken können und dabei <strong>de</strong>r Stabilisierung von<br />
Artefakten, Theorien, Machtverhältnissen etc. dienen. Es seien Artefakte, die zwischen<br />
verschie<strong>de</strong>nen Welten reisen können, ohne zu verschwin<strong>de</strong>n und sich auf dieser Reise<br />
nicht wesentlich verän<strong>de</strong>rn. Gleichzeitig könnten sie an an<strong>de</strong>ren Orten vorgestellt und<br />
in diesem neuen Kontext durchaus verstan<strong>de</strong>n sowie mit an<strong>de</strong>ren Dingen verknüpft<br />
wer<strong>de</strong>n (vgl. Latour 1987, 237-241). 245 So verstan<strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Gebrauch von<br />
Formalismen Praktiken, welche die Kombinierbarkeit, Dauerhaftigkeit, Mobilität von<br />
Repräsentationen erhöhen. Darüber hinaus sei eine optische Konsistenz <strong>de</strong>r formalen<br />
Repräsentation notwendig.<br />
Bowers zufolge erhielten Formalismen ihre Klarheit, Ausdrucksstärke und<br />
Vertrauenwürdigkeit erst aufgrund solcher praktischer Bedingungen <strong>de</strong>s Gebrauchs: „If<br />
these practical conditions obtain, then we say that our formalisms are clear, explicit,<br />
precise, trustworthy and other terms of epistemological values. […] Clarity and the rest<br />
are, I conjecture, not properties intrinsic to formalisms which can somehow be read off<br />
from their <strong>de</strong>finitions“ (Bowers 1992, 250). Das Formale könne somit erst dadurch <strong>de</strong>r<br />
Kritik zugänglich gemacht wer<strong>de</strong>n, dass <strong>de</strong>r Kontext eines Formalismus, <strong>de</strong>r diesen<br />
zum Funktionieren bringt, in Betracht gezogen wird. Das Politische <strong>de</strong>s Formalen zeige<br />
sich erst in <strong>de</strong>n Praktiken <strong>de</strong>s Gebrauchs.<br />
In<strong>de</strong>m er „Formalismen im Gebrauch“ ins Spiel bringt, gelingt es Bowers, Parallelen<br />
aufzuzeigen zwischen Formalisierung und traditionellen Formen zentralisierter Machtausübung:<br />
„In short, the concentration and combination of representations in the one<br />
place permits action at a distance. In many respects […] this is the political problem of<br />
power: how is it possible to gather enough resources at the one place to have a<strong>de</strong>quate<br />
influence over all other places?“ (Bowers 1992, 251). Formalismen erscheinen<br />
auf <strong>de</strong>r Grundlage ihres Gebrauches auf mehreren Ebenen als hochpolitisch. Zunächst<br />
implizierten sie ein grundlegen<strong>de</strong>s politisch-militärisches Strategem: sehen zu können,<br />
ohne selbst gesehen zu wer<strong>de</strong>n. Wie und von wem formalisiert wird, bleibe unsichtbar.<br />
243 Bowers nimmt hierin Bezug auf Bruno Latours Begriff <strong>de</strong>r „centres of calculation“ (Latour 1987, 232ff).<br />
244 Im Zentrum, wo die Repräsentationen zusammengeführt sind, wer<strong>de</strong>n diese ausgewählt, transformiert<br />
und kombiniert, d.h. re-repräsentiert. Der Term „Re-Repräsentation“ wur<strong>de</strong> von Gerson/ Star 1986<br />
eingeführt, um die Komplexität <strong>de</strong>s Verhältnisses zwischen Objekt und formaler Repräsentation zum<br />
Ausdruck zu bringen.<br />
245 Latour selbst fasst dies pointiert zusammen: „what we call formalism is the acceleration of displacement<br />
without transformation“ (Latour 1986, 23).<br />
172
Ferner hätten Formalismen die Funktion, Unsicherheiten bei <strong>de</strong>r Produktion rhetorisch<br />
überzeugen<strong>de</strong>r Repräsentationen von Welt auszuräumen. Wenn diese Unsicherheiten<br />
jedoch daraus hervorgingen, dass sich <strong>kritisch</strong>en Stimmen gegenüber <strong>de</strong>m formal<br />
Gesetzten erhoben haben, „then formalization is simply a matter of silencing dissent on<br />
a grand scale“ (Bowers 1992, 252). Formalismen wür<strong>de</strong>n darüber hinaus die Arbeit<br />
unsichtbar machen, die zu ihrer Entstehung führt. 246 Sie seien dann als gewaltsam zu<br />
bezeichnen, wenn <strong>de</strong>r Akt <strong>de</strong>s Formalisierens und die Subjekte, die diese erstellten,<br />
ignoriert wür<strong>de</strong>n und zugleich Mythen über ihre Macht, Allgemeingültigkeit und Aussagekraft<br />
erzählt wer<strong>de</strong>n.<br />
Wenn aber Formalismen tatsächlich benutzt wer<strong>de</strong>n, beispielsweise in Form ihrer<br />
Manifestation in einem Computerprogramm, so brächten sie die NutzerInnen dazu, ihre<br />
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit an <strong>de</strong>n Formalismus abzugeben, d.h. an diejenigen,<br />
die <strong>de</strong>n Formalismus aufgestellt haben, zu <strong>de</strong>legieren. Anwen<strong>de</strong>rInnen vertrauten<br />
somit <strong>de</strong>njenigen Interpretationen und Prozeduren, die die InformatikerInnen hervorgebracht<br />
haben und vorgeben wür<strong>de</strong>n. Das Problematische am Formalisieren, Mo<strong>de</strong>llieren<br />
und Abstrahieren besteht <strong>de</strong>mzufolge darin, dass diese Tätigkeit in mehrfacher Hinsicht<br />
politisch ist, jedoch in <strong>de</strong>r Informatik als neutral aufgefasst wird. Deshalb bedarf<br />
es <strong>de</strong>r sorgfältigen Rekonstruktion <strong>de</strong>s Politischen im „Formalen im Gebrauch“.<br />
Bowers theoretische Konzeption ermöglicht es, klare Verknüpfungen zwischen <strong>de</strong>m<br />
Formalen und <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht herzustellen. Ein äußerst überzeugen<strong>de</strong>s<br />
Beispiel, wie Formalismen im Gebrauch dichotome Vorstellungen von Zweigeschlechtlichkeit<br />
hervorbringen können, liegt aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Hirnforschung vor. Dort<br />
wer<strong>de</strong>n mit Hilfe von computertomografischen Verfahren Bil<strong>de</strong>r von Hirnarealen und<br />
ihren Aktivierungsmustern erzeugt, die insbeson<strong>de</strong>re in ihren populärwissenschaftlichen<br />
Interpretationen häufig als Abbil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Innern <strong>de</strong>s Gehirns gesehen wer<strong>de</strong>n. Da<br />
diese Bil<strong>de</strong>r zunehmend für das Argument genutzt wer<strong>de</strong>n, die Annahme kognitiver<br />
Differenzen zwischen Frauen und Männern biologisch zu begrün<strong>de</strong>n, zeigten feministische<br />
Naturwissenschaftskritikerinnen die zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n formalen Konstruktionsprozesse<br />
auf. So liegen Sigrid Schmitz zufolge zwischen <strong>de</strong>n Daten <strong>de</strong>s Scanners<br />
und <strong>de</strong>m konstruierten Bild eine Reihe von informationstechnischen Berechnungen und<br />
computergrafischen Verfahrensschritten: „Zur Bildrekonstruktion aus Streudaten, zur<br />
Bereinigung <strong>de</strong>r Daten von Rauscheffekten, zur Segmentierung und zur 3D-Bildrekonstruktion<br />
wird eine inzwischen fast unüberschaubare Menge von Berechnungsverfahren<br />
eingesetzt […]. Diese Verfahren wer<strong>de</strong>n von unterschiedlichen Laboratorien in<br />
unterschiedlichen Kombinationen angewandt, und dies stellt eines <strong>de</strong>r größten<br />
Probleme für die vergleichen<strong>de</strong> Analyse dar. Denn im Verlauf <strong>de</strong>r Konstruktionsprozesse<br />
wird eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen, was ins Bild hineinkommt, was<br />
weggelassen wird, was hervorgehoben wird o<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Hintergrund tritt“ (Schmitz<br />
2004, 12). Die Kliniken und Institutionen, in <strong>de</strong>nen via Tomografie Bil<strong>de</strong>r vom Gehirn<br />
erzeugt wer<strong>de</strong>n, können <strong>de</strong>mnach mit Bowers bzw. Latours Begriffsapparat als<br />
„Zentren <strong>de</strong>r Berechnung“ aufgefasst wer<strong>de</strong>n. Auch die Kombinierbarkeit,<br />
Dauerhaftigkeit und Mobilität <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen zum Einsatz kommen<strong>de</strong>n<br />
246 Vgl. hierzu auch <strong>de</strong>n nachfolgen<strong>de</strong>n Abschnitt 4.3.2., in <strong>de</strong>m die Subjekte <strong>de</strong>r Formalisierungsarbeit in<br />
<strong>de</strong>n Mittelpunkt <strong>de</strong>r Betrachtung gerückt wer<strong>de</strong>n.<br />
173
Formalismen wird anhand dieser knappen Beschreibung bereits <strong>de</strong>utlich. 247 Die<br />
Produkte <strong>de</strong>r Berechnung, die erzeugten Bil<strong>de</strong>r vom Gehirn, weisen schließlich eine<br />
optische Konsistenz auf, die mittlerweile durch <strong>de</strong>ren Verbreitung in <strong>de</strong>n populären<br />
Medien weithin bekannt ist. Insofern lassen sich computertomografische Bil<strong>de</strong>r vom<br />
Gehirn im engeren Sinne als Formalismen im Gebrauch verstehen. Schmitz weist<br />
weiter darauf hin, dass entlang <strong>de</strong>s beschriebenen Konstruktionsprozesses eine<br />
Vielzahl von Entscheidungen von <strong>de</strong>n Forschen<strong>de</strong>n getroffen wird, die über das im<br />
konstruierten Bild Sichtbare und Unsichtbare entschei<strong>de</strong>n. Dass diese Entscheidungen<br />
im Effekt nicht neutral sind, zeigt eine Untersuchung von Anelis Kaiser, Esther Kuenzli<br />
und Cordula Nitsch (2004) auf. Sie wies nach, dass es von <strong>de</strong>r Wahl eines statistischen<br />
Schwellenwertes bei <strong>de</strong>r Berechnung von Gruppenbil<strong>de</strong>rn abhängt, ob<br />
Geschlechterunterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Asymmetrie <strong>de</strong>r Sprachareale sichtbar wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r<br />
verschwin<strong>de</strong>n (vgl. hierzu auch Kaiser et al. submitted sowie Schmitz 2004, 13).<br />
Zusammen mit <strong>de</strong>n Ergebnisse von Schmitz erweist sich die betrachtete Sichtbarkeit<br />
o<strong>de</strong>r Unsichtbarkeit von Geschlechterdifferenz als eine Konstruktion, die aus <strong>einer</strong><br />
Reihe relativ willkürlicher Entscheidungen über Berechnungsverfahren und Schwellenwerte<br />
aufgebaut ist. Die Autorinnen entkräften damit nicht nur das weit verbreitete<br />
Vorurteil, dass Frauen sprachbegabter seien und dies hirnphysiologisch begründbar<br />
ist, 248 son<strong>de</strong>rn wi<strong>de</strong>rlegen die Annahme, dass Formalismen in <strong>de</strong>r Anwendung<br />
geschlechtsneutral seien.<br />
Erfahrung in Klassifikationen und Standards: Die moralische Ordnung <strong>de</strong>s<br />
Wissens in Informationssystemen<br />
Die Politik <strong>de</strong>s Formalen hat, wie bis hierher <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n ist, verschie<strong>de</strong>ne<br />
Facetten. Sie beginnt nicht erst dann, wenn die von Bowers charakterisierten mathematischen<br />
Formalismen und Softwareprogramme o<strong>de</strong>r die von Schmitz skizzierten<br />
Algorithmen ins Spiel kommen. Vielmehr entschei<strong>de</strong>n häufig bereits die vorausgehen<strong>de</strong>n<br />
Prozesse <strong>de</strong>r Standardisierung und Klassifizierung grundlegend über Zugehörigkeit<br />
o<strong>de</strong>r Ausschluss, über die Bevorzugung bestimmter Handlungen und die<br />
Benachteilung an<strong>de</strong>rer Repräsentationen. Bowker und Star (1999) haben eine Reihe<br />
von technischen Standards und Klassifikationssystemen 249 untersucht und <strong>de</strong>ren<br />
politische, soziale und individuelle Konsequenzen aufgezeigt. 250 Sie gehen davon aus,<br />
247 Für eine ausführlichere, aber <strong>de</strong>nnoch allgemein verständliche Beschreibung <strong>de</strong>r eingesetzten<br />
formalen Verfahren vgl. etwa Schmitz 2003, 224ff.<br />
248 Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n im Feld bekannten Erkenntnissen zeigte eine weitere Untersuchung bilaterale<br />
Muster bei Frauen und laterale Muster bei Männern auf, vgl. Kaiser et al. 2007.<br />
249 Sie diskutieren die internationale Klassifizierung von Krankheiten (ICD), die Klassifizierung von Rasse<br />
in Zeiten <strong>de</strong>r Apartheid in Südafrika und die von Arbeitspraktiken von KrankenpflegerInnen (NIC), auf die<br />
hier bereits ausführlich Bezug genommen wur<strong>de</strong>.<br />
250 Bowker und Star unterschei<strong>de</strong>n Standards von Klassifikation und geben folgen<strong>de</strong> Definition: „A<br />
classification is a spatial, temporal or spatio-temporal segmentation of the world.” (Bowker/ Star 1999, 10).<br />
I<strong>de</strong>alerweise erfüllt ein Klassifikationssystem folgen<strong>de</strong> Bedingungen: 1. ist es wi<strong>de</strong>rspruchsfrei und hat<br />
klare Prinzipien, wie es anzuwen<strong>de</strong>n sei. 2. schließen sich die Kategorien gegenseitig aus. 3. ist das<br />
System vollständig. Bowker und Star bemerken jedoch, dass sie kein funktionieren<strong>de</strong>s Klassifikationssystem<br />
beobachten konnten, das diese „simplen“ Kriterien erfüllt, und bezweifeln, dass es ein solches<br />
jemals geben kann (vgl. ebd., 10ff). Demgegenüber verstehen sie Standards als Regeln für die Produktion<br />
von (diskursiven o<strong>de</strong>r materiellen) Objekten, über die eine Übereinkunft in mehreren „communities of<br />
practice“ hergestellt wor<strong>de</strong>n ist. Standards übersetzten zwischen Raum, Zeit und heterogenen Maßstäben<br />
und wür<strong>de</strong>n zumeist von juristischen Institutionen aufgestellt. Wichtig sei zu bemerken, dass sich nicht<br />
immer <strong>de</strong>r beste technische Standard durchsetzt (vgl. hierzu etwa die Diskussion <strong>de</strong>r QWERTY-Tastatur<br />
174
dass Klassifizierungen und Standardisierungen von Wissen sich zunehmend in<br />
technologischen Infrastrukturen manifestieren, von <strong>de</strong>nen Software- und Informationssysteme<br />
wesentliche Bestandteile sind. Dass diese Ordnungsschemata häufig<br />
Ausdruck dahinter liegen<strong>de</strong>r sozialer Aushandlungsprozesse sind, <strong>de</strong>monstrierten<br />
bereits einfache Klassifizierungen und Standards. So <strong>de</strong>uteten beispielsweise<br />
Telefonbücher, die für verheiratete heterosexuelle Paare nur <strong>de</strong>n Namen <strong>de</strong>s Mannes<br />
angeben, auf eine heteronormative, androzentrische Gesellschaftsordnung, während<br />
die Auflistung <strong>de</strong>r „Gay and Lesbian Pri<strong>de</strong> Para<strong>de</strong>“ unter <strong>de</strong>n üblichen, jährlichen<br />
Veranstaltungen <strong>de</strong>r Stadt auf eine zunehmen<strong>de</strong> öffentliche Akzeptanz von Homosexualität<br />
verwiese, die über Deka<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Aktivismus und <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />
erkämpft wor<strong>de</strong>n ist (vgl. Bowker/ Star 1999, 56f). Klassifizierungen und Standards<br />
sind <strong>de</strong>mnach nicht gegeben, son<strong>de</strong>rn gemacht. Ihre Herstellung folgt dabei<br />
bestimmten Kriterien, die selbst oft unsichtbar sind und <strong>de</strong>ren moralische und ethische<br />
Dimension verbergen. „[S]tandards and classification schemes do not always obviously<br />
intersect those variables and processes familiar to us in analyzing human interaction:<br />
gen<strong>de</strong>r, race, status, career, power, innovation trajectories, and so forth“ (Star 2002,<br />
110) Die Schwierigkeit besteht hier ebenso wie bei <strong>de</strong>n Formalismen darin, das<br />
Verborgene aufzu<strong>de</strong>cken. Um das Politische und Geschlechtliche in Klassifikationen<br />
und Standards zu rekonstruieren, schlägt Star nicht nur vor, <strong>de</strong>n Gebrauch dieser<br />
Schemata zu untersuchen. Sie hält <strong>de</strong>taillierte ethnografische Analysen für<br />
notwendig. 251<br />
Abgesehen von <strong>de</strong>m hier bereits ausführlich erörterten Klassifikationssystem NIC für<br />
Pflegehandlungen sowie <strong>einer</strong> Untersuchung zum Chip<strong>de</strong>sign, die allerdings wenig<br />
Gen<strong>de</strong>rrelevanz hat, liegen von Susan Leigh Star keine Fallstudien aus <strong>de</strong>m Umfeld<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte vor. Allerdings wur<strong>de</strong>n ihre theoretischen Ausführungen über<br />
die zum Schweigen gebrachten Stimmen bei <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation und die<br />
Unsichtbarkeit dieser Prozesse (vgl. Star 1991a) in feministischen Kreisen <strong>de</strong>r<br />
Informatik breit rezipiert. Darin erzählt sie die Geschichte ihrer eigenen Allergie gegenüber<br />
rohen und halbgegarten Zwiebeln, um zu ver<strong>de</strong>utlichen, dass selbst harmlos<br />
erscheinen<strong>de</strong> Abweichungen vom Standard für diejenigen, die nicht dazugehören, Ausschlüsse<br />
darstellen und <strong>de</strong>shalb politische Wirkungen haben können. Mit ihrer Zwiebelallergie<br />
machte sie bei beispielsweise McDonald‘s die Erfahrung, dass sie eine<br />
dreiviertel Stun<strong>de</strong> auf ihr Essen warten musste, wenn sie es „ohne Zwiebeln“ bestellte.<br />
Schneller käme sie dagegen zu einem Essen, wenn sie die Zwiebeln von ihrem Burger<br />
abkratzte, da <strong>de</strong>r hoch standardisierte Produktionsapparat von Hamburgern nicht in <strong>de</strong>r<br />
Lage sei, Ausnahmefälle zu behan<strong>de</strong>ln. Doch auch in renommierten Restaurants hätte<br />
sie häufig Probleme, da ihr die kleine Abweichung vom Üblichen nicht abgenommen<br />
wür<strong>de</strong>: „one of the most robust cross-cultural, in<strong>de</strong>ed cross-class, cross-national<br />
phenomena I have ever encountered is a curious reluctance by waiters to believe that I<br />
am allergic to onions“ (Star 1991b, 35). An<strong>de</strong>rs als etwa für salzfreie, koschere o<strong>de</strong>r<br />
am Anfang <strong>de</strong>s Kapitels). Trotz<strong>de</strong>m hätten Standards eine erhebliche Trägheit, sie zu verän<strong>de</strong>rn sei<br />
schwer und teuer, vgl. Bowker/ Star 1999, 13.<br />
251 Star weist darauf hin, dass wissenschaftliche Standards und Klassifikationen häufig aus kontroversen,<br />
intra- und interdisziplinären Auseinan<strong>de</strong>rsetzungen hervorgingen und betont: „The job of an ethnographer<br />
of scientific practice and the information contained within […] is to raise the second- and third-or<strong>de</strong>r<br />
questions about the existence and nature of the whole classification scheme, the taken-for-granted tools<br />
used in intra- and interdisciplinary communication“ (Star 2002, 116).<br />
175
vegetarische Kost, gäbe es keine beachtenswerte Nachfrage nach Speisen für<br />
Menschen mit Zwiebelallergien. Die Anekdote steht für <strong>de</strong>n Ausschluss all <strong>de</strong>rer, die<br />
vom vorgegebenen Standard auf unsichtbare, ungewöhnliche o<strong>de</strong>r stigmatisierte<br />
Weise abweichen.<br />
Ein typisches Vorgehen in <strong>de</strong>r Informatik, mit <strong>de</strong>rartigen Ausnahmefällen umzugehen,<br />
besteht darin, diese zu i<strong>de</strong>ntifizieren, zu spezifizieren und in das technische<br />
System zu integrieren: es wer<strong>de</strong>n neue Menüoptionen hinzugefügt, barrierefreie Webseiten<br />
konstruiert, beson<strong>de</strong>re Hilfen angeboten o<strong>de</strong>r eine Form <strong>de</strong>r nutzerInnenzentrierten<br />
Gestaltung von Technologie angewandt. In <strong>de</strong>n letzten Jahren lässt sich in <strong>de</strong>r<br />
Informatik zunehmend eine Politik <strong>de</strong>s Einschlusses beobachten, um <strong>de</strong>n vielfältigen<br />
möglichen Beson<strong>de</strong>rheiten von NutzerInnen gerecht wer<strong>de</strong>n zu können. Zu diesen<br />
Anspruch von InformatikerInnen bemerkt Star ironisch: „They make it seem as if the<br />
matter of technology were expanding the exhaustive search for ‚special needs‘ until<br />
they are all tailored or customized“ (Star 1991b, 36). Flexibilität sei ein machtvolles<br />
Versprechen, das insbeson<strong>de</strong>re im Bereich wissensbasierter Technologien vorherrschen<br />
wür<strong>de</strong>. Star warnt jedoch vor <strong>de</strong>r Chimäre unendlicher Flexibilität. Denn<br />
Universalitätsbehauptungen seien eine Illusion, mit <strong>de</strong>ren Hilfe stets Ausschlüsse<br />
herstellt wür<strong>de</strong>n, ggf. auch neue, die zuvor nicht beachtet wor<strong>de</strong>n sind. Zu<strong>de</strong>m stün<strong>de</strong>n<br />
Standards <strong>de</strong>m Phänomen multipler I<strong>de</strong>ntitäten gegenüber. Denn Menschen wür<strong>de</strong>n<br />
nicht nur eine einzige, feststehen<strong>de</strong> I<strong>de</strong>ntität haben, son<strong>de</strong>rn gleichzeitig unterschiedlichen<br />
sozialen Welten angehören. Standards wür<strong>de</strong>n jedoch die gelebte Erfahrung<br />
vielfältiger Zugehörigkeit, aber auch multipler Marginalisierung nicht gerecht. So könnten<br />
<strong>einer</strong>seits vorgegebene Handlungsanweisungen aufgrund <strong>de</strong>r einen Zugehörigkeit<br />
mit <strong>de</strong>n Standards <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren sozialen Welt für ein und dieselbe Person kollidieren.<br />
An<strong>de</strong>rerseits gäbe es Menschen, die in einem Klassifikationssystem, das zwei und nur<br />
zwei Optionen anbietet, nicht verortbar seien. Star erläutert die nichtmögliche<br />
Zuordnung anhand <strong>einer</strong> transsexuellen Person in <strong>de</strong>r Phase ihrer Transition.<br />
Transsexuelle hätten in <strong>de</strong>n USA ohne körperlich-operativen Geschlechtswan<strong>de</strong>l im<br />
gewählten Geschlecht zwei Jahre lang überzeugend zu leben, bevor ihr körperlicher<br />
Geschlechtswan<strong>de</strong>l legitim sei und ggf. von <strong>de</strong>r Krankenkasse bezahlt wür<strong>de</strong>. 252 In<br />
dieser Zeit vor ihrer Operation seien Transsexuelle we<strong>de</strong>r Frau noch Mann, son<strong>de</strong>rn<br />
befän<strong>de</strong>n sich in <strong>einer</strong> „Hochspannungszone“ <strong>de</strong>r Nicht-Zugehörigkeit, die Star als<br />
„Nullpunkt“ zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Polen großer Dichotomien wie Frau/Mann,<br />
Gesellschaft/Technik, entwe<strong>de</strong>r/o<strong>de</strong>r versteht. Um ihre Argumentation zuzuspitzen,<br />
bringt Star an dieser Stelle die Erfahrung von Folter ins Spiel, die die I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r<br />
Gefolterten auszuradieren vermag. Folter und angeblich universelle wissensbasierte<br />
Systeme wiesen eine frappieren<strong>de</strong> Ähnlichkeit auf, auch wenn bei letzteren keine<br />
252 Die formalen Regelungen und Rahmenbedingungen geschlechtlicher Transition sind kultur- und<br />
län<strong>de</strong>rspezifisch unterschiedlich. In Deutschland etwa verlangte das Transsexuellengesetz bis vor<br />
Kurzem, dass eine AntragstellerIn, die sich nicht <strong>de</strong>m im Geburtsregister festgestellten, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>m<br />
„an<strong>de</strong>ren“ Geschlecht zugehörig fühlt, „seit min<strong>de</strong>stens drei Jahren unter <strong>de</strong>m Zwang“ stehen muss, ihren<br />
Vorstellungen entsprechend zu leben, vgl. <strong>de</strong> Silva 2005, 260. Der Gesetzgeber weist <strong>de</strong>r Medizin zu,<br />
einen Fall von Transsexualität festzustellen, vgl. ebd., 259. Die <strong>de</strong>utschen Standards zur Behandlung und<br />
Begutachtung von Transsexuellen empfehlen vor <strong>de</strong>r Indikation zur Hormonbehandlung u.a. einen<br />
einjährigen Alltagstest, in <strong>de</strong>r / die Transperson das Leben im gewünschten Geschlecht erprobt. Im<br />
Vereinigten Königreich hingegen schreibt das „Gen<strong>de</strong>r Recognition Act“ vor, dass die/<strong>de</strong>r AntragstellerIn<br />
bis zum Zeitpunkt <strong>de</strong>r Antragstellung zwei Jahre im „erworbenen“ Geschlecht gelebt haben muss, vgl. <strong>de</strong><br />
Silva 2007, 86. Der ggf. anfallen<strong>de</strong> medizinische Aspekt wird im Gesetz nicht näher vorgeschrieben.<br />
176
Gewalt vorzukommen scheint: „A set of uncertainties is translated into certainty, old<br />
i<strong>de</strong>ntities are discar<strong>de</strong>d, and the focus of the world is narrowed into a set of facts. …<br />
We always have elements of uncertainty about the personal world of another,<br />
especially about pain and suffering“ (Star 1991a, 89). Durch <strong>de</strong>n Vergleich von<br />
wissensbasierten Systemen mit <strong>einer</strong> harmlosen Zwiebelallergie o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r krassen<br />
Erfahrung von Folter wur<strong>de</strong> ein Muster <strong>de</strong>utlich: „Standardized representations seem to<br />
insist on annihilating our personal experience, and there is the suffering“ (ebd.).<br />
Während Bowers von <strong>einer</strong> Gewalt formaler Repräsentationen sprach, die aus <strong>de</strong>m<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch zwischen <strong>de</strong>m politischen Charakter und vermeintlicher Objektivität von<br />
Formalismen resultierte, macht Star darauf aufmerksam, dass bereits unschuldig<br />
erscheinen<strong>de</strong> Standards und Klassifizierungen Lei<strong>de</strong>n hervorbringen können. Dies ist<br />
ein wichtiger Hinweise für InformatikerInnen, die ständig solche Klassifizierungen<br />
vornehmen und Standards als Basis informationstechnologischer Systeme entwickeln.<br />
Insgesamt konkretisiert Star anhand <strong>de</strong>s Allergiebeispiels theoretische Argumente,<br />
die bereits in <strong>de</strong>r Diskussion um das prozedurale Wissen („knowing how“) und <strong>de</strong>klarative<br />
Wissen („knowing that“) am Anfang dieses Kapitels 4.3 angesprochen wur<strong>de</strong>n.<br />
Formalisierung produziere Ausschlüsse von Wissensbestän<strong>de</strong>n und -formen. Stars<br />
Beispiele erzeugen eine Sensibilität für die Inkongruenzen zwischen Wissensformationen,<br />
die Bestimmtes sichtbar und an<strong>de</strong>res unsichtbar machen, und für multiplen<br />
I<strong>de</strong>ntitäten bzw. multiplen Marginalisierungen – eine grundlegen<strong>de</strong> Erkenntnis für<br />
InformatikerInnen, die Wissen und Information durch technische Informationssysteme<br />
gestalten.<br />
Sarah Willis (1997) untersuchte <strong>de</strong>n Zusammenhang von Wissensordnungen (d.h.<br />
Präsenz/Absenz bei <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation) und <strong>de</strong>r Geschlechterordnung konkret<br />
anhand eines klinischen Informationssystems namens HIPPOCRATES. 253 Dabei<br />
versteht sie die Politik von Informationssystemen als „set of sanctioning practices that<br />
are concerned with or<strong>de</strong>r, with what can represented, how and by whom“ (Willis 1997,<br />
156). Ihre Rekonstruktion <strong>de</strong>r Ordnungspraktiken, die zu <strong>de</strong>m in HIPPOCRATES<br />
repräsentierten Wissen führten, zeigt, dass das System auf <strong>de</strong>r Grundannahme beruht,<br />
dass „Information“ <strong>de</strong>n Schlüssel zum Gesundheitswesen darstellt und ihr ein<br />
objektiver ökonomischer Wert zugeschrieben wird. Das Grundkonzept Information, sein<br />
Management und seine Nutzung zur Argumentation konstituierten – Willis zufolge –<br />
eine neue Ordnung <strong>de</strong>s klinischen und pflegerischen Wissens, die zwischen rationalen<br />
und informellen Anteilen <strong>de</strong>s medizinischen Wissens differenziert. Ihre Analyse <strong>de</strong>r<br />
Informationen, die in <strong>de</strong>m System präsent und die dort abwesend sind, macht die<br />
wesentlichen Grenzziehungen sichtbar, auf <strong>de</strong>nen HIPPOCRATES beruht: „In making<br />
distinctions between conceptual and other types of medical information, Hippocrates<br />
differentiates between ‚real‘ medical knowledge (i.e. that which can be separated from<br />
the body and represented formally in an information system as universally accepted<br />
facts about the clinical world) and general medical information which relies on context<br />
(and hence is not always real or true)“ (Willis 1997, 156). HIPPOCRATES enthält<br />
aufgrund seines Repräsentationsmechanismus somit nur das anerkannte medizinische<br />
Wissen, das auf diese Weise privilegiert wird gegenüber an<strong>de</strong>ren Wissensformen.<br />
253 HIPPOCRATES ist ein klinisches Informationssystem, das Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre im Rahmen eines<br />
EU-Projekts mit einem Dutzend europäischer PartnerInnen entwickelt wur<strong>de</strong>.<br />
177
Letztere wer<strong>de</strong>n nicht formalisiert und dargestellt. Britta Schinzel sieht darin eine<br />
Transformation vom Spezifischen und Empirischen zum Allgemeinen, Logisch-<br />
Kausalen und Theoretischen, das <strong>de</strong>n Effekt hätte, „daß Kausalitäten erzeugt und<br />
suggeriert wer<strong>de</strong>n, wo vielleicht gar keine sind, daß Konzepte von Ökonomie und<br />
Effizienz eingeschleust wer<strong>de</strong>n, wo vorher an<strong>de</strong>rs optimiert wur<strong>de</strong> und daß die<br />
Gesundheitspflege vielleicht Konzepten gehorchen muß, die ihr eigentlich fremd sind.<br />
Hier wer<strong>de</strong>n heterogene Einheiten von Informationen und Ereignissen in <strong>de</strong>r Pflege<br />
kontrollierbar und homogener gemacht, so daß sie eine vereinfachte, aber gangbare<br />
Repräsentation bil<strong>de</strong>n“ (Schinzel 1999, 79).<br />
Willis geht davon aus, dass <strong>de</strong>m beschriebenen formalen Zugang zur Welt eine<br />
bestimmte Form <strong>de</strong>r Macht eingeschrieben ist, die sie mit Latour als „moralische<br />
Ordnung“ bezeichnet. 254 Dabei be<strong>de</strong>utet Moral, dass <strong>de</strong>n Ordnungspraktiken, welche<br />
die Unterscheidung o<strong>de</strong>r Grenzziehung konstituierten, ein Sinn, etwa <strong>de</strong>r Erhalt von<br />
Machtbeziehungen zugrun<strong>de</strong> liegt, <strong>de</strong>r allerdings herauszuarbeiten ist. Im Fall von<br />
HIPPOCRATES sei die konstituierte moralische Ordnung vergeschlechtlicht, da nur<br />
das formale und medizinisch anerkannte Wissen im Informationssystem repräsentiert<br />
ist, während an<strong>de</strong>re, eher als „weiblich“ konnotierte Formen medizinischer Information,<br />
die erst in <strong>de</strong>r sprachlichen Umschreibung Be<strong>de</strong>utung gewinnen, ausgeschlossen sind.<br />
Das Informationssystem basiere <strong>de</strong>shalb auf <strong>de</strong>r Präsenz männlich“ geprägter Rationalität.<br />
Willis zeigt somit, dass auch die vermeintliche Abwesenheit von Geschlechterverhältnissen<br />
in <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation als Einschreibung von Geschlecht in Informationssysteme<br />
aufgefasst wer<strong>de</strong>n kann. Informationssysteme als rational, wertfrei und<br />
geschlechtsneutral auszuweisen, sei „a political strategy that makes it possible for<br />
political discourses to <strong>de</strong>ny or manage their politicality“ (Willis 1997, 159). Ein von<br />
<strong>de</strong>ssen Entstehung abstrahieren<strong>de</strong>s Informationssystem leugne somit die Politik s<strong>einer</strong><br />
Erzeugung und <strong>de</strong>r damit etablierten Wissensordnung. Ähnlich wie bei <strong>de</strong>r Wahl von<br />
Algorithmen und Grenzwerten in <strong>de</strong>r Hirnforschung, die zu <strong>einer</strong> naturwissenschaftlich<br />
legitimierten Konstruktion binärer Geschlechterdifferenz auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Kognition<br />
führen kann, bleiben hier sozial wirksame Entscheidungen, die <strong>de</strong>r technischen<br />
Entwicklung zugrun<strong>de</strong> liegen, unter <strong>de</strong>m Deckmantel <strong>de</strong>s als objektiv <strong>de</strong>klarierten<br />
technischen Systems verborgen.<br />
Willis‘ Argumentation scheint auf <strong>de</strong>n ersten Blick ein ähnliches Problem<br />
aufzuwerfen, wie die Fallstudien aus <strong>de</strong>m Abschnitt 4.1, die – um einen Ausschluss<br />
von Frauen belegen zu können – auf klare, feststehen<strong>de</strong> Definitionen Eigenschaften<br />
o<strong>de</strong>r Fähigkeiten von Frauen zurückgreifen müssen und damit selbst Zweigeschlechtlichkeit<br />
und Geschlechterhierarchisierungen essentialisieren. Während dort jedoch mit<br />
<strong>de</strong>r Behin<strong>de</strong>rung im Zugang zu Technologien für bestimmte Subjekte strukturell argumentiert<br />
wur<strong>de</strong>, diskutiert Willis das Sichtbare und Unsichtbare, die Inklusion und<br />
Exklusion auf <strong>einer</strong> symbolischen Ebene. Das in <strong>de</strong>m System Repräsentierte und<br />
damit Bevorzugte, d.h. das Rationale und das, was als medizinisch anerkanntes Wissen<br />
gilt, sei „männlich“ konnotiert. Der Ausschluss <strong>de</strong>s „Weiblichen“ liegt in diesem Fall<br />
somit primär im Bereich <strong>de</strong>r Zuschreibungen und Be<strong>de</strong>utungen. Das schließt jedoch<br />
nicht aus, dass formale Wissensrepräsentationen im Gebrauch ebenso an <strong>de</strong>r<br />
254 Unter <strong>einer</strong> moralischen Ordnung versteht Latour „a world view which embodies notions about the<br />
character and capacity of different entities, the relationship between them, their relative boun<strong>de</strong>dness, and<br />
the associated patterns of rights and responsibilities“ (Latour 1987, 66).<br />
178
Aufrechterhaltung <strong>de</strong>r strukturellen Geschlechterhierarchie mitwirken, vielmehr hängt<br />
die symbolische Geschlechterordnung eng mit <strong>de</strong>r strukturellen zusammen (vgl. hierzu<br />
auch Scheich 1993 sowie Saupe 2002). 255<br />
Vergegenständlichte Ontologien: Verstärker von Macht- und<br />
Geschlechterverhältnissen<br />
Ein im Bereich <strong>de</strong>s „Computer Supported Cooperative Work“ (CSCW) viel diskutiertes<br />
System, an <strong>de</strong>m sich das Argument <strong>de</strong>r Verfestigung bestehen<strong>de</strong>r Geschlechterverhältnisse<br />
gut veranschaulichen lässt, ist THE COORDINATOR, ein frühes Email-<br />
System für <strong>de</strong>n Einsatz in Organisationen, das von Terry Winograd und Fernando<br />
Flores (1989 [1986]) auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r Sprechakttheorie entwickelt wur<strong>de</strong> (vgl. Austin<br />
1961). Das System konstituiert zwar keine Wissensordnung. Es basiert jedoch auf<br />
<strong>einer</strong> Ontologie <strong>de</strong>r Kommunikation, in<strong>de</strong>m es <strong>de</strong>n NutzerInnen explizite Kategorien<br />
von Sprechakten zur Verfügung stellt, mit <strong>de</strong>ren Hilfe sie ihre Kommunikationsabsicht<br />
formulieren können. Die NutzerInnen erhalten die Möglichkeit, auf regelmäßig wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong><br />
Muster <strong>de</strong>r Kommunikation in <strong>de</strong>r Organisation zurückzugreifen wie beispielsweise<br />
Anfragen, Zusagen o<strong>de</strong>r Abschlusserklärungen. Winograd und Flores<br />
sehen <strong>de</strong>n Vorteil <strong>de</strong>s Systems und s<strong>einer</strong> zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Ontologie darin, dass<br />
es <strong>de</strong>n NutzerInnen die Struktur <strong>de</strong>r Sprache, mit <strong>de</strong>r sie im Unternehmen<br />
kommunizieren, bewusst macht. Es hätte insofern eine aufklärerische und die Kommunikation<br />
vereinfachen<strong>de</strong> Funktion: „By teaching people an ontology of linguistic action,<br />
groun<strong>de</strong>d in simple, universal distinctions such as those of requesting and promising,<br />
we find that they become more aware of these distinctions in their everyday work and<br />
life situations. They can simplify their <strong>de</strong>alings with others, reduce time and effort spent<br />
in conversations that do not result in action, and generally manage actions in a less<br />
panicked, confused atmosphere“ (Flores et al. 1988, 158). Die Absicht, die die<br />
Entwickler mit <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>de</strong>s Systems verfolgen, lässt sich <strong>de</strong>mnach als eine<br />
emanzipatorische verstehen.<br />
Suchman (1994) weist jedoch darauf hin, dass sich hinter Kategorien wie „Anfrage“<br />
o<strong>de</strong>r „Versprechen“ in <strong>de</strong>r Praxis hochkomplexe Phänomene stehen, welche die<br />
Entwickler als zu einfach konzipiert hätten. Sie kritisiert, dass „the adoption of speech<br />
act theory as a foundation of systems <strong>de</strong>sign […] carries with it an agenda of discipline<br />
and control over organisation member’s actions.“ (Suchman 1994, 178). Das Kategoriensystem<br />
hätte die Funktion, Grenzen sozialer I<strong>de</strong>ntität zu kontrollieren und die<br />
Subjekte (im Sinne Foucaults) zu disziplinieren. 256 Diese soziale Differenzierung müsse<br />
von <strong>de</strong>n NutzerInnen für die sinnvolle Nutzung übernommen wer<strong>de</strong>n. die Die<br />
Anwendung <strong>de</strong>s Systems setze <strong>de</strong>ren Selbstdisziplinierung bei <strong>de</strong>r Kommunikation<br />
voraus. Flores et al. (1988) wür<strong>de</strong>n selbst darlegen, dass ihr System in <strong>de</strong>njenigen<br />
255 Dieser Zusammenhang wird spätestens „im Gebrauch“ formaler Wissensrepräsentationen <strong>de</strong>utlich. Im<br />
betrachteten Fall <strong>de</strong>s medizinischen Informationssystems korreliert etwa <strong>de</strong>r Ausschluss <strong>de</strong>s „weiblich“<br />
konnotierten nichtformalen medizinischen Wissens damit, dass alternative Medizin und Wellness<br />
vorwiegend von Frauen angeboten und genutzt, jedoch vom Gesundheitssystem nicht honoriert wer<strong>de</strong>n.<br />
256 Es wäre spannend, Informations- und Softwaresysteme weitergehend mit Foucault als „Technologien<br />
<strong>de</strong>s Selbst“ zu untersuchen und sie als Subjektivierungsformen im Rahmen soziotechnischer<br />
Machtverhältnisse zu verstehen. Im Kontext dieser Arbeit wäre dazu jedoch zunächst ein theoretisches<br />
Konzept zu entwickeln, wie dieser Ansatz in Bezug auf die Konstruktionsphase gedacht wer<strong>de</strong>n kann. Für<br />
eine Deutung von Internet- und Kommunikationstechnologien als „Technologien <strong>de</strong>s vernetzten Selbst“<br />
(Paulitz 2005), vgl. auch Paulitz/ Weber 1999.<br />
179
Organisationen am erfolgreichsten ist, in <strong>de</strong>nen die Machtverhältnisse stabil sind und<br />
die NutzerInnen sich im Klaren darüber sind, welche Position und Macht sie dort innehaben.<br />
„We are primarily <strong>de</strong>signing for settings in which the basic parameters of<br />
authority, obligation and cooperation are stable“ (Flores et al 1988, 168). Daraus<br />
schließt Suchman: „Rather than being a tool for collaborative production of action, in<br />
other words, THE COORDINATOR on this account is a tool for the reproduction of an<br />
established social or<strong>de</strong>r“ (Suchman 1994, 186). Suchmans Argumentation folgend<br />
reproduziert das System – entgegen <strong>de</strong>r emanzipatorischen Absicht <strong>de</strong>r Entwickler –<br />
bestehen<strong>de</strong> soziale Ordnungen. Das gilt auch für geschlechtshierarchische Strukturen.<br />
THE COORDINATOR vermag womöglich die NutzerInnen zum Nach<strong>de</strong>nken über und<br />
zum klaren Definieren von Kommunikationsabsichten zu bringen, jedoch verhin<strong>de</strong>re<br />
das System, die eigene Machtposition o<strong>de</strong>r existieren<strong>de</strong> Geschlechterverhältnisse<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Organisation zu reflektieren. Die Winograd und Flores intendierten<br />
selbstreflexiven Effekte bei <strong>de</strong>n NutzerInnen umfassen somit keine gesellschafts<strong>kritisch</strong>e<br />
und feministische Reflexion auf die eigene Position, son<strong>de</strong>rn stün<strong>de</strong>n <strong>einer</strong><br />
solchen eher entgegen. Insofern ließe sich THE COORDINATOR als ein „Verstärker“<br />
bestehen<strong>de</strong>r Herrschaftsverhältnisse und Geschlechterhierarchien verstehen.<br />
An<strong>de</strong>re KritikerInnen <strong>de</strong>s Systems verweisen darauf, dass die NutzerInnen<br />
gezwungen wür<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Ontologie <strong>de</strong>s Systems zu folgen, wenn sie es anwen<strong>de</strong>n<br />
wollen. Dieses Phänomen hat Bowers (1992) als „Delegation“ (<strong>de</strong>r NutzerInnen an das<br />
System) beschrieben. Dieser Begriff suggeriert, dass NutzerInnen stets aktiv, bewusst<br />
und rational entschei<strong>de</strong>n, ob sie die Ontologie anerkennen und benutzen o<strong>de</strong>r ablehnen<br />
wollen (und beispielsweise ein an<strong>de</strong>res System benutzen) – eine Voraussetzung,<br />
die bei <strong>de</strong>r Anwendung im Arbeitskontext in <strong>de</strong>r Regel nicht gegeben sein wird und<br />
auch in <strong>de</strong>r privaten Nutzung stark von <strong>einer</strong> technischen Expertise abhängt. Crutzen<br />
(2007) dagegen spricht von einem (durch die GestalterInnen) „bereitgelegten Han<strong>de</strong>ln“<br />
und sieht darin eine Beschränkung <strong>de</strong>r Handlungsfähigkeit von NutzerInnen, sofern für<br />
diese Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Artefaktes nicht mehr möglich sind o<strong>de</strong>r<br />
erschwert wer<strong>de</strong>n. „Die Annahmen <strong>de</strong>r Hersteller wer<strong>de</strong>n im bereit gelegten Han<strong>de</strong>ln<br />
<strong>de</strong>s künstlichen Produktes vorab eingebettet. Die Interpretation und Repräsentation ist<br />
teils erledigt, bevor das Produkt gebrauchsfertig ist und die Tätigkeiten <strong>de</strong>r künstlichen<br />
Aktoren stattfin<strong>de</strong>n. Die Art, wie ein künstlicher Aktor interpretiert und repräsentiert,<br />
hängt somit nicht nur von <strong>de</strong>r Benutzeraktivität, son<strong>de</strong>rn auch vom bereitgelegten<br />
Han<strong>de</strong>ln ab, welches vorab konstruiert wur<strong>de</strong>.“ (Crutzen 2007, 40). An dieser Stelle ist<br />
zu bemerken, dass sich das Konzept <strong>de</strong>s bereitgelegten Han<strong>de</strong>lns von <strong>de</strong>m <strong>de</strong>s<br />
Skripts (vgl. Kapitel 3.7) grundlegend unterschei<strong>de</strong>t. Denn das durch die Designer<br />
bereitgelegte Han<strong>de</strong>ln umfasst mehr als nur implizite und explizite NutzerInnenrepräsentationen.<br />
Es beruht vielmehr häufig durch <strong>de</strong>n Bezug auf eine wissenschaftlich anerkannte<br />
Theorie (in <strong>de</strong>m von Suchman angeführten Beispiel die Sprechakttheorie) auf<br />
<strong>einer</strong> scheinbar objektiven Darstellung <strong>de</strong>r Interaktion zwischen NutzerInnen und Artefakt.<br />
Aufgrund <strong>einer</strong> solchen Ontologie <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lns bzw. Interagierens wird das Han<strong>de</strong>ln<br />
– Crutzen zufolge – zu <strong>einer</strong> festgefahrenen Routine, die nicht mehr verhan<strong>de</strong>lbar<br />
bleibt o<strong>de</strong>r geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann. 257<br />
257 Crutzen bezieht sich dabei auf John Dewey, <strong>de</strong>r zwischen Gewohnheiten und Routinen unterschei<strong>de</strong>t.<br />
Gewohnheiten entstün<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m Menschen aus <strong>de</strong>n Wirkungen lernten, die ihre Handlungen in<br />
bestimmten Situationen haben. Sie führten „in Interaktionswelten, durch Wie<strong>de</strong>rholung und Imitation, zu<br />
180
Suchmans Kritik an THE COORDINATOR geht über die Standpunkte Bowers und<br />
Crutzens, die entwe<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n NutzerInnen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n GestalterInnen <strong>de</strong>r technischen<br />
Systeme die volle Verantwortung übergeben, hinaus. Denn sie betont, dass technische<br />
Systeme selbst dann Herrschaftsverhältnisse verfestigen können, wenn die TechnologiegestalterInnen<br />
emanzipatorische Ziele verfolgen. Diese sind auch dann wirksam,<br />
wenn <strong>de</strong>m Gegenstand <strong>de</strong>r Formalisierung, <strong>de</strong>r Ontologie (hier <strong>de</strong>r Sprechakttheorie),<br />
zunächst keine explizite Hierarchisierung eingeschrieben ist, die durch die Technologie<br />
reproduziert o<strong>de</strong>r verstärkt wür<strong>de</strong> (vgl. hierzu Kapitel 4.2.2). Strukturelle Machtverhältnisse<br />
durch Technologie wären vielmehr mit <strong>de</strong>n durch Technologie vorgegebenen<br />
Denk- und Handlungsweisen und <strong>de</strong>n Selbstdisziplinierungen <strong>de</strong>r NutzerInnen verwoben.<br />
Die Prozesse <strong>de</strong>r Einschreibung von Macht, Herrschaft und Geschlecht seien<br />
<strong>de</strong>mzufolge häufig sehr viel komplexer als sie aus <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong> intendierten Perspektive<br />
(<strong>de</strong>r Informatik) erscheinen.<br />
Die Geschlechterpolitik <strong>de</strong>s Formalen, speziell von Klassifikationen, Standards und<br />
Informationssystemen, weist somit insgesamt zwar im Effekt starke Ähnlichkeiten zu<br />
<strong>de</strong>n zuvor vorgestellten Prozessen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring von Artefakten auf. So ver<strong>de</strong>utlichen<br />
die Fallbeispiele und Diskussionen bis hierher, dass durch Formalisierung und Abstraktion<br />
in <strong>de</strong>r Informatik <strong>kritisch</strong>e Stimmen und an<strong>de</strong>re Zugänge ausgeblen<strong>de</strong>t, das<br />
Unsichtbare o<strong>de</strong>r Schwerformalisierbare ausgeschlossen, menschliche Handlungsfähigkeit<br />
durch Technologie eingeschränkt und Machtverhältnisse verstärkt wer<strong>de</strong>n.<br />
Jedoch setzt die Kritik in diesem Kapitel 4.3 auf <strong>einer</strong> allgem<strong>einer</strong>en Ebene als <strong>de</strong>r<br />
bisherigen an, in<strong>de</strong>m das Formale als Bedingung <strong>de</strong>r Möglichkeit <strong>de</strong>s Ausschlusses<br />
und als Voraussetzung <strong>de</strong>r Einschreibung von Herrschaftsstrukturen in die Technologie<br />
begreifbar wird. Dabei geht es nicht mehr direkt darum, dass bestimmte Gruppen von<br />
Männern, aber insbeson<strong>de</strong>re von Frauen als Anwen<strong>de</strong>rInnen bei <strong>de</strong>r Nutzung behin<strong>de</strong>rt<br />
o<strong>de</strong>r Geschlechterungleichheitsverhältnisse in informatischen Artefakten festgeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n können (vgl. Kapitel 4.1. und 4.2.), son<strong>de</strong>rn um die grundsätzliche<br />
Auffassung von <strong>de</strong>r Objektivität und Neutralität <strong>de</strong>s Formalen, die zur Ignoranz <strong>de</strong>s<br />
Kontexts, sozialer Hierarchie und Ungleichheit führt. Das Problematische <strong>de</strong>s<br />
Formalisierens besteht somit im politischen Charakter von „Formalismen im<br />
Gebrauch“. Deren Politik kann jeweils nur anhand von konkreten Beispielen bzw.<br />
empirischen Fallstudien untersucht und aufgezeigt wer<strong>de</strong>n. Solche Analysen sind<br />
wie<strong>de</strong>rum Voraussetzung dafür, das Formale „an sich“ zu <strong>de</strong>konstruieren, welche<br />
aufgrund <strong>de</strong>r Negation <strong>de</strong>s Politischen durch Objektivität gewissermaßen eine<br />
(Geschlechter-)Politik zweiter Ordnung etabliert. Diese Dekonkstruktion und Re-Kontextualisierung<br />
<strong>de</strong>s Formalen erfor<strong>de</strong>rt jedoch neue wissenschaftstheoretische Grundlagen<br />
für die Wissensrepräsentation und Informatik.<br />
Konzeptionen feministischer Objektivität für die Informatik?<br />
Gegenüber <strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r Informatik vorherrschen<strong>de</strong>n Objektivitätsi<strong>de</strong>al haben feministische<br />
Theoretikerinnen wie Star, Crutzen und Suchman Parteilichkeit, Kontextualisierung<br />
und Situierung von Wissen eingefor<strong>de</strong>rt, womit sie sich auf <strong>de</strong>n Ansatz Donna<br />
Regeln und Traditionen, wobei <strong>de</strong>r repräsentieren<strong>de</strong> Aktor nicht mehr wahrgenommen wird und […]<br />
gedankenlos benutzt wird. Der Unterschied zwischen gewohntem Han<strong>de</strong>ln und Routine ist, dass<br />
Gewohnheiten än<strong>de</strong>rbar bleiben und losgelassen wer<strong>de</strong>n können. Gewohntes Han<strong>de</strong>ln ist in diesem Sinne<br />
‚verlässlich‘, weil dieses Han<strong>de</strong>ln verhan<strong>de</strong>lbar bleibt“ (Crutzen 2007, 39).<br />
181
Haraways beziehen. Haraways Figur <strong>de</strong>r Cyborg, die in unterschiedlichen Welten<br />
zuhause ist, eröffnet eine Perspektive, das Verhältnis von Formal-Technischem und<br />
multiplen I<strong>de</strong>ntitäten neu zu <strong>de</strong>nken als einen Raum, in <strong>de</strong>m Vielstimmigkeit, heterogene<br />
Zugehörigkeit und Nichtzuordnung erlaubt sind. Star zufolge ginge es darum,<br />
eine reichhaltige Theorie zu entwickeln, die „multiple membership, maintaining the<br />
‚high tension’ zone while acknowledging the cost of maintaining it, the cost of<br />
membership in multiple arenas, multivocality and translation“ (Star 1991b, 49)<br />
zusammenbringt.<br />
Bezogen auf die Informatik schlagen die drei Autorinnen Gegenkonzepte zu <strong>de</strong>r<br />
aufgezeigten epistemologischen Strategie <strong>de</strong>r Politisierung und Vergeschlechtlichung<br />
von Artefakten durch Formalisierung vor: eine Rekonstruktion <strong>de</strong>s Abstraktionsprozesses<br />
mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>r Sichtbarmachung heterogener Erfahrungen (Star 1991a, b), das<br />
Zulassen von Zweifel und Unsicherheit durch die Herstellung „transformativ-<strong>kritisch</strong>er<br />
Räume“ (Crutzen 2000, 2003) sowie das Konzept „lokaler Verantwortlichkeit („located<br />
accountability“) (Suchman 2002a). Diese Konzeptionen sind zwar teils miteinan<strong>de</strong>r<br />
verwoben, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte, die ich nachfolgend kurz<br />
darstellen und diskutieren will.<br />
Der erste Ansatz zielt auf eine fundierte Analyse <strong>de</strong>s Formalisierungsprozesses,<br />
welche das verborgene Politische <strong>de</strong>s Formalen im Gebrauch wie<strong>de</strong>r sichtbar macht.<br />
Für einen solchen Zugang plädiert insbeson<strong>de</strong>re Susan Leigh Star, die in <strong>de</strong>r Tradition<br />
<strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung und <strong>de</strong>s symbolischen Interaktionismus<br />
steht und sich stark auf <strong>de</strong>n Soziologen Anselm Strauss bezieht. Ihr empirisch-ethnografischer<br />
Ansatz wur<strong>de</strong> bereits in diesem Abschnitt sowie in 4.2.3. bei <strong>de</strong>r Diskussion<br />
unsichtbarer Arbeit ausführlich dargestellt. Doch auch an<strong>de</strong>re feministische VertreterInnen<br />
for<strong>de</strong>rn eine Re-Kontextualisierung <strong>de</strong>s Formalen, die <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>s „disembedding“<br />
(Wagner 1994) bewusst macht als einen, bei <strong>de</strong>m die formalen Objekte von<br />
ihrem ursprünglichen lokalen Kontext und sozialen Verhältnissen getrennt wer<strong>de</strong>n. Die<br />
analytische Re-Konstruktion dieser sozialen und politischen Bedingungen <strong>de</strong>s Formalen<br />
ist sicherlich ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Schritt und notwendige Voraussetzung, um die<br />
Wissensrepräsentation und die Informationssysteme an<strong>de</strong>rs zu gestalten, liefert allerdings<br />
noch keine konkreten Vorgehensweisen für die Gestaltung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte im Sinne eines „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red <strong>de</strong>sign“.<br />
Jedoch führt Star im Kontext ihres Zwiebelallergiebeispiels mit <strong>de</strong>r Partialität und<br />
Situiertheit von Wissen eine Erkenntnishaltung ein, die jenseits <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r Informatik<br />
vorherrschen<strong>de</strong>n Objektivitätsi<strong>de</strong>als liegt. Sie argumentiert, dass insbeson<strong>de</strong>re Frauen<br />
Erfahrungen mitbrächten, die für ein besseres Verständnis <strong>de</strong>r Gestaltung und Nutzung<br />
von Wissensrepräsentationen notwendig sind: „This is for three reasons: historically,<br />
our knowledge and work have been ma<strong>de</strong> invisible in the public record, yet we now<br />
recognize that there are a myriad of ways in which invisible work contributes to any<br />
venture; 2) we have as a group <strong>de</strong>veloped a set of skills for juggling real-time work that<br />
escape formal representation but are essential to knowledge; and 3) as a<br />
disenfranchised group, we have access to some informal ways of knowing, including<br />
the knowledge of ourselves and the other, simultaneously.” (Star 1991a. 82). Ein solch<br />
euphorischer Bezug auf „Frauen“ und ihre beson<strong>de</strong>ren, für wissensbasierte Systeme<br />
nützlichen Erfahrungen und Standpunkte erscheint vor <strong>de</strong>m Hintergrund aktueller<br />
feministischer Epistemologie (vgl. etwa Singer 2005) als unhaltbar, da er implizit <strong>de</strong>n<br />
182
Erfahrungshorizont <strong>einer</strong> weißen Mittelklassefrau unterstellt. Wenn jedoch Stars<br />
Aussage nicht essentialistisch, son<strong>de</strong>rn eher konstruktivistisch als eine Frage nach<br />
Ein- und Ausschlüssen bei <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation und -produktion aufgefasst wird,<br />
so lässt sich diese Interpretation durchaus auch heutzutage noch als Grundlage eines<br />
feministischen Ansatzes zur formalen Wissensrepräsentation verstehen. Für einen solchen<br />
Zugang wäre somit zentral, Unsichtbares im repräsentierten Wissen, aber auch<br />
im Prozess formaler Repräsentation aufzu<strong>de</strong>cken, das Wi<strong>de</strong>rständige gegenüber <strong>de</strong>m<br />
Formalen anzuerkennen und sich dabei die Erfahrung gleichzeitigen Insi<strong>de</strong>r- und<br />
Outsi<strong>de</strong>r-Seins, die aus partieller Zugehörigkeit und partieller Marginalisierung resultiert,<br />
zunutze zu machen.<br />
Crutzen dagegen wi<strong>de</strong>rsteht <strong>de</strong>r Versuchung, <strong>de</strong>m traditionellen System<strong>de</strong>sign eine<br />
auf eine vermeintlich gemeinsame Erfahrung von Frauen zurückgeführte <strong>kritisch</strong>e<br />
Haltung entgegenzusetzen. Sie bezieht sich statt<strong>de</strong>ssen auf <strong>de</strong>n Begriff <strong>de</strong>s Zweifels,<br />
welchen sie <strong>de</strong>m Philosophen und Vertreter <strong>de</strong>s amerikanischen Pragmatismus John<br />
Dewey entlehnt, um eine <strong>kritisch</strong>e Perspektive zu entwickeln. Zweifel und Unsicherheit<br />
sind Crutzen zufolge wesentlich für die Konstitution offener Interaktionsräume, für die<br />
sie das Konzept <strong>de</strong>s „transformativen <strong>kritisch</strong>en Raumes“ einführt. In diesem Konzept<br />
begreift Crutzen Zweifel als eine Brücke zwischen <strong>de</strong>m offensichtlichen Han<strong>de</strong>ln und<br />
möglicher Än<strong>de</strong>rungen gewohnter Handlungsweisen. Zweifel sei in <strong>de</strong>r Interaktion<br />
situiert und ließe sich mit Dewey primär als <strong>kritisch</strong>es Denken verstehen. Auf dieser<br />
Grundlage gedacht seien Zweifel an Repräsentationen in offenen Interaktionsräumen<br />
möglich und „can be effective in a change of acting itself and in a change of the results<br />
of that acting: the interpretations and representations. The ‚preferred‘ reading of representations<br />
can be negotiated. There is space between interpretation and representation.<br />
Differences and different meaning constructing processes are respected. In<br />
rooms where differences are present, truth is an ongoing conversation and a process<br />
of disclosure and not a correspon<strong>de</strong>nce to reality. Truth is then a mere construction of<br />
actors being in an interaction. Rooms in interaction worlds, where actions of questions<br />
and doubting are present, which have the potential to change their habits and routines<br />
in their interaction, I will call ‚transformative critical rooms‘“ (Crutzen 2003, 93). Insofern<br />
verlässt Crutzen das Feld cartesianischer Objektivität o<strong>de</strong>r Wahrheit und negiert die<br />
Möglichkeit, dass die Welt objektiv abgebil<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n kann. Das dazu von ihr vorgeschlagene<br />
Mittel <strong>de</strong>s Zweifelns dürfe jedoch nicht zu weit gehen, schließlich bräuchten<br />
Menschen Selbstverständliches, um ihre alltägliche Lebenswelt handhaben zu können.<br />
Sie können nicht ständig ihre gesamte Umgebung und je<strong>de</strong>s Gegenüber hinterfragen,<br />
son<strong>de</strong>rn benötigten Routinen und Verlässliches, das gegeben ist und ohne nachzu<strong>de</strong>nken<br />
benutzt wer<strong>de</strong>n kann. Deshalb sei das Herstellen und Unterstützen <strong>kritisch</strong>er<br />
transformativer Räume – auch mittels Technologie – stets ein „Balancieren zwischen<br />
<strong>einer</strong> Verstarrung in Routine und <strong>einer</strong> Verstarrung in Unentschlossenheit, wenn zu viel<br />
Unsicherheit auftritt“ (Crutzen 2007, 44).<br />
Suchmans Kritik an <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Informatik vorherrschen<strong>de</strong>n Konzeptionen von<br />
Objektivität richtet sich primär gegen die Designer-NutzerInnen-Dichotomie, die zum<br />
einen <strong>de</strong>m traditionellen „<strong>de</strong>sign from nowhere“ inhärent eingeschrieben ist in Form<br />
<strong>de</strong>s Mythos vom genialen Schöpfer und technologischen Konstrukteur, <strong>de</strong>m passive<br />
RezipientInnen <strong>de</strong>s Geschaffenen gegenüber gestellt wer<strong>de</strong>n. Zum an<strong>de</strong>ren wür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Dualismus durch die in <strong>de</strong>r Informatik häufig zu beobachten<strong>de</strong> unparteiisch-losgelöste<br />
183
Intimität 258 aufrechterhalten, bei <strong>de</strong>r „<strong>de</strong>tachment (from other sites) and intimacy (within<br />
their own) of the scientific and technical communities“ eng miteinan<strong>de</strong>r verknüpft seien:<br />
„<strong>de</strong>tached intimacy … characterizes much of scientific and technological work, through<br />
the joint creation of an elaborate social world within which one can be <strong>de</strong>eply engaged,<br />
but which remains largely self-referential, cut-off from others who might seriously<br />
challenge aspects of the community’s practice“ (Suchman 2002a, 95).<br />
Demgegenüber schlägt Suchman das Konzept lokaler Verantwortlichkeit vor, mit<br />
<strong>de</strong>m sie sich auf Haraways Begriff <strong>de</strong>s parteilichen, verorteten und <strong>kritisch</strong>en Wissens<br />
bezieht: „Feministische Objektivität han<strong>de</strong>lt von begrenzter Verortung und situiertem<br />
Wissen und nicht von Transzen<strong>de</strong>nz und <strong>de</strong>r Spaltung in Subjekt und Objekt. Vielleicht<br />
gelingt es uns so, eine Verantwortlichkeit dafür zu entwickeln, zu welchem Zweck wir<br />
zu sehen lernen.“ (Haraway 1995d [1988], 82). Die Frage nach <strong>de</strong>m Zweck „for what<br />
we learn how to see” ergänzt Suchman durch „for what we learn how to build”, um<br />
Haraways Erkenntniskritik und Plädoyer für Verantwortlichkeit explizit auf die Technologieproduktion<br />
beziehen zu können. Auf dieser Basis plädiert sie für eine neue Grundlage<br />
technologischer Integration, die nicht auf <strong>einer</strong> universellen Sprache grün<strong>de</strong>t,<br />
son<strong>de</strong>rn auf partiellen Übersetzungen. Diese Übersetzungsarbeit beziehe sich nicht<br />
nur auf die offensichtliche Trennung von Gestaltung und Nutzung, son<strong>de</strong>rn erfor<strong>de</strong>re<br />
zugleich die vielfältigen Unterschie<strong>de</strong> innerhalb bei<strong>de</strong>r spezialisierten Welten zu<br />
berücksichtigen. Ziel sei „not the creation of discrete, intrinsically meaningful objects,<br />
but the cultural production of new forms of material practice“ (Suchman 2002a, 99). Zu<br />
<strong>einer</strong> solchen Praxis gehöre beispielsweise, die Objekte in die Umgebungen ihrer<br />
intendierten Nutzung zu bringen statt sie in speziell dafür eingerichteten Usability-<br />
Laboren zu testen. Heterogenität in technischen Systemen solle insgesamt mehr<br />
Wertschätzung entgegen gebracht wer<strong>de</strong>n. Diese könne jedoch nicht durch<br />
hegemoniale und hierarchisieren<strong>de</strong> Strategien erreicht wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn vielmehr durch<br />
Praktiken <strong>de</strong>r „artful integration“. 259<br />
Die skizzierten feministischen Ansätze stellen nicht nur Gegenkonzepte zu <strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r Informatik üblichen Abstraktionen auf Basis traditioneller Objektivitätsverständnisse<br />
dar, die zu einem Prozess, <strong>de</strong>n Star als Naturalisierung bezeichnet, „[t]he process of<br />
stripping away the contingencies of an object’s creation and its situated nature“ (Star<br />
1994 nach Bratteteig/ Verne 1997, 44) und damit letztendlich zu <strong>einer</strong> Negation <strong>de</strong>s<br />
Politischen und Geschlechtlichen führt. Sie wen<strong>de</strong>n sich zugleich gegen die in <strong>de</strong>r<br />
informatischen Wissensrepräsentation und Systemgestaltung vorherrschen<strong>de</strong><br />
Epistemologie, die im folgen<strong>de</strong>n Abschnitt <strong>kritisch</strong> diskutiert wird.<br />
258 Mit <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>r „losgelösten Intimität“ bezieht sich Suchman auf Ina Wagner, die drei <strong>de</strong>r<br />
gleichzeitigen Distanz und Involviertheit zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Prozesse herausgearbeitet hat: <strong>de</strong>r<br />
organisatorische Egozentrismus, <strong>de</strong>r auf die „Autopoesis“ wissenschaftlich-technischer Gemeinschaften<br />
verweist, die angebliche Gemeinschaftlichkeit, nach <strong>de</strong>r die geteilte Realität Selbstverständnisse für das<br />
Han<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Einzelnen herstellt, sowie die De-Realisierung mittels <strong>einer</strong> Umgebung, beispielsweise eines<br />
Labors, <strong>einer</strong> mathematischen Theorie o<strong>de</strong>r eines Computerbildschirms, durch die eine Distanz von <strong>de</strong>n<br />
praktischen Dingen <strong>de</strong>s Lebens erzeugt wird, vgl. Wagner 1994.<br />
259 Weitere Ansatzpunkte für eine Transformation <strong>de</strong>r Gestaltung/Nutzung von Technologien im Sinne<br />
<strong>einer</strong> „located accountability“ sieht Suchman im Erkennen <strong>de</strong>r vielfältige Formen sichtbarer und<br />
unsichtbarer Arbeit bei <strong>de</strong>r Nutzung/ Gestaltung von Technologie, in <strong>de</strong>r eigenen Verortung innerhalb <strong>de</strong>s<br />
komplexen Netzes von Verbindungen und Verantwortlichkeit für unsere eigene Partizipation, in einem<br />
Verständnis von Nutzung als Rekontextualisierung von Technologie sowie im Akzeptieren <strong>de</strong>s begrenzten<br />
Kontrolle je<strong>de</strong>r einzelnen AkteurIn über die Gestaltung/Nutzung von Technologie, vgl. Suchman 2002a.<br />
184
4.3.2. Epistemologie und Ontologie <strong>de</strong>s Formalen<br />
Klassische Fragen <strong>de</strong>r Erkenntnistheorie, z.B. wie wir Erkenntnisse gewinnen, d.h.<br />
wissen können, welches Wissen als wahr gilt und welche Kriterien dafür herangezogen<br />
wer<strong>de</strong>n sollten, wur<strong>de</strong>n in diesem Abschnitt 4.3 bereits gestreift. Stand im vorherigen<br />
Abschnitt die Problematik im Vor<strong>de</strong>rgrund, dass Formalismen die ontologischen<br />
Voraussetzungen, politischen Entscheidungen und gesellschaftlichen Folgen kaschieren<br />
und damit <strong>de</strong>n eigenen politischen Charakter verleugnen können, so wird im<br />
folgen<strong>de</strong>n Abschnitt <strong>de</strong>r Fokus auf zwei grundlegen<strong>de</strong> Fragen <strong>de</strong>r feministischen<br />
Epistemologie verschoben: welches Wissen gilt als legitim und wer ist das Subjekt<br />
dieses Wissens? Insbeson<strong>de</strong>re die zweite Frage unterschei<strong>de</strong>t feministische Ansätze<br />
zur Epistemologie von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r traditionellen Erkenntnistheorie. Feministische<br />
Theoretikerinnen wie Harding, Longino, Haraway und Hayles haben auf verschie<strong>de</strong>ne<br />
Weisen darauf aufmerksam gemacht, dass Wissen stets vom Subjekt <strong>de</strong>r Erkenntnis<br />
abhängt, von <strong>de</strong>ssen kulturellen Kontext, sozialen Status, Körperlichkeit, mithin von <strong>de</strong>r<br />
Subjektivität <strong>de</strong>r/<strong>de</strong>s Erkennen<strong>de</strong>n geprägt ist. Diese Einsicht wur<strong>de</strong> vom Mainstream<br />
erkenntnistheoretischer Ansätze, etwa Richard Foley, ignoriert und ein universelles<br />
Subjekt <strong>de</strong>s Wissens unterstellt.<br />
In Bezug auf die erste Frage erläutert Alison Adam (1995, 1998) die klassische,<br />
durch die Naturwissenschaften geprägte epistemologische Sicht. Dieser gilt nur dasjenige<br />
Wissen als legitim, das durch formale Sätze <strong>de</strong>r Form „S knows that p“ dargestellt<br />
wer<strong>de</strong>n kann. Dabei repräsentiert S das wissen<strong>de</strong> Subjekt, während p ein Teil<br />
propositionalen Wissens ist, welches das Subjekt kennt („weiß“). „The archetypal<br />
knowers, authors of scientific research, are supposed to be anonymous – the individual<br />
is always abstract. […] all knowing is taken to be just as objective. Thus the i<strong>de</strong>al<br />
knower is ‚nowhere‘ and un<strong>de</strong>rstandably this has been criticized by feminists as both<br />
containing a <strong>de</strong>ep gen<strong>de</strong>r bias and as also highly implicated in projects of gen<strong>de</strong>r<br />
domination.”“ (Adam 1995, 362) Die Problematik eines solchen nicht situierten, scheinbar<br />
unparteiischen Standpunkts bestehe nicht nur darin, dass es einen in diesem<br />
Sinne i<strong>de</strong>alen Beobachter nicht gibt, vielmehr setze dieser das I<strong>de</strong>al implizit mit einem<br />
u.a. weißen, westlichen, bürgerlichen, nichtbehin<strong>de</strong>rten und heterosexuellen Mann als<br />
souveränem Beobachter gleich, womit untergeordnete Gruppen davon abgehalten wer<strong>de</strong>n,<br />
sich an <strong>de</strong>r Herstellung von Wissen gleichrangig zu beteiligen. Ein universelles<br />
Subjekt <strong>de</strong>s Wissens sei eine Illusion, die einen perspektivlosen Blick vom Nirgendwo<br />
(‚view from nowhere‘) unterstelle.<br />
Die zweite problematische Annahme, die <strong>de</strong>r herkömmlichen erkenntnistheoretischen<br />
Sicht <strong>de</strong>s „S knows that p“ zugrun<strong>de</strong> liegt, ist die <strong>de</strong>s autonomen Erkenntnissubjekts.<br />
Feministische Theoretikerinnen wie Helen Longino kritisieren, dass Wissen nicht<br />
im „Besitz“ Einzelner, son<strong>de</strong>rn ein kollektives Unternehmen sei. Dem passiven cartesianischen<br />
Erkenntnissubjekt, das als EmpfängerIn und SammlerIn von Wissen konzipiert<br />
wird, setzen sie entgegen, dass Wissen in sozialen Gruppen und interpersoneller<br />
Erfahrung verortet ist. Um Überzeugungen und Wissen entwickeln zu können, sei ein<br />
Gegenüber notwendig, das Wissen um und über an<strong>de</strong>re. Die Diskussion <strong>de</strong>s Zwiebelallergie-Beispiels<br />
hat bereits darauf verwiesen, dass nicht nur ein Wissen und ein Weg<br />
<strong>de</strong>r Erkenntnis als legitim gelten können. Es ver<strong>de</strong>utlicht, dass vielfältige, heterogene<br />
Erkenntnisse und Wege <strong>de</strong>r Erkenntnis erlaubt sein und zugelassen wer<strong>de</strong>n sollten.<br />
185
Das Subjekt <strong>de</strong>s Wissens in <strong>einer</strong> Enzyklopädie gesun<strong>de</strong>n Menschenverstands<br />
In <strong>de</strong>r Informatik erscheinen Fragen <strong>de</strong>r Konstitution von Wissen und <strong>de</strong>r<br />
erkennen<strong>de</strong>n (bzw. Wissen konstruieren<strong>de</strong>n) Subjekte insbeson<strong>de</strong>re bei <strong>de</strong>r Untersuchung<br />
von Vergeschlechtlichungsprozessen in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung<br />
relevant. „In looking at the manner in which gen<strong>de</strong>r is inscribed in AI, as AI is so much<br />
to do with knowledge and the simulation of knowing, a clear view of the ways […] in<br />
which the subject of the knowledge, or the knower is ren<strong>de</strong>red visible or invisible, are<br />
both crucial to an un<strong>de</strong>rstanding of how gen<strong>de</strong>r is involved in the <strong>de</strong>sign and building of<br />
AI systems“ (Adam 1998, 29). 260 Für die Fragestellung dieses Kapitels erscheint Alison<br />
Adams Ansatz wesentlich, nimmt sie mit <strong>de</strong>r KI doch einen wesentlichen Bereich <strong>de</strong>r<br />
Informatik in <strong>de</strong>n Blick, <strong>de</strong>r bis heute in feministischen Kritiken noch immer stark<br />
unterbeleuchtet ist.<br />
Eine ihrer überzeugendsten Fallstudien bezieht sich auf CYC, ein wissensbasiertes<br />
System über das Alltagswissen, das ab 1984 unter <strong>de</strong>r Leitung von Douglas Lenat 261 in<br />
<strong>de</strong>n USA entwickelt wur<strong>de</strong> und über zehn Jahre hinweg hohe Summen an Forschungsför<strong>de</strong>rung<br />
erhielt. CYC basierte auf <strong>de</strong>m klassischen symbolorientierten Ansatz <strong>de</strong>r KI,<br />
<strong>de</strong>r auf die Nachbildung rationalen Denkens fokussiert und annimmt, dass eine<br />
vollständige Repräsentation von Wirklichkeit (bzw. zumin<strong>de</strong>st eines Anwendungsbereiches)<br />
möglich ist. 262 Die Vision dieses System bestand darin, eine Wissensdatenbank<br />
zu erstellen, die sämtliches Wissen enthält, das als „gesun<strong>de</strong>r Menschenverstand“ gilt.<br />
Damit sollten die Unzulänglichkeit herkömmlicher Expertensysteme und Wissensdatenbanken,<br />
ausschließlich Aussagen über sehr begrenzte, klar spezifizierte Anwendungsbereiche<br />
machen zu können, kompensiert wer<strong>de</strong>n. „Common sense is viewed as some<br />
kind of substratum that serves to facilitate more complex reasoning by providing basic<br />
or obvious information nee<strong>de</strong>d […] The rationale behind formalizing common sense is<br />
that the information contained in the substratum can help to find or make connections<br />
between information contained in expert systems and other kinds of programs, for<br />
instance word processors, spreadsheets, and internet provi<strong>de</strong>rs.“ (Sherron 2000, 112).<br />
Die Entwickler stellten sich vor, dass das einmal ausgereifte System später mit <strong>de</strong>r<br />
Mehrzahl neu verkaufter Computer mitgeliefert wer<strong>de</strong>n wür<strong>de</strong>, so wie etwa Microsoft<br />
Windows auf <strong>de</strong>n meisten Rechnern vorinstalliert ist, um die Systeme mit <strong>de</strong>r Intelligenz<br />
gesun<strong>de</strong>n Menschenverstands aufrüsten zu können.<br />
Um <strong>de</strong>n gesun<strong>de</strong>n Menschenverstand zu formalisieren, gingen die Konstrukteure<br />
folgen<strong>de</strong>rmaßen vor: Zunächst sollten sämtliche Gegenstän<strong>de</strong> dieser Welt durch<br />
260 Der Kontext <strong>de</strong>s Zitats lässt darauf schließen, dass Adams hier eine standpunktheoretische Perspektive<br />
einnimmt, die ein „spezifisches Wissen von Frauen“ voraussetzt und gerenalisiert. Jedoch betont sie<br />
an an<strong>de</strong>rer Stelle die „multiplicity of women’s ways of knowledge“, die feministische Epistemologie<br />
gegenüber traditionellen Ansätzen, die auf eine vereinheitlichte Theorie <strong>de</strong>s Wissens fokussierten,<br />
charakterisiere (Adam 2000, 104) Eine solche Sicht multipler Wissenszugänge und -konstruktionen ist mit<br />
<strong>de</strong>n in Kapitel 3 dargelegten theoretischen Grundlagen dieser Arbeit besser vereinbar als ein essentialistischer<br />
Ansatz.<br />
261 Der indische Informatiker Ramanathan V. Guha war <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r stellvertreten<strong>de</strong>n Leiter <strong>de</strong>s Projekts.<br />
Interessanterweise arbeitet er heutzutage bei Google. Diese personelle Kontinuität gibt erste Hinweise<br />
darauf, dass die mittlerweile mehr als zehn Jahre alten feministischen Kritiken womöglich auch in <strong>de</strong>n<br />
gegenwärtigen Formen <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation, z.B. bei Suchmaschinen, relevant sind. Auf die<br />
Aktualität <strong>de</strong>r skizzierten Ansätze wer<strong>de</strong> ich weiter unten kurz zurückkommen.<br />
262 Auf Ansätze <strong>de</strong>r „neueren“ KI, die versuchen, „Embodiment“, Situiertheit o<strong>de</strong>r Emotionen zu erfassen,<br />
komme ich später zurück, vgl. hierzu Abschnitt 4.3.3.<br />
186
ein<strong>de</strong>utige formale Repräsentationen beschrieben wer<strong>de</strong>n, um anschließend die<br />
Zusammenhänge zwischen diesen Repräsentationen genauer zu spezifizieren. Dieses<br />
„Wissen“ war in Form prädikatenlogischer Aussagen zu formulieren. Das System<br />
ermöglicht dann mittels formaler Regeln Schlussfolgerungen über die gespeicherten<br />
Zusammenhänge zu ziehen sowie Plausibilitätskontrollen durchzuführen. Das repräsentierte<br />
Wissen ließe sich auf die Weise automatisch erweitern.<br />
Feministische Theoretikerinnen wie Adam (1995, 1998) arbeiteten die Voraussetzungen<br />
<strong>de</strong>s Systems heraus. CYC beruhe auf <strong>de</strong>r Annahme, dass Menschen eine<br />
umfangreiche Bibliothek <strong>de</strong>s Alltagswissens besitzen, das in Form formaler Aussagen<br />
und Regeln ausgedrückt wer<strong>de</strong>n kann. Das be<strong>de</strong>ute jedoch <strong>einer</strong>seits, dass sämtliche<br />
Menschen in ein und <strong>de</strong>rselben Realität leben und darin übereinstimmen, was zu<br />
dieser dazugehört und ausgeschlossen ist, „be they a professor, a waitress, a six-yearold<br />
child, or even a lawyer“ (Lenat/ Guha 1990 nach Adam 1998, 85). Es wer<strong>de</strong> <strong>de</strong>mzufolge<br />
ein universelles Subjekt <strong>de</strong>s Wissens vorausgesetzt. An<strong>de</strong>rerseits impliziere<br />
die Inanspruchnahme <strong>de</strong>r Prädikatenlogik, dass das im System repräsentierte Wissen<br />
wi<strong>de</strong>rspruchsfrei ist und keine gegensätzlichen Auffassungen enthalten kann. „Cyc is<br />
<strong>de</strong>veloped within a frame of reference which assumes, at bottom, that it is possible to<br />
access a real world about which we will all agree […]. In other words Cyc’s <strong>de</strong>sign is<br />
built on this one element of foundationalist epistemology at least“ (Adam 1998, 86).<br />
Aufgrund <strong>de</strong>ssen erscheint es interessant, wie das System mit wi<strong>de</strong>rsprüchlichen<br />
Aussagen umgeht: „what if my common sense disagrees with your common sense,<br />
whose is to be chosen?“ (Adam 1995, 360). Als eine Lösung dafür sieht das System<br />
vor, dass Aussagen entwe<strong>de</strong>r als „Wissen“ (knowledge) gelten o<strong>de</strong>r eher als<br />
„Vorstellung“ bzw. „Überzeugung“ (belief) markiert wer<strong>de</strong>n können, wobei <strong>de</strong>m Wissen<br />
allerdings ein höherer Status zugestan<strong>de</strong>n wird als <strong>de</strong>n markierten Aussagen. Die<br />
Differenzierung etabliert somit eine Wissenshierarchie, welche wie<strong>de</strong>rum die Frage<br />
aufwirft, wer im Zweifelsfall darüber entschei<strong>de</strong>t, ob eine Aussage als Wissen gilt o<strong>de</strong>r<br />
als „belief“ abqualifiziert wird. Abgesehen von <strong>de</strong>m angeführten Zitat, das ein universelles<br />
Erkenntnissubjekt unterstellt, konnte Adam kaum einen expliziten Hinweis darauf<br />
fin<strong>de</strong>n, welches Subjekt <strong>de</strong>s Wissens die Konstrukteure von CYC implizit annehmen.<br />
An dieser Stelle wur<strong>de</strong> jedoch <strong>de</strong>utlich, dass es letztendlich die Konstrukteure selbst<br />
sind, die über entsprechen<strong>de</strong> Entscheidungsmacht verfügen. Insofern bil<strong>de</strong>ten die in<br />
CYC als „Wissen“ repräsentierten Aussagen „TheWorldAsTheBuil<strong>de</strong>rsofCycBelieveIt-<br />
ToBe“ (Adam 1995, 364). Adam resümmiert über die vergeschlechtlichten Einschreibungen<br />
und Wirkungen <strong>de</strong>s Systems: „Middle-class male professional knowledge<br />
informs TheWorldAsTheBuil<strong>de</strong>rsofCycBelieveItToBe and hopes that such a world<br />
might be available in a global knowledge base as a form of epistemological<br />
imperialism“ (Adam 1995, 365).<br />
Adams Analyse zufolge stellt CYC ein Para<strong>de</strong>beispiel für die Übersetzung herkömmlicher<br />
rationalistischer Epistemologie in ein technisches System dar, an <strong>de</strong>m sich<br />
viele Aspekte feministischer Epistemologien, von <strong>de</strong>r Kritik am universalen Wissenssubjekt<br />
bis hin zu <strong>de</strong>r am ‚view from nowhere‘, exemplifizieren lassen. CYC umfasst<br />
primär das kognitive Wissen weißer, heterosexueller, gebil<strong>de</strong>ten Mittelstandsmänner<br />
westlicher Prägung und grenzt u.a. „embodied and skilled knowledge“ von <strong>einer</strong><br />
Repräsentation aus. Mit <strong>de</strong>r Konstitution <strong>einer</strong> Wissensordnung wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m System<br />
Machtverhältnisse und eine (Geschlechter-)Politik eingeschrieben: „Cyc ignores<br />
187
minority views, the quiter voices, and allows the majority voice to speak for everyone“<br />
(Sherron 2000, 114). O<strong>de</strong>r wie Adam es ausdrückt: „Cyc’s mo<strong>de</strong>ls of the world are<br />
hegemonic mo<strong>de</strong>ls – unconsciously reflecting the views of the powerful, privileged<br />
positions.“ (Adam 1998, 86)<br />
Auch über <strong>de</strong>n Ausschluss von Perspektiven hinausgehend erscheinen die<br />
Grundannahmen von CYC hochproblematisch. Denn was als gesun<strong>de</strong>r Menschenverstand<br />
gilt, verän<strong>de</strong>rt sich über die Zeit und differenziert sich kulturell sehr stark aus. Die<br />
Systementwickler nehmen jedoch nicht wahr, dass <strong>de</strong>r Gegenstand ihrer Formalisierung<br />
von <strong>einer</strong> Vielzahl von Faktoren wie Kultur, Alter, Klasse, Geschlecht, sexuelle<br />
Orientierung etc., d.h. von <strong>de</strong>r spezifischen Verortung <strong>de</strong>s Wissenssubjekts abhängt.<br />
Noch heikler erscheint Adam jedoch, dass normative Aussagen in das System<br />
hineingeraten, beispielsweise darüber, wie bestimmte Menschen (z.B. Frauen, Männer,<br />
Kin<strong>de</strong>r, ethnische Min<strong>de</strong>rheiten etc.) zu sein haben o<strong>de</strong>r wie sie zu behan<strong>de</strong>ln sind –<br />
und dies nicht reflektiert wird. Das formale Regelsystem droht, solche Normierungen<br />
und Stereotypisierungen noch weitergehend zu verstärken. Insofern wirft das System<br />
Fragen <strong>de</strong>r Moral und Verantwortung auf: „Do the buil<strong>de</strong>rs of Cyc wish to mirror and<br />
maintain existing prejudices and inequity or should their system be <strong>de</strong>liberately<br />
<strong>de</strong>signed to expose unfairness and inequality?“ (Adam 1995, 364)<br />
Adam formuliert diese Frage geschickt, in<strong>de</strong>m sie sich auf die Wünsche <strong>de</strong>r<br />
Entwickler konzentriert. Eine Antwort auf diese Frage lässt offen, ob im System<br />
repräsentierte Vorurteile o<strong>de</strong>r Ungleichheitsstrukturen diese im Gebrauch tatsächlich<br />
reproduzieren. Adam vermei<strong>de</strong>t damit die Falle, von <strong>einer</strong> eins-zu-eins Übersetzung<br />
<strong>de</strong>r Intentionen von Designern in Auswirkungen <strong>de</strong>s Systems auszugehen. 263 Wenn sie<br />
von <strong>einer</strong> Abbildung <strong>de</strong>r Realität im System ausginge, so wür<strong>de</strong> sie die Verantwortung<br />
einseitig <strong>de</strong>n Entwicklern zuzuweisen. Dies be<strong>de</strong>utet, <strong>de</strong>n von feministischen<br />
Theoretikerinnen als inhärent „männlich“ <strong>de</strong>konstruierten Mythos <strong>de</strong>s autonomen<br />
Subjekts erneut hervorzuholen und zu bestätigen. Adam weist jedoch selbst auf <strong>de</strong>n<br />
„more diffuse sense of responsibility“ (Adam 1998, 97) hin, <strong>de</strong>r sich aus <strong>einer</strong> Aktor-<br />
Netzwerk-Perspektive ergibt. Sie wen<strong>de</strong>t dieses Verständnis kollektiver Verantwortung<br />
<strong>de</strong>r beteiligten AkteurInnen jedoch nicht auf ihre Analyse <strong>de</strong>r Konstruktion von CYC an,<br />
son<strong>de</strong>rn erklärt nur lapidar dass CYC <strong>de</strong>n Problemen traditioneller Epistemologie zum<br />
Opfer fallen wür<strong>de</strong>, die die moralischen Dimensionen menschlichen Problemlösens<br />
nicht erfassen könne (ebd.).<br />
Während Adam das System CYC letztendlich aus <strong>einer</strong> ethischen Perspektive<br />
interpretiert, fragt Catherine Sherron danach, wie sich die feministischen Kritiken formal-technisch,<br />
d.h. in <strong>de</strong>r Logik <strong>de</strong>r Konstrukteure umsetzen ließen. Ihrem Ansatz<br />
zufolge sei ein wissensbasiertes System zu konstruieren, das die Vorstellung von<br />
einem einheitlichen gesun<strong>de</strong>n Menschenverstands hinter sich lässt und statt<strong>de</strong>ssen<br />
heterogene, insbeson<strong>de</strong>re unterrepräsentierte Stimmen o<strong>de</strong>r die von Marginalisierten<br />
das System integriert. Es seien alternative Erklärungen zu repräsentieren, die vom<br />
Standard abweichen. Ferner solle die Verortung <strong>de</strong>r Konstrukteure offen gelegt, d.h.<br />
<strong>de</strong>ren Hintergrundannahmen und Charakteristiken aufge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n. Sherron schlägt<br />
zugleich vor, wie diese Vorstellungen praktisch umgesetzt wer<strong>de</strong>n könnten. Um<br />
263 Diese Perspektive wur<strong>de</strong> in Kapitel 3 <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en Analyse unterzogen, vgl. insbeson<strong>de</strong>re Kapitel<br />
3.2.<br />
188
vielfältige, auch wi<strong>de</strong>rsprüchliche Versionen gesun<strong>de</strong>n Menschenverstands in CYC zu<br />
repräsentieren, böte die KI mit ihrem Konzept <strong>de</strong>r Mikrotheorien bereits eine Lösung<br />
an, <strong>de</strong>nn diese „can represent different points of view, levels of granularity, cultural<br />
differences, age differences, time periods, corporate cultures, etc.“ (vgl. Russell/ Norvig<br />
1995 nach Sherron 2000, 117). Um auch <strong>de</strong>n zweiten Anspruch zu erfüllen, solle je<strong>de</strong><br />
Mikrotheorie ihrer EntwicklerIn entsprechend markiert wer<strong>de</strong>n, was zugleich die<br />
Verantwortung <strong>de</strong>r EntwicklerInnen för<strong>de</strong>rn wür<strong>de</strong>. Damit bringt sie einen Vorschlag<br />
ein, <strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>s technisch Machbaren liegt. Dieser löst jedoch nur einen Teil<br />
<strong>de</strong>r Probleme, welche die feministische Epistemologie aufgeworfen hat. So legt das<br />
von Sherron gedachte System we<strong>de</strong>r die Situierung <strong>de</strong>r EntwicklerIn/AutorIn einschließlich<br />
ihrer Hintergrundannahmen offen, noch wird verkörpertes und an<strong>de</strong>res<br />
implizites Wissen in das System eingebun<strong>de</strong>n, das sich nicht in Form logischer<br />
Aussagen fassen lässt und – so die differenzfeministische Kritik – häufig „weiblich“<br />
konnotiertes Wissen ist.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz machen Sherrons technische Empfehlungen auf eine generelle<br />
Ten<strong>de</strong>nz in <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation und Entwicklung von Informationstechnologien<br />
aufmerksam. Im Rückblick auf ein System, <strong>de</strong>ssen Konzept vor mehr als zwanzig<br />
Jahren entstan<strong>de</strong>n ist, wird <strong>de</strong>utlich, dass zumin<strong>de</strong>st einzelne Aspekte <strong>de</strong>r<br />
feministischen Kritik in <strong>de</strong>n aktuellen technologischen Ansätzen berücksichtigt scheinen.<br />
So versteht sich etwa die Internet-Enzyklopädie Wikipedia umfassen<strong>de</strong>r noch als<br />
CYC als ein „Versuch das gesamte Wissen <strong>de</strong>r Welt zu sammeln und je<strong>de</strong>rmann<br />
zugänglich zu machen“. 264 Mit <strong>de</strong>m Prinzip <strong>de</strong>s kollaborativen Publizierens basiert die<br />
Technologie <strong>de</strong>r Wikis 265 grundlegend auf <strong>de</strong>r Annahme, dass Wissen nicht individuell<br />
durch ein autonomes Wissenssubjekt (eine ExpertIn), son<strong>de</strong>rn zutiefst sozial verfasst<br />
ist und ausgehan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n muss. 266 Dabei ist ein Teil <strong>de</strong>r Aushandlungsprozesse<br />
darüber, was als legitimes Wissen anerkannt wird, sichtbar, die bei CYC im Verborgenen<br />
geblieben sind, da in Wikipedia die Trajektorie <strong>de</strong>r Än<strong>de</strong>rungen eines Artikels<br />
abrufbar ist. Diese Sichtbarkeit umfasst sowohl die früheren Versionen eines Artikels<br />
als auch die jeweiligen AutorInnen, die kenntlich gemacht sind. Dennoch beharrt<br />
Wikipedia, wie Vetter (2006) zurecht betont, auf <strong>de</strong>m Grundsatz <strong>de</strong>r Neutralität von<br />
Wissen, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m für viele GeschlechterforscherInnen wichtigen Prinzip <strong>de</strong>r Kennzeichnung<br />
<strong>de</strong>r eigenen Zugehörigkeit (z.B. zu <strong>einer</strong> wissenschaftlichen Schule, Denkrichtung,<br />
disziplinären Perspektive o<strong>de</strong>r zu auch bestimmten sozialen Gruppen) wi<strong>de</strong>r-<br />
264 Vgl. http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiRea<strong>de</strong>r/Wikipedia_Kapitel_1 (letzter Zugriff am<br />
5.2.2008); dabei sollen die Artikel „ausschließlich be<strong>de</strong>utsames Wissen aus belegten und zuverlässigen<br />
Quellen enthalten. Der Name Wikipedia setzt sich zusammen aus wikiwiki, <strong>de</strong>m hawaiischen Wort für<br />
‚schnell‘, und ‚encyclopedia‘, <strong>de</strong>m englischen Wort für ‚Enzyklopädie‘. Ein Wiki ist eine Webseite, <strong>de</strong>ren<br />
Seiten je<strong>de</strong>rmann leicht und ohne technische Vorkenntnisse direkt im Internetbrowser än<strong>de</strong>rn kann.“<br />
(http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Über_Wikipedia, letzter Zugriff am 5.2.2008)<br />
265 Im Informatik-Spektrum wer<strong>de</strong>n Wikis folgen<strong>de</strong>rmaßen charakterisiert: „Ein Wiki ist ein webbasiertes<br />
System, das das kollaborative Verfassen und Aktualisieren von Webseiten ermöglicht. Die wichtigsten<br />
Eigenschaften von Wikis sind die Offenheit, welche es je<strong>de</strong>m Benutzer erlaubt, an <strong>de</strong>r Erstellung von<br />
Inhalten teilzunehmen, und die Flexibilität bezüglich <strong>de</strong>r unterschiedlichen Arbeitsweisen verschie<strong>de</strong>ner<br />
Benutzer, ohne einen technologischen Zwang auszuüben.“ (Schaffert et al. 2007, 434) Wikis gehören zu<br />
<strong>de</strong>r Klasse <strong>de</strong>r „Social Software“, die sich epistemologisch vom Konstrukt <strong>de</strong>s cartesianischen individuellen<br />
und autonomen Wissenssubjektes abgewandt haben.<br />
266 Das in Wikipedia repräsentierte Wissen bleibt darüber hinaus nicht auf prädikatenlogische Ausdrücke<br />
beschränkt, son<strong>de</strong>rn erlaubt eine sprachliche Beschreibung, die je nach Wissensgebiet mehr o<strong>de</strong>r weniger<br />
wissenschaftlich orientiert ist. Ob das ausreichen<strong>de</strong> Möglichkeiten gibt, um verkörpertes Wissen und<br />
skilled knowledge darzustellen, wie es von feministischer Seite in Bezug auf CYC gefor<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>, ist<br />
allerdings fragwürdig.<br />
189
spricht. Darüber hinaus wür<strong>de</strong> ein emotionales Verhältnis zu einem bestimmten Thema<br />
aufgrund eigener Betroffenheit (z.B. durch sexistische o<strong>de</strong>r rassistische Diskriminierung)<br />
als ein Ausschlusskriterium gehandhabt, statt diese parteiliche Involviertheit<br />
<strong>kritisch</strong> zu reflektieren (vgl. Vetter 2006, 9f).<br />
Wird Adams Kritik ernst genommen, so ist hier jedoch noch weitergehend nach <strong>de</strong>m<br />
Subjekt <strong>de</strong>s Wissens zu fragen: wer schreibt in Wikipedia? Und wer verfügt über die<br />
dafür notwendigen Ressourcen? Denn es ist zu vermuten, dass sich dort prinzipiell<br />
Interessen und Machtverhältnisse durchsetzen wie bei <strong>de</strong>n zuvor betrachteten Informationssystemen.<br />
Bisher sind nur wenige Frauen AutorInnen bei Wikipedia. Auf <strong>de</strong>r<br />
Ebene <strong>de</strong>s repräsentierten Wissens sind Ansätze <strong>de</strong>r Geschlechterforschung kaum zu<br />
fin<strong>de</strong>n. 267<br />
Ein grober Blick auf an<strong>de</strong>re aktuelle Technologien <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation lässt<br />
vermuten, dass die Konzentration von Macht durch Wissen intensiviert wird, wenn<br />
Formalismen (beispielsweise Ontologien im Kontext <strong>de</strong>s Semantic web o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer<br />
semantischer Technologien) o<strong>de</strong>r Technologien zur Automatisierung (z.B. Suchmaschinen<br />
wie Google) zum Einsatz kommen. Analysen solcher Technologien <strong>de</strong>r<br />
Wissensgesellschaft, die über eine Kritik an <strong>de</strong>r Politik dieser Artefakte und <strong>de</strong>ren<br />
ökonomischer Monopolisierung von Information hinausgehen (vgl. etwa Introna/<br />
Nissenbaum 2000, Maurer 2007) und vielmehr aus <strong>de</strong>r Perspektive feministischer<br />
Epistemologie argumentieren, wie sie Adam am Beispiel von CYC vorgeführt hat,<br />
stehen meines Wissens jedoch noch aus.<br />
Objektorientierung: Naiver Realismus und die Vermeidung von Komplexität<br />
Die anhand <strong>de</strong>s wissensbasierten Systems CYC zum „gesun<strong>de</strong>n Menschenverstand“<br />
exemplifizierte feministische Objektivitäts- und Rationalitätskritik wird von Cecile<br />
Crutzen auf die Analyse- und Mo<strong>de</strong>llierungsmetho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Objektorientierung (OO)<br />
angewandt und weiter geführt (vgl. Crutzen 2000, Crutzen/ Gerrissen 2000, Crutzen/<br />
Vosseberg 1999). Da Objektorientierte Analyse und Design seit Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre<br />
das vorherrschen<strong>de</strong> Paradigma <strong>de</strong>r Softwareerstellung ist und die Softwaretechnik als<br />
„Kern“ <strong>de</strong>r Informatik gilt, hat eine feministische Analyse dieser formalen Vorgehenswiese<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Informatik insgesamt eine große Relevanz.<br />
Um die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Objektorientierung zu veranschaulichen und ihre Kritik an <strong>de</strong>n<br />
epistemologischen und ontologischen Voraussetzung dieser Form <strong>de</strong>r Repräsentation<br />
zu veranschaulichen, greift Crutzen auf <strong>de</strong>n Vergleich mit <strong>de</strong>n technischen Medien <strong>de</strong>r<br />
Fotografie und <strong>de</strong>s Films zurück (vgl. Crutzen/ Gerrissen 2000, 129f). Die Datenmo<strong>de</strong>lle<br />
in <strong>de</strong>r OO seien statische Repräsentationen eines Gegenstandsbereiches, <strong>de</strong>r<br />
vergleichbar mit einem Foto ist, in <strong>de</strong>m sich die Position <strong>de</strong>r Kamera, die Lichtverhältnisse<br />
und die subjektive Perspektive <strong>de</strong>r FotografIn wi<strong>de</strong>rspiegelten. Diese subjektive<br />
Sicht wer<strong>de</strong> jedoch in <strong>de</strong>r Informatik als „wahre“, objektive Repräsentation <strong>de</strong>r Realität<br />
verstan<strong>de</strong>n. Die dynamische Mo<strong>de</strong>llierung mittels OO, das Pendant zum Film, basiere<br />
Crutzen zufolge auf <strong>de</strong>r statischen und subjektiven Vorstellung von Realität, da<br />
Dynamiken als serielle Anordnung von Fotos bzw. Datenmo<strong>de</strong>llen aufgefasst wer<strong>de</strong>n.<br />
Dies habe Konsequenzen dafür, was mit OO mo<strong>de</strong>lliert und gesehen wer<strong>de</strong>n kann und<br />
267 Vgl. hierzu auch <strong>de</strong>n Workshop „Bilanzraum Wikipedia“ <strong>de</strong>r Internet-Theorie-Gruppe Hamburg auf <strong>de</strong>m<br />
Kongress „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ 2006 in Köln.<br />
190
was ausgeschlossen ist. „You can record with OO some of the real world dynamics and<br />
represent the changes as series of discrete moments of time. There are changes that<br />
the OO camera can not disclose or which happened between the separate takes done<br />
in different times.“ (ebd.,129) Der durch OO geprägte analytische Blick fokussiere nur<br />
auf diejenigen Transitionen und Zustän<strong>de</strong>, die in <strong>de</strong>m Beobachtungsskript eingeplant<br />
und aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Kamera beobachtbar sind. Ungeplante, spontane Verän<strong>de</strong>rungen<br />
beispielsweise könnten auf die Weise nicht wahrgenommen wer<strong>de</strong>n. OO suggeriere<br />
jedoch, dass Dynamiken vollständig repräsentiert seien wie in einem Dokumentarfilm.<br />
Die dynamischen Aspekte von OO wür<strong>de</strong>n – wie <strong>de</strong>r Film im Vergleich zur<br />
Fotografie – als ein Fortschritt <strong>de</strong>r Repräsentationstechnik begriffen, obwohl dabei viel<br />
verborgen bliebe: „a lot of presentation dynamics takes place behind the white screen<br />
of the OO ‚stage‘. The rules and procedures, which will direct the transitions, are<br />
encapsulated un<strong>de</strong>r the surface“ (ebd., 129). Unsichtbar sei, dass Verän<strong>de</strong>rung in OO<br />
Repräsentationen entwe<strong>de</strong>r durch die Nachricht eines formalen Objekts an ein an<strong>de</strong>res<br />
ausgelöst wer<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r durch eine <strong>de</strong>skriptive Regel, die das formale Objekt dazu<br />
zwingt, seinen Zustand zu verän<strong>de</strong>rn. Das be<strong>de</strong>ute jedoch, dass in OO Verän<strong>de</strong>rungsprozesse<br />
ausschließlich im Sinne eines Reiz-Reaktions-Schemas verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n<br />
können. An<strong>de</strong>re Formen <strong>de</strong>s Wan<strong>de</strong>ls kann OO nicht erfassen.<br />
Crutzens Analyse zeigt insgesamt die <strong>de</strong>r Objektorientierten Mo<strong>de</strong>llierung zugrun<strong>de</strong><br />
gelegte Ontologie: „OO has reinforced functionalism; seeing an information system as<br />
a system which can transform well-<strong>de</strong>fined inputs into outputs, meeting prescribed<br />
requirements with measurable attributes, controllable functions and <strong>de</strong>sirable features,<br />
fitting in well-or<strong>de</strong>red organisation and seeing the system as a neutral actor in meaning<br />
construction processes“ (ebd., 128). Sie kritisiert somit <strong>de</strong>n in die OO Methodik eingeschriebenen<br />
Funktionalismus. Allerdings ordnet sie diese Theorielinien nicht in <strong>de</strong>n<br />
philosophischen Diskurs o<strong>de</strong>r sozial- und geisteswissenschaftliche Traditionen ein,<br />
welche die Informatik direkt beeinflusst haben. Crutzens Ausführungen zu OO stellten<br />
zwar eine fundierte Grundlage dar, um die behavioristischen und kognitionswissenschaftlichen<br />
Voraussetzungen <strong>de</strong>s Analyse- und Designverfahrens grundsätzlich zu<br />
<strong>de</strong>konstruieren, sei es auf Basis konstruktivistischer Wissenschafts- und Technikforschung<br />
o<strong>de</strong>r aber eher kulturwissenschaftlich-historisch orientierter Ansätze. Statt<br />
jedoch auf ontologische Einschreibungen und politische Aspekte <strong>de</strong>s Formalen zu fokussieren,<br />
konzentriert sich Crutzen auf die epistemologischen Voraussetzungen <strong>de</strong>r<br />
Objektorientierten Mo<strong>de</strong>llierung, die sie als sehr typisch für die Disziplin Informatik insgesamt<br />
ansieht.<br />
Crutzen arbeitet die erkenntnistheoretischen Annahmen, auf <strong>de</strong>nen die Objektorientierung<br />
grün<strong>de</strong>t, differenziert heraus. Eine <strong>de</strong>r wesentlichen Grundlagen sei die so genannte<br />
Korrepon<strong>de</strong>nzsicht, die davon ausgeht, dass je<strong>de</strong> Person Objekten dieselbe<br />
Be<strong>de</strong>utung gibt, sofern diese Objekte mit <strong>de</strong>mselben Namen bezeichnet sind. OO<br />
basiere auf <strong>einer</strong> vom Realismus geprägten Sprachtheorie, die nach Jane Flax darauf<br />
grün<strong>de</strong>, dass Objekte nicht sozial o<strong>de</strong>r linguistisch konstruiert sind, „they are merely<br />
ma<strong>de</strong> present to conciousness by naming or by the right use of language“ (Flax 1990<br />
nach Crutzen/ Gerrissen 2000, 131). Nach <strong>de</strong>r Korrespon<strong>de</strong>nzsicht sind formale Repräsentationen<br />
eins-zu-eins Abbildungen <strong>de</strong>r realen Menschen, <strong>de</strong>r realen Dinge und<br />
ihrer Beziehungen. Es gäbe eine „truth out there“ und <strong>de</strong>ren Zugänglichkeit wird<br />
unterstellt.<br />
191
Auf dieser Basis wird in <strong>de</strong>r Objektorientierung angenommen, dass je<strong>de</strong>s Ding und<br />
je<strong>de</strong> Person in Form von formalen Objekten repräsentierbar sei und sich die Welt durch<br />
eine Metastruktur ordnen und beschreiben ließe. Dabei habe je<strong>de</strong>s wahrgenommene<br />
Objekt eine von <strong>de</strong>n beobachten<strong>de</strong>n Subjekten unabhängige Struktur, die mit <strong>de</strong>n von<br />
<strong>de</strong>r Objektorientierung zur Verfügung gestellten Beschreibungsmöglichkeiten objektiv<br />
repräsentiert wer<strong>de</strong>n könne. „A mo<strong>de</strong>l is ‚true‘ if it accurately <strong>de</strong>picts the un<strong>de</strong>rlying<br />
reality of discourse. Different opinions are a reflection of human error and can be<br />
eliminated. In the correspon<strong>de</strong>nce view the meaning construction process is reduced to<br />
the selection of relevant aspects of an object.“ (Crutzen 2000, Summary, 15f). Dem<br />
objektorientierten Ansatz zufolge könne die Welt klassifiziert wer<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m<br />
Ähnlichkeiten zwischen Objekten und Interaktionen wahrgenommen, Differenzen aber<br />
ignoriert wer<strong>de</strong>n. In OO wird <strong>de</strong>shalb ebenso wie von <strong>de</strong>n Konstrukteuren <strong>de</strong>s wissensbasierten<br />
Systems CYC angenommen, dass es über die Strukturen <strong>de</strong>r Objektpräsentationen<br />
kein Missverständnis geben kann zwischen <strong>de</strong>njenigen, die die Repräsentation<br />
erstellen (TechnikgestalterInnen und Software-IngenieurInnen), und <strong>de</strong>nen, die<br />
mit ihr arbeiten müssen (i.d.R. NutzerInnen). Auftreten<strong>de</strong> Wi<strong>de</strong>rsprüche seien das<br />
Resultat menschlicher Fehler und könnten, sobald diese erkannt sind, grundsätzlich<br />
ausgeräumt wer<strong>de</strong>n. Insofern setzten Software-Ingenieure voraus, dass die<br />
konstruierte Software dieselbe (wi<strong>de</strong>rspruchsfreie) Struktur habe wie die Realität und<br />
das informatische Artefakt in die Welt <strong>de</strong>r NutzerInnen gleichermaßen hineinpassen<br />
wür<strong>de</strong> wie in die <strong>de</strong>r Software-IngenieurInnen (vgl. ebd.). Crutzen zufolge unterstellten<br />
sie damit implizit, dass NutzerInnen – so wie sie selbst – formale Objekte im Sinne <strong>de</strong>s<br />
Meisterns und Beherrschens verstehen wollten.<br />
Insgesamt basiere OO auf <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r Aufklärung<br />
geprägten Annahmen:<br />
� „that subjects apply a correspon<strong>de</strong>nce view of reality,<br />
� that everybody sees the world as a world with one metastructure,<br />
� that observing subjects are sustainable,<br />
� that everything and everybody can be represented as OBJECTs; there is no<br />
fundamental difference between people and things,<br />
� that change is a logical process of action and reaction, and<br />
� that there exists a common language in which all people (who are affected by<br />
software) can un<strong>de</strong>rstand each other.“ (Crutzen/ Gerrissen 2000, 132)<br />
Crutzen kritisiert diese von ihr herausgearbeiteten epistemologischen und ontologischen<br />
Voraussetzungen <strong>de</strong>r objektorientierten Methodik grundlegend mit Hilfe <strong>de</strong>r<br />
feministischen erkenntnistheoretischen Ansätze von Sandra Harding und Susan<br />
Hekman. Wie bereits anhand von Stars Zwiebelallergiebeispiel und Adams Kritik an<br />
<strong>de</strong>m wissensbasierten System CYC dargestellt wur<strong>de</strong>, zeigt auch Crutzens Analyse,<br />
dass die <strong>de</strong>n objektorientierten Mo<strong>de</strong>llen – und damit auch <strong>de</strong>r Software – eingeschriebene<br />
Illusion von Objektivität und Neutralität durch das implizit mit<strong>de</strong>finierte<br />
„An<strong>de</strong>re“ auf <strong>einer</strong> symbolischen Ebene zur Reproduktion <strong>de</strong>r Geschlechterordnung<br />
beitrage. Mit <strong>de</strong>r Repräsentation <strong>de</strong>s Rationalen und Abstrakten gehe die<br />
asymmetrische Unterordnung <strong>de</strong>s „Weiblichen“ einher. Macht- und Herrschaftsverhältnisse<br />
wür<strong>de</strong>n negiert o<strong>de</strong>r als „natürliche“ bzw. „offensichtliche“ hingenommen.<br />
192
Die Objektorientierung sei also durch die Annahme <strong>de</strong>r Abwesenheit von<br />
Geschlechterverhältnissen geprägt. 268<br />
Anhand <strong>de</strong>r dominanten Mo<strong>de</strong>llierungs-, Entwurfs- und Programmiermethodik zeigt<br />
Crutzen insgesamt auf, dass diese Erkenntnispolitik in <strong>de</strong>r Informatik keine Ausnahme<br />
darstellt. Während CYC zwar große Aufmerksamkeit in bestimmten Kreisen <strong>de</strong>r KI (so<br />
auch in ihrer feministischen Analyse) erlangte, sich aber letztendlich in <strong>de</strong>r Anwendung<br />
nicht durchsetzen konnte, heben ihre Ergebnisse hervor, dass die gesamte Softwareentwicklung<br />
grundlegend auf genau <strong>de</strong>njenigen epistemologischen Voraussetzungen<br />
beruht, die feministische Erkenntnistheoretikerinnen verschie<strong>de</strong>nster Coleur an <strong>de</strong>r<br />
klassischen Erkenntnistheorie kritisiert hatten. Softwareentwicklung sei zutiefst von <strong>de</strong>r<br />
Annahme durchdrungen, dass sich die Realität eins-zu-eins mit formalen Mo<strong>de</strong>llen<br />
abbil<strong>de</strong>n ließe. Ebenso bil<strong>de</strong>te die cartesianische Trennung von Subjekt und Objekt bei<br />
<strong>de</strong>r Erkenntnisgewinnung ein wesentliches Fundament <strong>de</strong>r Disziplin.<br />
Crutzens <strong>kritisch</strong>e Analyse ist jedoch in mehrfacher Hinsicht spezifischer als eine<br />
allgemeine feministische Rationalitäts- und Objektivitätskritik, die <strong>de</strong>r Auffassung, dass<br />
informatische Mo<strong>de</strong>lle, Metho<strong>de</strong>n und Produkte geschlechtsneutral und objektiv sind,<br />
wi<strong>de</strong>rspricht. Zwei Aspekte <strong>de</strong>r OO, anhand <strong>de</strong>rer sich ihre bereits dargelegte Argumentation<br />
bestärken und konkretisieren lässt, sind das Prinzip <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rverwendbarkeit<br />
und die hierarchische Struktur von Klassen. Mit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rverwendbarkeit wird<br />
angestrebt, das System aus vorgefertigten Teilen zusammensetzen zu können. Primär<br />
legitimiert durch mögliche Kostenersparnisse, soll damit sichergestellt wer<strong>de</strong>n, dass<br />
Teile <strong>de</strong>s Systems in an<strong>de</strong>ren Produkten wie<strong>de</strong>rverwertet wer<strong>de</strong>n können. 269 Crutzen<br />
versteht dieses Prinzip als ein konservatives, da es das Bestehen<strong>de</strong> erhalten soll und<br />
auf neue Interaktionsszenarien überträgt. OO schließe damit die Be<strong>de</strong>utungen <strong>de</strong>r<br />
Vergangenheit ein ohne sie für die Zukunft zu öffnen, etwa im Sinne <strong>einer</strong> Projektion<br />
neuer Möglichkeiten, die auf diese Weise antizipiert wer<strong>de</strong>n könnten. Statt<strong>de</strong>ssen<br />
strebten Software-IngenieurInnen an, die Software kontrollierbar zu halten, Mehr<strong>de</strong>utigkeit<br />
auszuschließen und unbeherrschte Komplexität zu vermei<strong>de</strong>n. Crutzens<br />
These, dass sich in diesem Bestreben die Angst <strong>de</strong>r Software-IngenieurInnen vor <strong>de</strong>m<br />
Komplexen, Chaotischen, Unentscheidbaren und Unvorhersehbaren ausdrücke, ließe<br />
sich als eine neue Variante <strong>de</strong>r „I-methodology“ <strong>de</strong>uten. 270 Allerdings liegt die<br />
268 Die feministische Theoretikerin und Philosophin Cornelia Klinger betont für <strong>de</strong>n philosophischen<br />
Diskurs <strong>de</strong>n Zusammenhang von Unsichtbar-Machen <strong>de</strong>s symbolisch „Weiblichen“ und Verschweigen von<br />
Geschlechterdifferenz: „Wenn es zutrifft, dass die Auffassung <strong>de</strong>s Geschlechterverhältnisses als kontradiktorischem<br />
Gegensatz nicht nur eine Asymmetrie und Hierarchie zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Seiten impliziert,<br />
son<strong>de</strong>rn darüber hinaus die Ten<strong>de</strong>nz, die ‚an<strong>de</strong>re‘ Seite durch Nicht-Benennen auszublen<strong>de</strong>n, dann liegt<br />
hier <strong>de</strong>r Schlüssel für das Schweigen <strong>de</strong>s philosophischen Diskurses über das Geschlechterverhältnis.<br />
Denn (Ver-)Schweigen heißt nichts an<strong>de</strong>res als durch Nicht-(Be-)Nennen unsichtbar, unhörbar zu machen<br />
und somit ten<strong>de</strong>nziell zum Verschwin<strong>de</strong>n zu bringen. Der Wi<strong>de</strong>rspruch, <strong>de</strong>r sich zunächst zwischen <strong>de</strong>n<br />
bei<strong>de</strong>n Aussagen auftut, daß Geschlechterdifferenz <strong>einer</strong>seits im philosophischen Diskurs nicht vorkommt<br />
und daß diese doch an<strong>de</strong>rerseits in die wesentlichen Kategorien <strong>de</strong>r Philosophie eingeschrieben ist, löst<br />
sich somit auf.“ (Klinger 1995, 41f) Dasselbe Argument ließe sich für die Informatik anführen. Es zeigt die<br />
engen Verbindungen zwischen <strong>de</strong>n hier herausgearbeiteten strukturellen und symbolischen Ebenen <strong>de</strong>r<br />
Einschreibung von Geschlecht in Informationstechnologien auf.<br />
269 Genau genommen können nicht nur Teile <strong>de</strong>s Co<strong>de</strong>s in OO wie<strong>de</strong>r verwertet wer<strong>de</strong>n. So erläutern zwei<br />
Hauptvertreter <strong>de</strong>r Objektorientierten Methodik: „We can reuse requirements, analysis, <strong>de</strong>sign, test plans,<br />
user interfaces and architecture. In fact, virtually every component of the software engineering life cycle<br />
can be encapsulated as a reusable object.“ (Yourdan/ Argila 1996 nach Crutzen/ Gerrissen 2000, 128)<br />
270 Ich verstehe Crutzens Ansatz nicht als einen psychoanalytisch inspirierten, selbst wenn sich diese<br />
spezifische These so <strong>de</strong>uten ließe. Deshalb wer<strong>de</strong> ich sie auch nicht mit diesem Theorieapparat<br />
gegenlesen.<br />
193
Problematik hier nicht direkt auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r expliziten o<strong>de</strong>r impliziten NutzerInnenbil<strong>de</strong>r,<br />
son<strong>de</strong>rn im Bereich <strong>de</strong>r Epistemologie, <strong>de</strong>ren Setzung in <strong>einer</strong> objektiven Welt<br />
besteht, die keinen Unterschied macht zwischen Software-IngenieurInnen und<br />
NutzerInnen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Differenzen unter diesen, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r Möglichkeit <strong>de</strong>r<br />
wi<strong>de</strong>rspruchsfreien Repräsentation in einem formalen Mo<strong>de</strong>ll ausgeht. Eine solche<br />
theoretische Konzeption erfasst mehr als nur das subjektive Selbstverständnis <strong>de</strong>r<br />
EntwicklerInnen, da hier auch wissenschaftliche Theorien und Konzepte, die in die<br />
Artefakte eingeschrieben wer<strong>de</strong>n, inbegriffen sind.<br />
Ein zweites wesentliches Konzept <strong>de</strong>r Objektorientierung, <strong>de</strong>m Crutzen beson<strong>de</strong>re<br />
Aufmerksamkeit widmet, ist das <strong>de</strong>r Klasse, welches sich als Abstraktion <strong>de</strong>r Objekte<br />
<strong>de</strong>s zu mo<strong>de</strong>llieren<strong>de</strong>n Gegenstandsbereiches verstehen lässt. Um Klassen zu bil<strong>de</strong>n<br />
und ihre Attribute, Funktionalitäten sowie Beziehungen untereinan<strong>de</strong>r festzulegen, ist<br />
eine Klassifizierungsarbeit notwendig, die <strong>de</strong>rjenigen ähnlich ist, die von Bowker und<br />
Star beschrieben wor<strong>de</strong>n ist. Dabei betont Crutzen, dass Klassen in OO nicht verhan<strong>de</strong>lt,<br />
son<strong>de</strong>rn auf tayloristische Weise als gleichartige formale Objekte hergestellt<br />
wer<strong>de</strong>n. Heterogenität, auf die Star mit ihrem Zwiebelallergiebeispiel verwiesen hat, sei<br />
ebenso wenig in OO repräsentierbar: „Diversity can only be constructed by<br />
specialisation out of pre<strong>de</strong>termined similarity. Differences are mostly neglected and are<br />
only opposite to equal.“ (Crutzen 2000, Summary, 16). Ein Objekt <strong>de</strong>s Gegenstandsbereiches<br />
könne nur dadurch repräsentiert wer<strong>de</strong>n, dass es als Element <strong>einer</strong> formalen<br />
Klasse dargestellt wird. Es dürfe nur dann ein Element mehrerer Klassen sein, wenn es<br />
die Eigenschaften und Prozeduren sämtlicher dieser Klassen komplett übernimmt<br />
(„erbt“). 271 Objekte könnten somit in OO <strong>de</strong>r hierarchischen Struktur nicht entkommen.<br />
Crutzen kritisiert, dass aufgrund <strong>de</strong>ssen zwischenmenschliche Interaktion und soziale<br />
Prozesse mit OO nicht mo<strong>de</strong>lliert wer<strong>de</strong>n können: „The class concept fails to represent<br />
a social process. A group of humans can only be an aggregated class with harmonious<br />
and planned co-ordination structure. A group can only exist if it has a planned transition<br />
and a fixed goal. The social processes of grouping cannot be represented.“ (Crutzen<br />
2000, Summary,16). We<strong>de</strong>r Gruppenbildungs- noch Aushandlungsprozesse seien in<br />
OO formal repräsentierbar. Da die OO-Ontologie von Sozialität, situierter Handlung<br />
und <strong>de</strong>r Konstruktion von Be<strong>de</strong>utungen abstrahiere, schließt Crutzen auf <strong>de</strong>r Folie feministischer<br />
Objektivitäts- und Erkenntniskritik, dass Objektorientierung keine angemessene<br />
Metho<strong>de</strong> ist, menschlich-soziale Welten zu analysieren.<br />
Anhand <strong>de</strong>r Diskussion <strong>de</strong>r Frage, wie Gruppenbildung und an<strong>de</strong>re soziale<br />
Prozesse durch Klassen <strong>de</strong>r OO repräsentierbar sind, tritt Crutzens Neigung zu <strong>einer</strong><br />
entfremdungstheoretischen Haltung <strong>de</strong>utlich hervor. Sie bemerkt zwar zurecht, dass<br />
eine generelle Ablehnung von OO aus Sicht <strong>einer</strong> Geschlechterforschung in <strong>de</strong>r<br />
Inforamtik keine angemessene Lösung sein kann, schlägt jedoch explizit <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n<br />
Umgang mit OO vor: „We, therefore, have to leave OO and use it only for the purpose<br />
it was meant for: the realisation of software. Realised software which consists of<br />
predictable and planned interaction cannot be the base of the representation of<br />
humans because otherwise we would turn humans into an available resource which<br />
can be or<strong>de</strong>red repeatedly.“ (Crutzen 2000, 16). Damit wen<strong>de</strong>t sie sich gegen eine<br />
„Kolonialisierung“ <strong>de</strong>r Analyse von realen Welten bei <strong>de</strong>r Softwareentwicklung durch<br />
271 Das Prinzip <strong>de</strong>r Vererbung hat heutzutage in OO an Relevanz verloren.<br />
194
informatische Abstraktionswerkzeuge wie Klassifikation, Abspaltung, „Vererbung“<br />
(Crutzen 2003, 102), die von <strong>de</strong>r Systemrealisierung geprägt sind. 272 Es lässt sich<br />
somit festhalten, dass Crutzen die Trennung zwischen Mensch und Maschine, zwischen<br />
Technischem und Sozialen intakt lässt. Ihre Kritik an OO fokussiert auf die Analyse<br />
bzw. Mo<strong>de</strong>llierung <strong>de</strong>s Sozialen, während sie die Anwendbarkeit <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> auf<br />
die Systemrealisierung, d.h. <strong>de</strong>n eher technisch ausgerichteten Teil <strong>de</strong>r Softwareentwicklung,<br />
nicht in Frage stellt.<br />
Aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>s in dieser Arbeit entwickelten Theorieansatzes, nach <strong>de</strong>m<br />
das Soziale zutiefst technisch durchdrungen und auch das Technische sozial geprägt<br />
ist, d.h. es we<strong>de</strong>r ein „pures“ Menschliches noch eine Technik „an sich“ gibt, erscheint<br />
<strong>de</strong>r von Crutzen empfohlene Ansatz undurchführbar. Nichts<strong>de</strong>stotrotz wirft ihr<br />
Vorschlag die Frage auf, welche Optionen <strong>de</strong>s Umgangs mit Objektorientierung bzw.<br />
allgem<strong>einer</strong> mit Klassifizierung, Abstraktion und Formalisierung in <strong>de</strong>r Informatik auf<br />
<strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s hier verfolgten Perspektive konkret möglich sind. Wie lassen sich die<br />
genannten prinzipiellen feministischen Kritiken, dass Objektivität und Neutralität <strong>de</strong>s<br />
Formalen Illusionen seien, dass die Macht und Herrschaft <strong>de</strong>s Formalen durch die<br />
Transformation in etwas „natürlich“ Erscheinen<strong>de</strong>s, Offensichtliches negiert wird,<br />
konstruktiv für die Technikgestaltung wen<strong>de</strong>n?<br />
Crutzen schlägt hierzu, wie bereits ausgeführt wur<strong>de</strong> (vgl. <strong>de</strong>n Abschnitt<br />
Konzeptionen feministischer Objektivität für die Informatik in Kapitel 4.3.1.), auf <strong>einer</strong><br />
theoretischen Ebene das Schaffen von <strong>kritisch</strong>en transformativen Räumen vor. Diese<br />
ließen sich in Bezug auf Objektorientierte Analyse und Design bei <strong>de</strong>r Informatikausbildung<br />
umsetzen, für <strong>de</strong>ren grundlegen<strong>de</strong> Än<strong>de</strong>rung sie plädiert. Die OO Methodik sei<br />
nicht wie in <strong>de</strong>r Informatik üblich als ein eigenständiges Fach zu lehren, son<strong>de</strong>rn in<br />
ombination mit feministischer Wissenschaftstheorie und Epistemologie. 273 Auf <strong>de</strong>r<br />
ersten „Informatica Feminale“ 1998, <strong>de</strong>m Sommerstudium Informatik für Frauen an <strong>de</strong>r<br />
Universität Bremen, legte sie zusammen mit Karin Vosseberg eine Konzept vor, um<br />
diesem Ansatz praktisch zu erproben. 274 Sie nutzte <strong>de</strong>n Rahmen <strong>de</strong>s Frauenstudiums<br />
als Gelegenheit, das informatische Analyse- und Designverfahren „<strong>kritisch</strong> zu<br />
unterrichten – und trotz<strong>de</strong>m eine gewisse Tiefe in <strong>de</strong>r Nutzung dieser Metho<strong>de</strong> mittels<br />
Integration und Konfrontation <strong>de</strong>s Metho<strong>de</strong>nlernens (in Vielfalt und in Tiefe) mit<br />
Wissenschaftskritik zu erreichen. Die Unterrichtsmetho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kritik, Diskussion und<br />
(erneuten) Konstruktion ist <strong>de</strong>r Weg, diese Tiefe zu erreichen“ (Crutzen/ Vosseberg<br />
1999, 152f). Feministische Theorie diente als Bezugssystem, um traditionelle<br />
Informatikmetho<strong>de</strong>n wie Analyse, Entwurf und Konstruktion zu beurteilen. Das<br />
272 Crutzen beschreibt diesen Kolonialisierungprozess genauer als „dictated by the analyzing subjects’<br />
focus avoiding complexity and ambiguity by selecting the most formal documents, texts, tables, schemes<br />
in the domain etc. which are close to the syntactical level of object-oriented programming languages and<br />
by transforming natural language into a setoff elementary propositions“ (Crutzen 2003, 102)<br />
273 Crutzen ordnet sich damit in die sogenannten Curriculums<strong>de</strong>batte <strong>de</strong>r Informatik ein, in <strong>de</strong>r von En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r 1980er Jahre bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1990er Jahre intensiv über die Inhalte und Didaktik <strong>de</strong>s Faches diskutiert<br />
wur<strong>de</strong>, insbeson<strong>de</strong>re auch, inwieweit sozial- und geisteswissenschaftliche Themen Gegenstand <strong>de</strong>r<br />
Informatik sein sollen, vgl. Dijkstra 1989, Parnas 1990, Coy et al. 1992, Mahn/ Brauer 1997, Coy 2004. Für<br />
eine Diskussion <strong>de</strong>r Curriculums<strong>de</strong>batte aus feministischer Perspektive vgl. etwa Mahn 1997, Bruns 1997.<br />
274 Die Informatica Feminale stellt einen Rahmen zur Verfügung, in <strong>de</strong>m mit Form und Inhalt <strong>informatischer</strong><br />
Lehrveranstaltung experimentiert wer<strong>de</strong>n kann, dazu gehören Ansätze <strong>de</strong>s projektorientierten Studierens,<br />
<strong>de</strong>r Integration von Interdisziplinarität, <strong>de</strong>r Integration feministischer Fragestellungen, das Öffnen <strong>de</strong>s<br />
Studienfaches Informatik für Frauen an<strong>de</strong>rer Disziplinen, die Entmystifizierung <strong>de</strong>s Studiums und das<br />
Aufbrechen <strong>de</strong>r Dualität Lehren<strong>de</strong> und Lernen<strong>de</strong>; vgl. Vosseberg 2002, siehe auch www.informaticafeminale.<strong>de</strong>.<br />
195
integrative und konfrontative Lernkonzept, das einen Verhandlungsprozess zwischen<br />
feministischen und informatischen Ansätzen in Gang setzte, ermöglichte es <strong>de</strong>n<br />
TeilnehmerInnen, Selbstverständlichkeiten ihrer eigenen Sozialisation <strong>de</strong>r Informatik<br />
wahrzunehmen und Inspirationen zur Verän<strong>de</strong>rung, z.B. von Ontologien in <strong>de</strong>r Informatik<br />
zu gewinnen. Es gelang diesen, wesentliche Probleme <strong>de</strong>r Objektorientierung zu<br />
erkennen und fachliche Texte <strong>kritisch</strong> zu lesen. Beispielsweise rekonstruierten sie<br />
Geschlechterkonstruktionen in Lehrbüchern und reflektierten Sichtbarkeiten und<br />
Unsichtbarkeiten ihrer Mo<strong>de</strong>llierung. Vor allem aber führte <strong>de</strong>r Kurs dazu, Grenzen <strong>de</strong>r<br />
Objektorientierung wahrnehmen und besser verstehen zu können. 275 Am Beispiel <strong>de</strong>s<br />
Versuches, ein dynamisches Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Tanzens zu entwerfen, wer<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, „daß<br />
kontinuierlich und synchronisiert verlaufen<strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ln in <strong>de</strong>r Objektorientierung nur<br />
durch eine Zerlegung dieses Han<strong>de</strong>lns in diskrete Zustän<strong>de</strong> repräsentiert wer<strong>de</strong>n kann“<br />
(Crutzen/ Vosseberg 1999, 162). Die Veranstalterinnen gaben jedoch zu be<strong>de</strong>nken,<br />
dass ein solcher Kurs nur <strong>de</strong>r Beginn <strong>einer</strong> dynamischen Verbindung zwischen Informatik<br />
und feministischer Theorie sein kann (Crutzen/ Vosseberg 2002, 160), <strong>de</strong>ren Ziel<br />
es ist, die Vorteile <strong>de</strong>s regulieren<strong>de</strong>n und dynamischen Charakters von OO zu nutzen:<br />
„Objekte machen es möglich, die Welt als eine Welt von Aktoren zu sehen, die in je<strong>de</strong>r<br />
Situation wie<strong>de</strong>r neue Allianzen eingehen können. In diesem Sinne ist es möglich, <strong>de</strong>n<br />
Prozess <strong>de</strong>r Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Wirklichkeit mittels <strong>einer</strong> Än<strong>de</strong>rung (Entwicklung) <strong>de</strong>s<br />
Informationssystems selbst als einen Prozess zu sehen. Entwerfen<strong>de</strong> und Benutzen<strong>de</strong><br />
wer<strong>de</strong>n nicht mehr als eine Dualität aufgefasst, son<strong>de</strong>rn als interagieren<strong>de</strong> Objekte<br />
(Subjekte).“ (Crutzen/ Vosseberg 2002, 155). Insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Analysephase seien<br />
die Rollen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen (Entwerfen<strong>de</strong>) und NutzerInnen zu hinterfragen.<br />
We<strong>de</strong>r Crutzens Empfehlung zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Informatikausbildung noch Sherrons<br />
technisch ausgerichteter Vorschlag, das Ausgeschlossene zu integrieren, vermögen<br />
jedoch das grundsätzliche Problem <strong>de</strong>r Klassifikationen, Abstraktion und Formalisierung<br />
endgültig zu lösen. Eine <strong>de</strong>r zentralen Voraussetzungen <strong>de</strong>r Repräsentierbarkeit<br />
und Formalisierbarkeit in je<strong>de</strong>r informationstechnischen Mo<strong>de</strong>llierung und<br />
Implementierung ist eine explizite Beschreibung in <strong>einer</strong> formalen o<strong>de</strong>r Programmiersprache,<br />
die notwendigerweise immer wie<strong>de</strong>r neue Ausschlüsse produziert. Dies führt<br />
zurück auf die bereits häufiger angerissenen Fragen: Worin besteht das „An<strong>de</strong>re“ <strong>de</strong>r<br />
Repräsentation – das Implizite, Unaussprechliche o<strong>de</strong>r die stillschweigen<strong>de</strong>n<br />
Voraussetzungen? Ist es das formal nicht Beschreibbare? Ist es das sprachliche nicht<br />
Repräsentierbare? Lässt sich dieses mit <strong>de</strong>n bekannten Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Software-<br />
Engineering o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz erfassen und mo<strong>de</strong>llieren? Und wenn ja,<br />
unter welchen Voraussetzungen?<br />
Diese Thematiken führen auf prinzipielle erkenntnistheoretische Fragen <strong>de</strong>r Möglichkeit<br />
sprachlicher Repräsentierbarkeit als einem alten Problem <strong>de</strong>r westlichen Kulturgeschichte<br />
und Philosophie, welches Dualismen voraussetzt sowie erneut hervorbringt.<br />
275 Crutzen und Vosseberg führen in diesem Zusammenhang u.a. die folgen<strong>de</strong>n Fragen an, mit <strong>de</strong>n<br />
DesignerInnen bei <strong>de</strong>r Nutzung von Mo<strong>de</strong>lliermetho<strong>de</strong>n wie OO konfrontiert sind: „Wird genügend<br />
anerkannt, dass es in <strong>de</strong>r Wirklichkeit vieles gibt, das nicht-klassifizierbar ist? Wird das Nicht-klassifizierbare<br />
durch die Art <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung nicht zu <strong>de</strong>m, was ins Dunkel gesetzt wird? Zwingt die Klassifizierung<br />
nicht <strong>de</strong>n Individuen, die durch die Instanzen <strong>de</strong>r Klasse abgebil<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, ein vorgeschriebenes<br />
Verhalten auf? Kann die Überbewertung von Vererbung beim Klassifizieren und die Negierung von nichthierarchischen<br />
Relationen, die Hierarchie als Standard in <strong>de</strong>r Wirklichkeit zum Effekt haben?“ (Crutzen/<br />
Vosseberg 1999, 158).<br />
196
Während die Problematik von Präsenz und Absenz, <strong>de</strong>s Innen und Außen, <strong>de</strong>ren Verhältnisse<br />
durch die technischen Artefakte etabliert wer<strong>de</strong>n, im Kapitel 4.2. in Bezug auf<br />
Arbeitsprozesse thematisiert und in diesem Kapitel 4.3. für das Feld <strong>de</strong>r informatischen<br />
Anwendungs- und Wissensmo<strong>de</strong>llierung diskutiert wur<strong>de</strong>, sollen im nächsten Abschnitt<br />
Dualismen sowie die damit einhergehen<strong>de</strong>n Einschlüsse und Ausschlüsse in <strong>de</strong>n<br />
Konzepten <strong>de</strong>r informatischen Artefakten ins Zentrum <strong>de</strong>r Untersuchung gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
4.3.3. Geschlechtsmarkierte Dualismen: Welchen Preis hat die Integration <strong>de</strong>s<br />
ausgeschlossenen An<strong>de</strong>ren?<br />
„I was struck by how frequently I ma<strong>de</strong> recourse to a set of more or less<br />
explicitly gen<strong>de</strong>red dualisms about technology (and sometimes science)<br />
– people-focussed vs. technology-focussed, social vs. technical,<br />
<strong>de</strong>tached objectivity vs. emotional connectedness, hard vs. soft<br />
technology, concrete vs. abstract, reductionist vs. holistic, specialist vs.<br />
heterogenous…“ (Faulkner 2000a, 759)<br />
Eine dritte, von feministischen Erkenntnistheorien inspirierte Perspektive auf Abstraktion,<br />
Klassifikation und Formalisierung in <strong>de</strong>r Informatik stellt Dualismen ins Zentrum<br />
<strong>de</strong>r Untersuchung. Dieser Strang <strong>de</strong>r Kritik argumentiert ausgehend von vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
und einflußreichen Geschlechtersymbolisierungen, dass zwischen kulturell<br />
vorherrschen<strong>de</strong>n Dichotomien und <strong>de</strong>r zweigeschlechtlichen Differenz ein enger<br />
Zusammenhang besteht. Diesen Konnex beleuchtet Cornelia Klinger vor einem<br />
philosophiegeschichtlichen Hintergrund: „In <strong>de</strong>n Dualismen von Kultur und Natur, Geist<br />
(Seele) und Körper (Leib), Vernunft (Rationalität) und Gefühl (Emotionalität), Öffentlichkeit<br />
und Privatheit, Haben und Sein, Erhabenheit und Schönheit usw. ist <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterdualismus implizit immer anwesend. Umgekehrt ausgedrückt heißt das,<br />
daß in <strong>de</strong>n Konzeptionen von Weiblichkeit und Männlichkeit die großen Grunddualismen<br />
<strong>de</strong>s abendländischen Denkens eingeschrieben sind. Auf Befragung wür<strong>de</strong> je<strong>de</strong> in<br />
unserer Kultur sozialisierte Person ohne Zögern und Zweifeln die ‚richtige‘ Zuordnung<br />
<strong>de</strong>r jeweiligen Kategorien zu <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Geschlechtern vornehmen.“ (Klinger 1995,<br />
39). Einige dieser in westlich-abendländischen Denktraditionen vorherrschen<strong>de</strong>n Dualismen<br />
sind auch in <strong>de</strong>n technischen Bereichen relevant. Darüber hinaus betonen<br />
VertreterInnen <strong>de</strong>r Geschlechter-Technik-Forschung, dass technikspezifische Dichotomien<br />
wie die von Technischem vs. Sozialem, Maschinellem vs. Kreativem geschlechterdualistisch<br />
kodiert sind. 276 Die Ingenieurwissenschaften seien insgesamt von einem<br />
binären Denkstil geprägt, <strong>de</strong>r Anlass zu feministischen Untersuchungen gibt (vgl. etwa<br />
Faulkner 2000a, Kumbruck 1990).<br />
Dieser Fokus auf Dualismen erscheint für die Analyse <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
fruchtbar, ist doch in diesem Kapitel 4.3 bereits mehrfach <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n, dass Politik,<br />
Epistemologie und Ontologie <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation und <strong>de</strong>r Software-Entwicklung<br />
stark von dualistischen Annahmen durchdrungen sind. So wiesen etwa Adam,<br />
276 Auf die Zusammenhänge zwischen Geschlechterdualismen und an<strong>de</strong>ren Dualismen haben feministische<br />
Philosophinnen ausführlich aufmerksam gemacht, vgl. etwa Lloyd 1984, Hekman 1990, Gatens<br />
1991. Einige dieser Dualismen sind – wie weiter unten diskutiert wird – für die Technikgestaltung grundlegend,<br />
weshalb technikbezogene Dichotomien und allgem<strong>einer</strong> kulturell wirksame Dichotomien nicht<br />
notwendig einen Gegensatz darstellen.<br />
197
Suchman und Crutzen darauf hin, dass die cartesianische Trennung von Subjekt und<br />
Objekt, die Dichotomie von Design und Nutzung o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Dualismus von formalem und<br />
verkörpertem Wissen bei <strong>de</strong>r Analyse, <strong>de</strong>m Entwurf und <strong>de</strong>r Realisierung von Software-<br />
und Informationssystemen zugrun<strong>de</strong> gelegt, reproduziert und damit zementiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Diese Studien wer<strong>de</strong>n im Folgen<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>r aufgegriffen und auf <strong>de</strong>r Folie<br />
geschlechtskodierter Dichotomien interpretiert. Ferner sind hier weitere, für die<br />
Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte zentrale Dualismen Gegenstand <strong>de</strong>r Analyse. 277<br />
Feministische (Natur-)Wissenschaftsforscherinnen haben bereits früh aufgezeigt,<br />
wie eng diejenigen Dichotomien, die für die Informatik relevant sind und sie mitkonstituieren,<br />
mit Geschlechterdichotomisierungen verknüpft wer<strong>de</strong>n. So durchziehen etwa<br />
Kritiken am Subjekt-Objekt-Dualismus und <strong>de</strong>r vermeintlichen Objektivität wissenschaftlicher<br />
Tätigkeit seit mehr als zwei Deka<strong>de</strong>n die Debatten <strong>de</strong>r feministischen<br />
Naturwissenschaftsanalyse. 278 Dabei bestehe die Problematik darin, dass diese Differenzierungen<br />
und Polarisierungen nicht etwa als eine harmonische Wechselseitigkeit<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n könne und die Gegensätze keineswegs ein Gleichgewicht bil<strong>de</strong>n.<br />
Vielmehr be<strong>de</strong>ute die dichotome Ungleichartigkeit zumeist auch Ungleichwertigkeit und<br />
Hierarchie, die mit <strong>einer</strong> Abwertung o<strong>de</strong>r Unsichtbarkeit <strong>de</strong>s als „weiblich“ Kodierten<br />
einherginge. Liegt eine solche Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung vor, wer<strong>de</strong>n innerhalb<br />
feministischer Diskurse grob betrachtet zwei verschie<strong>de</strong>ne Strategien vorgeschlagen,<br />
um Verän<strong>de</strong>rung zu evozieren. Die eine besteht darin, das als „weiblich“ Kodierte<br />
sichtbar zu machen und aufzuwerten, die an<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n Dekonstruktion<br />
<strong>de</strong>r betrachteten Dichotomie und ihrer jeweiligen Pole.<br />
Dekonstruktion von Dichotomien<br />
Die zweite Strategie wur<strong>de</strong> etwa von Adam in Bezug auf die Repräsentation „gesun<strong>de</strong>n<br />
Menschenverstands“ in CYC angewen<strong>de</strong>t (vgl. <strong>de</strong>n Abschnitt „Das Subjekt <strong>de</strong>s Wissens<br />
in <strong>einer</strong> Enzyklopädie gesun<strong>de</strong>n Menschenverstands“ unter 4.3.2). Sie lässt sich<br />
mit <strong>de</strong>n Worten Crutzens und Vossebergs allgemein folgen<strong>de</strong>rmaßen fassen: „Frauenforschung<br />
<strong>de</strong>ckt Hierarchien und hierarchische Relationen in Verbindung mit solchen<br />
Dualitäten auf und übt Kritik am traditionellen Prinzip von Distanz und Objektivität<br />
solcher Subjekt/Objekt-Relationen, weil sie in Machtrelationen mün<strong>de</strong>n. Sie fragt sich:<br />
‚Wer ist das Subjekt?‘ ‚Wie han<strong>de</strong>lt das Subjekt?‘, Welcher Platz wird <strong>de</strong>m Objekt<br />
durch das Subjekt gegeben?‘“ (Crutzen/ Vosseberg 1999, 156). Während Adam (und<br />
die feministischen Ansätze <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Rationalitätskritik, auf die sie Bezug<br />
nimmt) primär auf die De-Konstruktion <strong>de</strong>s als autonom konzipierten und „männlich“<br />
konnotierten Subjekts bei <strong>de</strong>r Erkenntnisproduktion fokussiert, konzentrieren sich<br />
neuere Ansätze darauf, auch <strong>de</strong>n zweiten Pol <strong>de</strong>r Subjekt-Objekt-Relation, d.h. das<br />
jeweilige Objekt <strong>de</strong>r Erkenntnis stärker in <strong>de</strong>n Blick zu nehmen. So wur<strong>de</strong>n in Kapitel 3<br />
Objektivitätskonzeptionen vorgestellt, welche die Passivität <strong>de</strong>r untersuchten Objekte<br />
277 Studien, die geschlechtskodierte Dualismen wie technikbezogenes vs. menschenbezogenes Verhalten<br />
(Faulkner 2000a), abstrakter vs. konkreter Programmierstil in <strong>de</strong>r Fachkultur <strong>de</strong>r Informatik (Turkle 1998<br />
[1995]) o<strong>de</strong>r Technisches vs. Soziales in <strong>de</strong>r Software-Entwicklung (vgl. Bødker/ Greenbaum 1993) bzw.<br />
in Metho<strong>de</strong>n wissenschaftlichen Diskursen <strong>de</strong>r Informatik (vgl. Star 1995, Bath 2006c) untersuchen,<br />
wer<strong>de</strong>n hier, sofern sie nicht auf die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte fokussieren, nicht<br />
berücksichtigt.<br />
278 Vgl. u.a. Keller 1989 [1982], Keller 1995 [1983], Keller 1986 [1985], Longino 1990, Haraway 1995d<br />
[1988], Harding 1990 [1986], Harding 1994 [1991] sowie zusammenfassend etwa Orland/ Rössler 1995,<br />
insbeson<strong>de</strong>re 41ff.<br />
198
<strong>de</strong>-konstruieren. Latours und Haraways Aktor-Netzwerk-Theorie (vgl. die Kapitel 3.3<br />
und 3.4) ebenso wie Barads Ansatz <strong>de</strong>s Agentialen Realismus (vgl. Kapitel 3.5) setzen<br />
voraus, dass auch die Objekte wissenschaftlicher Erkenntnis bis zu einem gewissen<br />
Grad ein Eigenleben führen. Was dort für Objekte in Anspruch genommen wird, gilt<br />
ebenso für Technologien, geht es doch hier wie dort darum, <strong>de</strong>ren potentielle Handlungsfähigkeit<br />
anzuerkennen. Die Strategie <strong>de</strong>r De-Konstruktion von Dichotomien lässt<br />
sich somit von Seiten <strong>de</strong>r jeweiligen Pole her aufziehen, sie zielt jedoch letztendlich<br />
stets auf eine grundlegen<strong>de</strong> Dekonstruktion <strong>de</strong>r Dichotomie an sich und ihrer<br />
geschlechterdualistischen Konnotation: „Deconstruction is a method to evaluate implicit<br />
and explicit aspects of binary oppositions […]. The meaning of the terms of<br />
oppositions, constructed as a weave of differences and distances, can be traced<br />
throughout the discourse of the discipline and its domain. By examining the seams,<br />
gaps and contradictions, it is possible to disclose the hid<strong>de</strong>n meaning on gen<strong>de</strong>r and<br />
the gen<strong>de</strong>red agenda. I<strong>de</strong>ntifying the positive valued term and displacing the<br />
<strong>de</strong>pendant term from its negative position will reveal the gen<strong>de</strong>ring of the opposition<br />
and create a dialogue between the terms in which the difference within the term and<br />
the differences between the terms are valued. It uncovers the obvious acting in the<br />
past and how it has been established“ (Crutzen 2003, 97). Für die Subjekt-Objekt-<br />
Relation, die das vorherrschen<strong>de</strong> Wissenschaftsverständnis <strong>de</strong>r Informatik – d.h. auch<br />
das Wissenschaftsverständnis, das <strong>de</strong>m System CYC und Objektorientierten Metho<strong>de</strong>n<br />
zugrun<strong>de</strong> liegt – voraussetzt, be<strong>de</strong>utet eine solche Strategie <strong>de</strong>r Dekonstruktion,<br />
<strong>de</strong>n Herstellungsprozess <strong>de</strong>r Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt aufzuzeigen,<br />
um diese Unterscheidung letztendlich aufzulösen, womit auch eine binär<br />
vergeschlechtlichen<strong>de</strong> Zuordnung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Pole <strong>de</strong>r Dichotomie verunmöglicht wird.<br />
Gestaltung vs. Nutzung in <strong>de</strong>r Softwareentwicklung<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Software-Entwicklung fin<strong>de</strong>t die Subjekt-Objekt-Relation, die für vorherrschen<strong>de</strong><br />
Formen <strong>de</strong>r Erkenntnisproduktion wie <strong>de</strong>r Wissensrepräsentation grundlegend<br />
ist, eine Entsprechung in <strong>de</strong>r GestalterInnen-NutzerInnen-Dichotomie. Eine De-<br />
Konstruktion <strong>de</strong>r symbolischen Be<strong>de</strong>utung dieser Dichotomie kann gleichfalls auf<br />
mehreren Ebenen erfolgen. Crutzen schlägt vor, das vorherrschen<strong>de</strong> Verständnis von<br />
Design als Fortschritt zu hinterfragen, nach <strong>de</strong>m „[d]esigners see themselves and are<br />
seen as makers of a better future and working in a straightforward line of progress“<br />
(Crutzen 2003, 97f). Dieses Verständnis grün<strong>de</strong> darauf, dass gutes Design keine<br />
Störungen o<strong>de</strong>r Zweifel produziert, son<strong>de</strong>rn sich nahtlos in die Welt <strong>de</strong>r NutzerInnen<br />
einpasst. Leichtigkeit wer<strong>de</strong> mit „Nutzungsfreundlichkeit“ gleichgesetzt. Der vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
Vorstellung <strong>de</strong>r Informatik zufolge seien Qualitätsmerkmale von Software<br />
wie ‚gut‘, ‚innovativ‘, ‚nutzungsfreundlich‘‚sicher‘ und ‚zuverlässig‘ objektiv messbar und<br />
planbar, bevor das Produkt in die Welt <strong>de</strong>r NutzerInnen geschickt wird. Die traditionelle<br />
Auffassung <strong>de</strong>r Gestaltung von IT-Produkten als einem Prozess rationaler Entscheidungen,<br />
Problemlösung, Optimierung, Vorschriften und Prognose <strong>de</strong>monstriere<br />
Curtzen zufolge die Macht <strong>de</strong>r GestalterInnen. Auch die ExpertInnensprache und die<br />
Metho<strong>de</strong>n, die die Welt <strong>de</strong>r Informatik gegenüber <strong>de</strong>r Außenwelt abschotteten,<br />
199
etabliere eine Dominanz von technischer Entwicklungstätigkeit über die Nutzung (vgl.<br />
ebd.). 279<br />
Den TechnikgestalterInnen wird also <strong>de</strong>r gängigen Vorstellung nach die Macht<br />
zugesprochen, <strong>de</strong>n Gegenstandsbereich erkennen, verstehen und formal erfassen zu<br />
können, sei es auf Basis eines angeblich objektiven „Designs von Nirgendwo“ o<strong>de</strong>r<br />
<strong>einer</strong> „losgelösten Intimität“, die eine gewisse emotionale Verwickeltheit <strong>de</strong>r Subjekte<br />
mit ihrem Gegenstand, <strong>de</strong>r Technik, erlaubt (vgl. Suchman 2002a sowie 4.3.1). Eine<br />
De-Konstruktion <strong>de</strong>r Gestaltungs-Nutzungs-Dichotomie be<strong>de</strong>utet somit <strong>einer</strong>seits, all<br />
diese vorherrschen<strong>de</strong>n Vorstellungen über Technikgestaltung und -gestalterInnen <strong>kritisch</strong><br />
zu rekonstruieren. An<strong>de</strong>rerseits muss sie zugleich auf die Rolle <strong>de</strong>r Nutzung<br />
fokussieren und <strong>de</strong>ren Relevanz für die Entwicklung von Technologien hervorheben.<br />
Andrew Clement (1991, 1993) war <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r ersten, <strong>de</strong>r im Bereich <strong>de</strong>r Informatisierung<br />
von Schreibarbeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass auch die NutzerInnen<br />
einen wesentlichen Anteil an <strong>de</strong>r Gestaltung von Software leisten: „secretaries […]<br />
must make <strong>de</strong>cisions about files, forms, information flows, procedures and task<br />
sequences and other matter conventionally within the domain of systems <strong>de</strong>sign<br />
specialists. If these <strong>de</strong>cisions were ma<strong>de</strong> by <strong>de</strong>signers, this aspect of secretarial work<br />
would be clearly regar<strong>de</strong>d as <strong>de</strong>sign, and valued more highly as such. Instead, in the<br />
absence of recognition and support, office workers <strong>de</strong>sign systems informally, relying<br />
on their own locally <strong>de</strong>veloped and shared expertise.“ (Clement 1993, 342). Auch Mike<br />
Hales betont: „ Users ‚construct‘ technology: they do this both, symbolically, in their<br />
‚reading‘ of artefacts, and literally, in the articulation work that is essential before a<br />
concrete configuration of artefacts […] can serve as an a<strong>de</strong>quate day-by-day<br />
supporting structure for a live practice“ (Hales 1994 nach Suchman 2002a, 94).<br />
Die I<strong>de</strong>e, dass NutzerInnen Technologie selbst gestalten, wird in Zeiten <strong>de</strong>s Internet<br />
zunehmend populär. 280 Betraf dies zunächst vor allem die Gestaltung von Webseiten,<br />
so wird Technologie aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r „Social Software“ wie Blogs und Wikis<br />
heutzutage als ein „didaktischer Akteur“ verstan<strong>de</strong>n, durch <strong>de</strong>n technische Neugier<br />
geweckt wer<strong>de</strong>n kann (vgl. Wiesner 2008, Wiesner-St<strong>einer</strong> et al. 2006). Aus diesem<br />
Interesse resultieren<strong>de</strong> Beteiligungen <strong>de</strong>r NutzerInnen an <strong>de</strong>r technischen Weiterentwicklung<br />
können – wie einzelne Studien bereits aufgezeigt haben (vgl. etwa Sharp/<br />
Salomon 2008) – durchaus zu Innovationen führen. Ein Projekt, das ebenfalls auf <strong>de</strong>r<br />
Vorstellung aktiver NutzerInnen aufsetzt und zugleich darauf zielt, die Attraktivität von<br />
Ingenieurwissenschaften für junge Mädchen zu steigern, ist „Roberta“. 281 Die vom<br />
BMBF geför<strong>de</strong>rten und von <strong>de</strong>r Fraunhofer Gesellschaft durchgeführten Robotik-Kurse<br />
sollen bei Schulkin<strong>de</strong>rn, speziell bei Mädchen, Neugier<strong>de</strong> und Begeisterung für<br />
Technik wecken. Ziel ist, dass sie Technik nicht als gegeben, son<strong>de</strong>rn als gestaltbar<br />
erleben. 282 Die wissenschaftlichen Begleitstudien zeigten, dass das Interesse <strong>de</strong>r<br />
279 Auf einen ähnlichen Aspekt dieses Hierarchieverhältnisses verweist Stein Braten (1973), wenn er sogar<br />
noch im Kontext partizipativer Systementwicklung mit NutzerInnen von <strong>de</strong>r „Mo<strong>de</strong>llmacht“ <strong>de</strong>r<br />
TechnikgestalterInnen spricht.<br />
280 Vgl. hierzu auch die entsprechen<strong>de</strong>n Ausführungen in Kapitel 4.3.2.<br />
281 Roberta wur<strong>de</strong> 2005 als Markenname für die Fraunhofer-Gesellschaft beim Deutschen Patent- und<br />
Markenamt registriert, vgl. Wikipedia: http://<strong>de</strong>.wikipedia.org/wiki/Roberta_-_Mädchen_erobern_Roboter,<br />
(letzter Zugriff am 18.2.08).<br />
282 Die Robotik wird als beson<strong>de</strong>rs geeigneter Bereich eingeschätzt, um die Rolle passiver NutzerInnen zu<br />
<strong>de</strong>konstruieren: „Robotik bietet einen spielerischen Zugang zur Technik durch Anfassen und<br />
Ausprobieren. Mit Hilfe von didaktisch und technisch adaptierten Robotern lernen schon Kin<strong>de</strong>r innerhalb<br />
200
Mädchen „Computerexpertin zu wer<strong>de</strong>n, wenn sie es nur wollten“ durch eine<br />
Teilnahme gesteigert wer<strong>de</strong>n konnte (Hartmann et al. 2005). Doch wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
empirischen Beobachtung zugleich <strong>de</strong>utlich, dass nicht nur die Didaktik, son<strong>de</strong>rn auch<br />
die benutzten Roboterbaukästen (Lego Mindstorms), d.h. das Design <strong>de</strong>r Technologie,<br />
<strong>einer</strong> Anpassung bedurften, um einem geschlechtstereotypen Verhalten entgegenwirken<br />
zu können. Denn falls ein Grundmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Roboters mit Rä<strong>de</strong>rn verwen<strong>de</strong>t<br />
wur<strong>de</strong>, so veranlasste dies die beteiligten Jungen in <strong>de</strong>r Regel dazu, Autos o<strong>de</strong>r<br />
Panzer zu bauen. Gab es dagegen k<strong>einer</strong>lei solcher Vorgaben, tendierten sowohl<br />
Mädchen als auch Jungen dazu, Analogien zur Menschen- bzw. Tierwelt zu<br />
konstruieren (vgl. Wiesner 2004).<br />
Diese Ergebnisse machen darauf aufmerksam, dass es nicht nur auf <strong>de</strong>r vor<strong>de</strong>rgründigen<br />
Ebene <strong>de</strong>s äußeren Designs von Technologien schwer ist, Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
entgegenzuwirken. Denn NutzerInnen bringen Vergeschlechtlichungen<br />
über die Nutzung ein. Vielmehr zeigen die Ergebnisse <strong>de</strong>s Roberta-Projektes<br />
zugleich, dass die Möglichkeiten <strong>de</strong>r NutzerInnen Technik mitzukonstruieren stets<br />
begrenzt sind. Die geschlechtskodierte Dichotomie von Nutzung und Gestaltung kann<br />
zwar bis zu einem gewissen Grad aufgeweicht wer<strong>de</strong>n, jedoch liegt die Entscheidung<br />
über zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong> Rahmenbedingungen und technische Infrastrukturen dabei<br />
weiterhin in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen.<br />
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich <strong>de</strong>r Ansatz <strong>de</strong>r Dekonstruktion<br />
von Dualismen damit auf <strong>einer</strong> analytischen Ebene als äußerst hilfreich erwiesen hat,<br />
um die Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien besser zu verstehen.<br />
Gera<strong>de</strong> das Beispiel <strong>de</strong>r Gestaltung von Technologien durch NutzerInnen ver<strong>de</strong>utlicht<br />
jedoch die Grenzen dieses Ansatzes, wenn es darum geht, Technologien an<strong>de</strong>rs zu<br />
gestalten. Es ist im nachfolgen<strong>de</strong>n Kapitel noch weitergehend zu diskutieren, inwieweit<br />
eine Dekonstruktion von Dichotomien als ein Ausgangspunkt für methodische Ansätze<br />
<strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring von Technologie dienen kann.<br />
Anerkennung o<strong>de</strong>r Integration <strong>de</strong>s Ausgegrenzten?<br />
Ein neben <strong>de</strong>r Dekonstruktion geschlechtskodierter Dualismen in feministischen<br />
Ansätzen häufig verfolgtes Ziel besteht darin, das bislang Ausgegrenzte, welches in<br />
<strong>de</strong>r Regel „weiblich“ konnotiert ist, sichtbar zu machen und aufzuwerten. Dabei plädiert<br />
ein Strang <strong>de</strong>r Theorie und Forschung dafür, das Nichtformalisierbare, <strong>de</strong>r Informatisierung<br />
nicht Zugängliche, und sprachlich Unbestimmbare bzw. Außerdiskursive als<br />
solches anzuerkennen. Es wird somit ein unverfügbarer Rest <strong>de</strong>s Menschlichen gegenüber<br />
<strong>de</strong>m Maschinellen und Technischen unterstellt. Diese humanistisch geprägte<br />
Auffassung fin<strong>de</strong>t sich beispielsweise in <strong>de</strong>n frühen Schriften Lucy Suchmans zum<br />
Handlungsbegriff <strong>de</strong>r KI für die Mensch-Maschine-Interaktion (vgl. Suchman 1987).<br />
Auch <strong>de</strong>r formalen, rationalistischen Interpretation von Wissen und Information in <strong>de</strong>r<br />
Informatik wird häufig vorgeworfen, dass sie die „irrationalen“, kreativen,<br />
improvisieren<strong>de</strong>n und verkörperlichten Elemente „realer Informationsverarbeitung“<br />
eines Tages Grundkenntnisse <strong>de</strong>r Konstruktion von Robotern bis hin zu <strong>de</strong>ren Programmierung. Sie<br />
entwerfen, konstruieren, programmieren und testen mobile, autonome Roboter. Sie erfahren, dass<br />
Technik Spaß macht, lernen wie technische Systeme entwickelt wer<strong>de</strong>n und erwerben Kenntnisse in<br />
Informatik, Elektrotechnik, Mechanik und Robotik“ (Fraunhofer o.J., offizieller Flyer <strong>de</strong>s Projekts, zitiert<br />
nach: http://www.iais.fraunhofer.<strong>de</strong>/fileadmin/images/pics/Abteilungen/AR/PDF/Roberta_<strong>de</strong>.pdf, letzter<br />
Zugriff am 18.2.08).<br />
201
(Bratteteig/ Verne 1997, 45) nicht zu erfassen vermöge. 283 Dabei zeigten empirische<br />
Untersuchungen doch, „that <strong>de</strong>cision making involves politics, power and seemingly<br />
irrational behaviour: information is rather used to legitimate than to ground a <strong>de</strong>cision,<br />
<strong>de</strong>cisions are ma<strong>de</strong> with little or no factual basis. Improvisation, opportunistic<br />
behaviour, and gossip are key notions in real information processing“ (Bratteteig/Verne<br />
1997, 45).<br />
Während die einen das bislang für <strong>de</strong>n Formalismus Unverfügbare vor <strong>de</strong>r Informatisierung<br />
bewahren wollen, for<strong>de</strong>rn an<strong>de</strong>re feministische VertreterInnen die TechnikwissenschaftlerInnen<br />
mehr o<strong>de</strong>r weniger dazu auf, das bis dato ausgegrenzte und<br />
implizit o<strong>de</strong>r explizit als „weiblich“ Gedachte <strong>de</strong>r Formalisierung zugänglich zu machen<br />
(vgl. etwa Grundy 2001). Die Integration in die Technologie soll das zuvor Vernachlässigte<br />
aufwerten und <strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Dualismus etablierten Gegensatz damit<br />
letztendlich als nichtig erklären. Ein solcher Zugang liegt etwa <strong>de</strong>m in Abschnitt 4.2.3<br />
skizzierten Klassifikationssystem NIC zugrun<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>m Humor als eine<br />
Pflegehandlung von Krankenschwestern <strong>de</strong>finiert wor<strong>de</strong>n ist. Ein an<strong>de</strong>rer Schauplatz,<br />
an <strong>de</strong>m sich die unterschiedlichen Positionen von Anerkennung o<strong>de</strong>r Integration <strong>de</strong>s<br />
Ausgegrenzten beson<strong>de</strong>rs gut <strong>de</strong>monstrieren und zugleich mit Blick auf die Technikgestaltung<br />
reflektieren lassen, sind feministische Debatten um Körper, Erfahrung und<br />
Emotion.<br />
Der Ausschluss <strong>de</strong>s Körperlichen, <strong>de</strong>r subjektiven Erfahrung und <strong>de</strong>s Emotionalen<br />
aus <strong>de</strong>m Prozess <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung stehen seit langer Zeit<br />
im Zentrum feministischer Kritik. Feministische Theoretikerinnen und Philosophinnen<br />
(Lloyd 1984, Jaggar 1989, Nussbaum 2001) sowie feministische Naturwissenschaftsforscherinnen<br />
(vgl. etwa Keller 1986 [1985], Schiebinger 1999) untersuchten <strong>kritisch</strong><br />
<strong>de</strong>ssen Voraussetzung, die Trennung von Körper und Geist, Erfahrung und Objektivität<br />
sowie Gefühl und Vernunft. Seit <strong>de</strong>r Antike gelten Körper von Frauen und ihre<br />
Subjektivität ebenso wie mit Frauen assoziierte Eigenschaften wie Fürsorglichkeit,<br />
Empathie und Liebe in westlichen Denktraditionen als „das An<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Vernunft“. Sie<br />
stellen zugleich das Gegenbild par excellence zur verbreiteten Vorstellung klassischer<br />
Maschinen dar. Entfremdungstheoretische Ansätze beklagten vor diesem Hintergrund<br />
im Zuge <strong>de</strong>r zunehmen<strong>de</strong>n Verbreitung von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
ein „Verschwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Körpers“, 284 eine „Totalentkörperung“ (Du<strong>de</strong>n<br />
1997), o<strong>de</strong>r gar einen „Verlust <strong>de</strong>s Realen“ (Baudrilliard). Dieser kulturpessimistisch<br />
geprägten Haltung gegenüber neuen Technologien lassen sich u.a. auch die Ansätze<br />
von Böhme 1992 sowie List 1994, 1997 zuordnen.<br />
Doch nicht nur humanistisch inspirierte Kritiken konstatieren eine Entkörperlichung.<br />
Auch postmo<strong>de</strong>rne Theoretikerinnnen arbeiteten – wie etwa Katherine Hayles am<br />
Beispiel aufkommen<strong>de</strong>r kybernetischer Konzepte und Künstlicher Intelligenz im letzten<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt – heraus, dass Informationen ihren Körper verloren haben (Hayles 1999,<br />
2). Hayles warnt davor, die konstatierte Entkörperlichung in Mo<strong>de</strong>llen menschlicher<br />
(bzw. posthumaner) 285 Subjektivität fortzuschreiben. Ihr Gegenmo<strong>de</strong>ll „embraces the<br />
283 Vgl. hierzu auch die Einführung zu Abschnitt 4.3.<br />
284 Die Re<strong>de</strong> vom „Verschwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Körpers“ taucht insbeson<strong>de</strong>re in feministischen Debatten um <strong>de</strong>n<br />
Körper, oft auch an <strong>de</strong>r Schnittstelle zu Analysen <strong>de</strong>s Internet, Cyberspace, neuer Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien auf, vgl. hierzu etwa Becker/ Schnei<strong>de</strong>r 2000, Bath et al. 2005.<br />
285 Mit ihrem Begriff <strong>de</strong>s „Posthumanen“ setzt Hayles eine enge Verstrickung von menschlichen und nichtmenschlichen<br />
Wesen voraus und schließt damit an die Akteur-Netzwerk-Theorie und Donna Haraway an:<br />
202
possibilities of information technologies without being seduced by the fantasies of<br />
unlimited power and disembodied immortality, that recognizes and celebrated the<br />
finitu<strong>de</strong> as a condition of human beings, and that un<strong>de</strong>rstands human life is embed<strong>de</strong>d<br />
in a material world of great complexity, one on which we <strong>de</strong>pend for continued<br />
survival.“ (Hayles 1999, 5).<br />
Analysen <strong>de</strong>s aktuellen technowissenschaftlichen Arbeitens zeigen jedoch, dass<br />
Kritiken an <strong>de</strong>n „Entmaterialisierungsstrategien <strong>de</strong>r Technowissenschaften“ (Bath et al.<br />
2005a, 22) – egal, welcher Couleur – revidiert wer<strong>de</strong>n müssen. Denn neuerdings<br />
wer<strong>de</strong>n in Gebieten wie <strong>de</strong>r „verhaltensbasierten Robotik“, <strong>de</strong>r „embodied artificial<br />
intelligence“ o<strong>de</strong>r „emotionalen Softwareagentenforschung“ Artefakte kreiert, die das<br />
zuvor Ausgeschlossene nicht nur untersuchen, son<strong>de</strong>rn gewissermaßen zelebrieren.<br />
Verkörperung, Situierung, Sozialität und Emotionen stehen dort im Zentrum <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llierung und Formalisierung, um diese <strong>de</strong>n Technologien einschreiben zu können.<br />
Angesichts dieser Entwicklungen lässt sich mit Jutta Weber fragen, ob die Technikkritik<br />
– sei es die humanistische o<strong>de</strong>r die postmo<strong>de</strong>rne à la Latour o<strong>de</strong>r Haraway – doch<br />
noch Gehör gefun<strong>de</strong>n hat (vgl. Weber 2003b, 120).<br />
Die neueren Entwicklungen in <strong>de</strong>n Technosciences hin zu situierten, verkörperten<br />
sozio-emotionalen Maschinen, die das rationalistische Paradigma scheinbar hinter sich<br />
lassen, könnten hoffnungsvoll stimmen, zeigen diese doch einen Wan<strong>de</strong>l an, mit <strong>de</strong>m<br />
lange dominante Grenzziehungen zwischen Mensch und Maschine, Körper und Geist,<br />
Emotion und Rationalität grundlegend in Bewegung zu geraten scheinen. Markierten<br />
Körper, subjektive Erfahrung und Emotionen in hegemonialen Diskursen bislang<br />
<strong>einer</strong>seits <strong>de</strong>n Gegensatz zur Rationalität und an<strong>de</strong>rerseits das Humane im Vergleich<br />
zum Maschinellen, so wer<strong>de</strong>n bislang vorherrschen<strong>de</strong> Grenzziehungen zwischen Körper<br />
und Geist, Gefühl und Vernunft, Mensch und Maschine mit <strong>de</strong>n gegenwärtigen<br />
Entwicklungen <strong>de</strong>r Technoscience zunehmend brüchig. Das Versprechen <strong>einer</strong><br />
Auflösung dieser zutiefst geschlechtskodierten Dichotomien bedarf jedoch <strong>einer</strong><br />
<strong>de</strong>taillierten Analyse technowissenschaftlicher Ansätze und Umsetzungen, wie sie hier<br />
nachfolgend anhand <strong>de</strong>r Beispiele von Körperkonzepten in <strong>de</strong>r neueren Robotik und<br />
von Emotionskonzepten in <strong>de</strong>r Softwareagentenforschung vorgenommen wird.<br />
Körper vs. Geist in <strong>de</strong>r verhaltensbasierten Robotik<br />
Auf die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Körpers bei <strong>de</strong>r technischen Konstruktion von „Intelligenz“<br />
machte <strong>de</strong>r Robotiker Rodney Brooks seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren aufmerksam (vgl. Brooks<br />
1991, Steels/ Brooks 1995, Brooks 2002). Er verwarf damit die klassischen symbolorientierten<br />
Ansätze <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung, die ausgehend von <strong>de</strong>r<br />
Annahme, dass eine vollständige Repräsentation <strong>de</strong>r Umgebung eines Artefaktes<br />
möglich sei, auf die Nachbildung rationalen Denkens zielten. Statt <strong>einer</strong> solchen<br />
entkörperlichten („disembodied“) KI propagierte er die Verkörperung, insbeson<strong>de</strong>re<br />
eine verkörperte Interaktion <strong>de</strong>r Roboter mit ihrer physischen Umwelt als eine<br />
grundlegen<strong>de</strong> Voraussetzung für die Entwicklung von Intelligenz. „Brooks’s position<br />
has been that rather than a symbolic process that prece<strong>de</strong>s action, cognition must be<br />
„Bruno Latour has argued that we have never been mo<strong>de</strong>rn; the seriated history of cybernetics - emerging<br />
networks at once material real, socially regulated and discursively constructed – suggests, for similar<br />
reasons, that we have always been posthuman“ (Hayles 1999, 291). Das Projekt <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne, die<br />
Kategorien Mensch und Nicht-Mensch zu trennen und reinzuhalten, sei ihres Erachtens gescheitert.<br />
203
an emergent property of action, the foundational form of which he takes to be a<br />
navigation through a physical environment“ (Suchman 2007, 230, Hervorh. im Original).<br />
Für die Konzeption <strong>de</strong>r Artefakte ließ er sich – <strong>de</strong>m Gründungsmythos dieser<br />
Fachrichtung zufolge – von <strong>de</strong>r Bewegung <strong>einer</strong> Küchenschabe durch <strong>de</strong>n Raum inspirieren<br />
(vgl. Hayles 2003, 101). Das Verhalten von Insekten gilt ihm als ein Vorgängerstadium<br />
in <strong>de</strong>r Genese humanoi<strong>de</strong>r Roboter (vgl. Brooks 2002, 45ff). Auf dieser<br />
Grundlage entwickelte Brooks einen evolutionsbiologischen bzw. verhaltensbasierten<br />
Ansatz, nach <strong>de</strong>m simples Verhalten im Sinne von Reiz-Reaktions-Schemata innerhalb<br />
eines ‚bottom-up‘-Ansatzes technisch mo<strong>de</strong>lliert wer<strong>de</strong>n soll. Realisiert hat er diese<br />
I<strong>de</strong>en mit Hilfe <strong>einer</strong> so genannten Subsumptionsarchitektur, bei <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>ne<br />
Ebenen von Verhalten differenziert und relativ autonom voneinan<strong>de</strong>r programmiert<br />
wer<strong>de</strong>n. 286<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis von Brooks Ansatz lässt sich nun fragen, was Verkörperung in <strong>de</strong>r<br />
situierten Robotik be<strong>de</strong>utet. Dazu kann zunächst mit Suchman (2007, 230) festgehalten<br />
wer<strong>de</strong>n, dass die Robotik weiterhin stark auf das Funktionieren <strong>de</strong>s rationalen<br />
Denkens ausgerichtet ist bzw. eine Form instrumenteller Wahrnehmung repräsentiert.<br />
Die situierte Robotik grün<strong>de</strong>t, wie Hayles (2003) <strong>de</strong>tailliert beschreibt, auf <strong>de</strong>m so<br />
genannten „Sense-Think-Act“-Paradigma. Dabei wird davon ausgegangen, dass <strong>de</strong>r<br />
Körper Stimuli aus dieser Umgebung mittels eigens dafür konstruierter Sensoren<br />
wahrnimmt und darauf geeignete Reaktionen bzw. Handlungen generiert, die mittels<br />
Symbolverarbeitungsprozessen, d.h. maschinellem „Denken“, berechnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Hayles sieht in Brooks Konzept eine Ten<strong>de</strong>nz, das Bewusstsein in s<strong>einer</strong><br />
Vorrangstellung zu entthronisieren und zu <strong>einer</strong> Begleiterscheinung zu <strong>de</strong>klassieren.<br />
Denn statt einem biologischen Substrat wie <strong>de</strong>m Neokortex gilt nun die Wahrnehmung<br />
und unmittelbare Handlung in <strong>de</strong>r Welt als primäre Quelle kognitiver Prozesse. Auf<br />
welcher materiellen Grundlage „Denken“ erfolgt, ob es in einem menschlichen Körper<br />
o<strong>de</strong>r in einem Maschinenkörper stattfin<strong>de</strong>t, wer<strong>de</strong> zunehmend irrelevant. Vielmehr sei<br />
eine Konvergenz zwischen Mensch und Maschine zu beobachten, die sich insbeson<strong>de</strong>re<br />
anhand technischer Zugriffe auf emergente Prozesse, Intuition und Kreativität<br />
ablesen lassen: „Now it is not merely rational thought that intelligent machines are seen<br />
to possess, but creativity and intuition as well. The fact that programs arrive at these<br />
results blindly, without any appreciation for what they have accomplished, can be<br />
ambiguously un<strong>de</strong>rstood as indicating that machines are capable of more creativity<br />
than that with which they have been credited, or that human intuition may be more<br />
mechanical than we thought.“ (Hayles 2003, 116). Insgesamt wer<strong>de</strong> die menschliche<br />
Natur in <strong>de</strong>r situierten Robotik neu <strong>de</strong>finiert, <strong>de</strong>nn wir könnten nun das Humane nicht<br />
mehr unabhängig von intelligenten Maschinen <strong>de</strong>finieren. Selbst kulturpessimistische<br />
TechnikkritikerInnen wie Francis Fukuyama, 287 die Emotionen, Sorge, Pflege u.a. zum<br />
286 Einer <strong>de</strong>r ersten Roboter, <strong>de</strong>r auf diesem Prinzip basierte, war „Allen“, für <strong>de</strong>n eine Kontrollebene, eine<br />
Ebene, die Brooks als „Wan<strong>de</strong>rlust“ bezeichnet sowie eine dritte, die es Allen ermöglichen sollte, die Welt<br />
zu erkun<strong>de</strong>n, implementiert wur<strong>de</strong>n. Brooks beschreibt das Zusammenspiel dieser drei Ebenen<br />
folgen<strong>de</strong>rmaßen: Wenn <strong>de</strong>m Roboter in <strong>de</strong>r Ferne etwas interessant erschien, so bewegte er sich darauf<br />
zu. War dagegen gera<strong>de</strong> nichts Interessantes zu ent<strong>de</strong>cken, so übernahm die Wan<strong>de</strong>rlust die Kontrolle<br />
über das Verhalten <strong>de</strong>s Roboters, vgl. Brooks 2002, 50f.<br />
287 Für eine feministische Kritik an Fukuyamas Geschlechterdifferenz<strong>de</strong>nken, das seinen Überlegungen in<br />
„Our posthuman future“ (2002) eingeschrieben ist, vgl. etwa Lettow 2003.<br />
204
spezifisch Menschlichen erklären, wür<strong>de</strong>n ihr Verständnis <strong>de</strong>s Humanen letztendlich an<br />
<strong>de</strong>n gegenwärtigen Fähigkeiten intelligenter Maschinen messen. 288<br />
Während Hayles Ausführungen zur situierten Robotik allgemein auf die Rekonfigurationen<br />
<strong>de</strong>s Humanen fokussieren, 289 analysiert Suchman diese aktuellen Verschiebungen<br />
mit Blick auf geschlechtskonnotierte Dichotomien. Suchman versteht Brooks<br />
Konzept in <strong>de</strong>m Sinne, dass das Primat <strong>de</strong>s rationalen Denkens gegenüber <strong>de</strong>r<br />
Verkörperung durch das „Sense-Think-Act“-Paradigma weitgehend unangegriffen<br />
bleibt, selbst wenn Beeinflussungen von Körper und Geist in bei<strong>de</strong>n Richtungen stattfin<strong>de</strong>n<br />
(Suchman 2007, 230f). Zu<strong>de</strong>m sei <strong>de</strong>r Körper (<strong>de</strong>s Roboters) in <strong>einer</strong> Welt<br />
verortet, die von jenem als unabhängig angenommen wird. Die situierte Robotik basiere<br />
somit auf einem erkenntnistheoretischen Realismus, <strong>de</strong>r sowohl <strong>de</strong>n Körper als<br />
auch die diesen umgeben<strong>de</strong> Welt naturalisiert und bei<strong>de</strong>s als eine essentielle Grundlage<br />
für das Denken voraussetzt. Die Dichotomie von Körper und Geist wer<strong>de</strong> <strong>de</strong>mzufolge<br />
durch die neuere Robotik we<strong>de</strong>r aufgelöst, noch geschlechtlich neu kodiert.<br />
Hoffnungen auf Verschiebungen in <strong>de</strong>r strukturell-symbolischen Geschlechterordnung<br />
im Zuge <strong>de</strong>r Entwicklungen neuerer Robotik, die sich aus Haraways Ansatz ableiten<br />
ließen, blieben damit uneingelöst.<br />
Diesem Urteil, das mit verschie<strong>de</strong>nen feministischen Kritiken in Einklang steht, stellt<br />
Jutta Weber unter Rekurs auf Hayles entgegen, dass die neuere Robotik und Artificial<br />
Life-Forschung mit völlig neu gearteten Körperkonzepten arbeite. Im Gegensatz zu<br />
humanistischen Vorstellungen von Einheit, Stabilität und festen Grenzen wer<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Organismus in diesen Bereichen <strong>de</strong>r KI zunehmend als „flexibel, dynamisch und in permanenter<br />
Verän<strong>de</strong>rung“ (Weber 2003b, 124) begriffen. Im Mittelpunkt stün<strong>de</strong> das<br />
Moment <strong>de</strong>s Neuen, Spontaneität und emergentes Verhalten. Die komplexen<br />
technischen Systeme wür<strong>de</strong>n von ihren GestalterInnen mit <strong>de</strong>r Fähigkeit zur<br />
permanenten Erneuerung, Neugestaltung und Spontaneität ausgestattet. Es ginge<br />
darum, <strong>de</strong>n Überschuss <strong>de</strong>s Lebendigen zu formalisieren und instrumentalisieren. Ziel<br />
dieser Technowissenschaften sei die Nachbildung <strong>de</strong>s Lebendigen und die „Produktion<br />
<strong>de</strong>s Unerwarteten“ (Weber 2005a). 290<br />
288 Hayles kritisiert Fukuyamas Argumentation, dass Menschen eine beson<strong>de</strong>re Spezies seien, als<br />
tautologische: „It seems that Fukuyama uses evolutionary reasoning when it is convenient for his<br />
argument and dispenses when it threatens his conclusion that human beings are spezial. […] Humans are<br />
special because they have human nature; this human nature is in danger of being mutated by<br />
technological means; to preserve our specialness, we must therefore not tamper wih human nature. The<br />
neat closure of this argument can be disrupted by the observation that it must also be ‚human nature‘ to<br />
use technology, since from the beginning of the species human beings have always used technology.<br />
Moreover, technology has coevolved throughout the millennium with human beings and helped in myriad<br />
profound and subtle ways to make human nature what it is“ (Hayles 2003, 113f).<br />
289 In ihrem Buch „How we became posthuman“ (1999) beschreibt Hayles Transformationen <strong>de</strong>r<br />
Verhältnisse zwischen Mensch und Maschine anhand <strong>de</strong>r Entwicklungsgeschichte <strong>de</strong>r Kybernetik seit<br />
ihrer Entstehung in <strong>de</strong>n Nachkriegsjahren. Am En<strong>de</strong> dieses Prozesses stün<strong>de</strong>n posthumane Körper bzw.<br />
Verkörperungen, die eine naturalistische Auffassung von Körper auf <strong>de</strong>r Basis humanistischer Vorstellungen<br />
und <strong>de</strong>r eines mo<strong>de</strong>rnen Subjektbegriffs ersetzten. Ihr Konzept <strong>de</strong>s posthumanen Körpers kann als<br />
Suche nach einem verkörperlichten Mo<strong>de</strong>ll von Subjektivität und Handlungsfähigkeit verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n,<br />
das sich vor <strong>de</strong>m Hintergrund westlicher Philosophiegeschichte und ihrer Kritik, insbeson<strong>de</strong>re an <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung von Dichotomien, als ein feministisches Projekt auffassen lässt.<br />
290 In <strong>de</strong>r Artificial Life-Forschung „wird <strong>de</strong>r Körper nicht mehr als natürlich und gegeben verstan<strong>de</strong>n. Wenn<br />
auch die Fähigkeit <strong>de</strong>r Mutation, Variation und Verän<strong>de</strong>rung wie<strong>de</strong>rum als natürlich interpretiert wird, so<br />
wird <strong>de</strong>r Körper <strong>de</strong>naturalisiert, dass er nicht mehr als unverän<strong>de</strong>rbar, teleologisch und von harmonischen<br />
Prinzipien durchwirkt, son<strong>de</strong>rn eher als Baukasten verstan<strong>de</strong>n wird. […] Im Zeitalter <strong>de</strong>r Technoscience<br />
geht es zwar um die Mo<strong>de</strong>llierung von Körpern und Maschinen, die mehr sind als die Summe ihrer Teile –<br />
205
Weber weist auf zunächst erstaunliche Parallelen zwischen Haraways Konzept <strong>de</strong>r<br />
Verkörperung und <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r neueren Robotik hin. Übereinstimmungen ließen sich nicht<br />
nur im Bezug auf dynamisierte Körperverständnisse, 291 son<strong>de</strong>rn auch hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Auflösung <strong>de</strong>r hierarchischen Subjekt-Objekt-Relation und <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Vorstellung<br />
aktiver Wissensobjekte erkennen: „Was an<strong>de</strong>res wäre die I<strong>de</strong>e, autonome und<br />
selbständige Agenten zu entwickeln, die evolvieren, wachsen und lernen? […] Und<br />
untergräbt nicht die I<strong>de</strong>e von emergenten Maschinen, von Robotern ‚out of control‘<br />
(Brooks), die konstruiert sind, aber zugleich sich selbst konstruieren und weiterentwickeln<br />
sollen, wie<strong>de</strong>rum die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Autonomie <strong>de</strong>s vormals selbstherrlichen<br />
Forschers?“ (Weber 2003b, 127). Die Philosophin Barbara Becker plädiert dafür, die<br />
Eigendynamik <strong>de</strong>s Körperlichen und die „Dimensionen <strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rständigen, verkörpert<br />
in <strong>de</strong>r eigenen und frem<strong>de</strong>n Materialität“ (vgl. Becker 2000, 64) anzuerkennen. Es<br />
scheint so, wie Weber betont, als ob die von <strong>de</strong>r Position <strong>de</strong>r Phänomenologie<br />
angeführten <strong>kritisch</strong>en Argumente von <strong>de</strong>n technologischen Entwicklungen <strong>de</strong>r Robotik<br />
umgesetzt wür<strong>de</strong>n.<br />
Weber gesteht diesen neueren technowissenschaftlichen Konzepten zwar das<br />
Potential zu, Limitierungen und Engführungen <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n symbolorientierten<br />
KI zu überschreiten, doch stellt sie dabei zugleich eine krasse Fortsetzung alter hierarchischer<br />
Muster und Reduktionen fest. Denn die dynamische, flexible Verkörperung,<br />
die Tinkering-Verfahren und weitere Konzepte <strong>de</strong>r neueren KI wür<strong>de</strong>n mit<br />
evolutionsbiologischen Argumenten begrün<strong>de</strong>t, die ein sozialdarwinistisches Gepäck<br />
mit sich tragen. „Mutter“ Natur wer<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n RobotikerInnen herangezogen und damit<br />
wer<strong>de</strong> auf bekannte, von verschie<strong>de</strong>nen Feministinnen stark kritisierte Schemata<br />
rekurriert, um die <strong>de</strong>naturalisierten Körper wie<strong>de</strong>rum als „natürliche“ <strong>de</strong>klarieren zu<br />
können. Technologische Konzeptionen flexibler Körper wür<strong>de</strong>n darüber legitimiert,<br />
dass die Natur eine solche Strategie <strong>de</strong>r Verkörperung „schon immer“ verfolgt habe. So<br />
seien auch die Rückgriffe <strong>de</strong>r KI auf das Verhalten von Insekten im Kontext <strong>de</strong>r sozialdarwinistischen<br />
I<strong>de</strong>ologie <strong>de</strong>s ‚survival of the fittest’ zu verstehen, mit <strong>de</strong>r Brooks die<br />
„natürliche“, evolutionsbiologische Genese beson<strong>de</strong>rs robuster Organismen auf die<br />
Entwicklung von Artefakten zu übertragen sucht. Auch die These, dass Bewusstsein<br />
nur ein Epiphänomen <strong>de</strong>s Lebens sei und einen vernachlässigbaren Bestandteil<br />
menschlicher Intelligenz darstelle, erscheine vor diesem Hintergrund in neuem Licht.<br />
Ganz im Gegensatz zu <strong>de</strong>r zunächst hoffnungsvollen Interpretation, dass die Robotik<br />
die geschlechtskonnotierte Dichotomie von Körper und Geist überwin<strong>de</strong>, wür<strong>de</strong><br />
Bewusstsein von <strong>de</strong>n RobotikerInnen evolutionsgeschichtlich als eine späte<br />
Entwicklung begriffen, die keine notwendige Voraussetzung für das Leben sei.<br />
Insgesamt zeigt Weber auf, dass neue Körperverständnisse in <strong>de</strong>r Robotik mit<br />
vielfältigen Re-Naturalisierungen verbun<strong>de</strong>n sind und zu<strong>de</strong>m an neoliberale I<strong>de</strong>ale<br />
erinnerten. Die mit flexiblen, offenen, dynamischen Körpern verbun<strong>de</strong>nen Grenzauflösungen<br />
be<strong>de</strong>uteten somit „noch lange keine postessentialistische Körperpolitik<br />
aber nicht im Sinne <strong>einer</strong> höheren harmonischen Ordnung, son<strong>de</strong>rn in Form <strong>einer</strong> Denaturalisierung, die<br />
eine Dynamisierung von Körpern möglich macht.“ (Weber 2003b, 125).<br />
291 Haraways Konzept postmo<strong>de</strong>rner Körper sieht sie in <strong>de</strong>m folgen<strong>de</strong>n Zitat prägnant beschrieben:<br />
„Feministische Verkörperung han<strong>de</strong>lt also nicht von <strong>einer</strong> fixierten Lokalisierung in einem verdinglichten<br />
Körper, ob dieser nun weiblich o<strong>de</strong>r etwas an<strong>de</strong>res ist, son<strong>de</strong>rn von Knotenpunkten in Fel<strong>de</strong>rn,<br />
Wen<strong>de</strong>punkten von Ausrichtungen, und <strong>de</strong>r Verantwortlichkeit für Differenz in materiell-semiotischen<br />
Be<strong>de</strong>utungsfel<strong>de</strong>rn“ (Haraway 1995d [1988]), 88f).<br />
206
jenseits <strong>de</strong>r Kategorien Geschlecht, Rasse o<strong>de</strong>r Klasse o<strong>de</strong>r generell jenseits alter Hierarchisierungen<br />
und Polarisierungen.“ (Weber 2005a, 69) . Deshalb könne die neuere<br />
Robotik nicht so hoch gefeiert wer<strong>de</strong>n, wie dies einzelne <strong>kritisch</strong>e WissenschaftsforscherInnen<br />
tun, nur weil die mo<strong>de</strong>rne Logik <strong>de</strong>s Immergleichen, Vorhersehbaren<br />
und Geplanten von <strong>de</strong>n neuen Konzepten durchbrochen wer<strong>de</strong>. Vielmehr plädiert sie<br />
dafür, Verantwortung für vollzogene Grenzüberschreitungen zu übernehmen und<br />
Offenheit, Nicht-Linearität, Partialität und Wi<strong>de</strong>rsprüchlichkeit nicht nur zu begrüßen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch nach <strong>de</strong>ren Ein- und Ausschlusslogiken zu fragen. Weber klagt Parteilichkeit<br />
und Verantwortlichkeit ein. Es gelte, Renaturalisierungen wie die für die Robotik<br />
aufgezeigten zu vermei<strong>de</strong>n, Verbindungen von Politik mit Technoscience herzustellen<br />
und sich für ‚lebbare Welten‘ im Sinne Haraways einzusetzen (Weber 2003b).<br />
Suchman (2007) weist darüber hinausgehend darauf hin, dass nicht nur die<br />
Konzepte, auf <strong>de</strong>nen die technowissenschaftlichen Projekte basieren, <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en<br />
Inspektion zu unterziehen seien, son<strong>de</strong>rn ebenso die praktischen Anwendungen (vgl.<br />
auch Weber 2003a). Denn die theoretischen Anleihen <strong>de</strong>r Robotik wür<strong>de</strong>n zwar<br />
versprechen, dass die Artefakte auf <strong>de</strong>r Grundlage phänomenologischer bzw.<br />
autopoetischer Ansätze konstruiert wer<strong>de</strong>n. Dieser Anspruch bliebe jedoch häufig<br />
uneingelöst, da bei <strong>de</strong>r konkreten Realisierung <strong>de</strong>r Konzepte in <strong>de</strong>n Maschinen<br />
fundamentale Probleme aufträten. „However inspired by phenomenologists like<br />
Hei<strong>de</strong>gger or Merleau Ponty, and the autopoesis of Maturana and Varela, the<br />
contingent interactions of biological, cultural-historical and autobiographically<br />
experiental embodiment continue to elu<strong>de</strong> what remain at heart of functionalist<br />
projects“ (Suchman 2007, 231). Insofern seien Ansätze, die die Be<strong>de</strong>utung feministischer<br />
Theorien für theoretische Konzeptionen <strong>de</strong>r KI herausstellen, höchst anerkennenswert.<br />
Jedoch wür<strong>de</strong>n die Erfor<strong>de</strong>rnisse technischer Gestaltung die TechnowissenschafterInnen<br />
häufig von <strong>de</strong>r Rhetorik <strong>de</strong>r Verkörperlichung auf <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Informatik zurückgeholt wer<strong>de</strong>n, auf <strong>de</strong>m sie letztendlich doch wie<strong>de</strong>r altbekannten<br />
ingenieurwissenschaftlichen Praktiken folgten.<br />
Insgesamt vermögen bisher we<strong>de</strong>r die Körperkonzepte auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s „Sense-<br />
Think-Act“-Paradigmas, welches die Interaktion <strong>de</strong>r Artefakte mit <strong>de</strong>r physischen<br />
Umgebung ins Spiel bringt, o<strong>de</strong>r diejenigen, die <strong>de</strong>r postmo<strong>de</strong>rnen Flexibilität und<br />
Offenheit zugerecht wer<strong>de</strong>n, noch die praktischen Realisierungen dieser theoretischen<br />
Ansätze in <strong>de</strong>r Robotik die Hoffnung feministischer Theoretikerinnen auf Aufhebung<br />
von Dualismen und Geschlechterdichotomisierungen einzulösen.<br />
Rationalität vs. Emotion in <strong>de</strong>r Softwareagenten- und Interface-Gestaltung<br />
Eine weitere grundlegen<strong>de</strong> Dichotomie ist die von Gefühl vs. Vernunft, die in in<br />
westlichen Denktraditionen ebenso vergeschlechtlicht erscheint wie die Dichotomie von<br />
Körper und Geist (vgl. etwa Jaggar 1989). In einem Projekt zur Softwareagentenforschung<br />
292 hatte ich untersucht, ob bzw. inwieweit das gegenwärtige Bestreben von KI-<br />
und HCI-ForscherInnen, Maschinen und Interfaces Emotionen zu verleihen, als eine<br />
292 Das Projekt „Sozialität mit Maschinen. Anthropomorphisierung und Vergeschlechtlichtung in aktueller<br />
Agentenforschung und Robotik“ mit <strong>de</strong>r Laufzeit April 2004-September 2006 wur<strong>de</strong> im Rahmen <strong>de</strong>s<br />
Programms fForte vom österreichischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk)<br />
geför<strong>de</strong>rt. Die Projektleitung hatte ao.Prof. Mona Singer vom Institut für Wissenschaftstheorie<br />
(Philosophie) <strong>de</strong>r Universität Wien.<br />
207
fundamentale Grenzüberschreitung <strong>de</strong>s Dualismus von Rationalität und Emotionalität<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n kann (vgl. Bath 2006a, 2009. 2010). Ließe sich dies positiv<br />
beantworten und sich anhand <strong>de</strong>r emotionalen Maschine tatsächlich eine Auflösung<br />
dieser Dichotomie konstatieren, so wür<strong>de</strong> das im Anschluss an Haraway die Frage<br />
aufwerfen, ob mit dieser Grenzüberschreitung ein Brüchigwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r dichotom-hierarchischen<br />
Geschlechterordnung einhergeht und inwiefern diese Entwicklungen für<br />
feministische Interventionen in <strong>de</strong>r Technikgestaltung genutzt wer<strong>de</strong>n können. Um eine<br />
soli<strong>de</strong> Einschätzung dieser technowissenschaftlichen Entwicklungen hin zur emotionalen<br />
Maschine vornehmen zu können, arbeitete ich zunächst heraus, auf welchen<br />
generellen Trends und theoretischen Grundlagen diese Auflösung <strong>de</strong>s Gegensatzes<br />
von Rationalem und Emotionalem beruht und wie diese in <strong>de</strong>r konkreten Praxis <strong>de</strong>r<br />
technischen Realisierung umgesetzt wird.<br />
Generell lässt sich in <strong>de</strong>n letzten Jahren innerhalb <strong>de</strong>r Forschungslandschaft ein<br />
erstaunliches Interesse an Gefühlen feststellen. War die Wissenschaft westlicher<br />
Gesellschaften lange Zeit von einem Streben nach Rationalität geprägt, das alles, was<br />
<strong>de</strong>n Anschein <strong>de</strong>s Gefühlsbehafteten erweckt, <strong>de</strong>zidiert ausschließt o<strong>de</strong>r abwertet, so<br />
<strong>de</strong>utet sich hier gegenwärtig ein grundlegen<strong>de</strong>r Wan<strong>de</strong>l an, wie bereits ein oberflächlicher<br />
Blick auf die Veröffentlichungslandschaft zeigt. Quer durch die Disziplinen ist die<br />
Re<strong>de</strong> von „<strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Gefühle“ (Benthien et al. 2000), <strong>de</strong>r „Soziologie <strong>de</strong>r<br />
Emotionen“ (Flam 2002) o<strong>de</strong>r „The cultural politics of emotions“ (Ahmed 2004). Diese<br />
Verschiebung <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Aufmerksamkeit bringt <strong>de</strong>r Neurophysiologe<br />
Antonio Damasio am markantesten auf <strong>de</strong>n Punkt, in<strong>de</strong>m er menschliches (Selbst-<br />
)Bewußtsein nicht mehr ausschließlich über das rationale Denken <strong>de</strong>finiert, son<strong>de</strong>rn<br />
Descartes Leitsatz durch ein „Ich fühle, also bin ich“ (Damasio 2000) zu ersetzen<br />
sucht. Seine disziplinäre Ausrichtung scheint eine <strong>de</strong>r wesentlichen Grundlagen <strong>de</strong>s<br />
Interesses an Emotionen darzustellen. Die Erforschung <strong>de</strong>r Gefühle, welche nach <strong>de</strong>r<br />
Rolle <strong>de</strong>s Emotionalen und Affektiven bei rationalen Prozessen fragt, hat mit <strong>de</strong>n<br />
neueren Ergebnissen <strong>de</strong>r Hirnforschung und Kognitionsforschung eine (natur-<br />
)wissenschaftliche Legitimation bekommen. Auch die meisten <strong>de</strong>r KI-und HCI-<br />
ForscherInnen, die <strong>de</strong>n Artefakten Emotionen einschreiben möchten, bauen auf diesen<br />
kognitionswissenschaftlichen Ansätzen auf.<br />
Präsentiert wird die neue Forschungsrichtung <strong>de</strong>r emotionalen Maschine jedoch<br />
primär mit <strong>de</strong>m Argument, die Verständigung zwischen Mensch und Maschine erleichtern<br />
zu wollen (vgl. etwa Picard 2002, 213f). 293 Diese Verschiebung von <strong>de</strong>r reinen<br />
Technikentwicklung hin zu <strong>de</strong>n NutzerInnen ist in <strong>de</strong>r Informatik allgemein zu beobachten.<br />
Das Bestreben, Maschinen emotional zu gestalten, kann somit als ein Ausdruck<br />
<strong>de</strong>s Paradigmenwechsels in <strong>de</strong>r Disziplin gelesen wer<strong>de</strong>n, mit <strong>de</strong>m sich das Leitbild<br />
293 Ein weiterer Legitimationsstrang besteht in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r klassischen KI, die darauf zielt die Maschinen<br />
menschlich, lebendig bzw. intelligent zu machen. Dazu wird neuerdings über die oben beschriebenen<br />
Embodimentkonzepte hinaus auf kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse rekurriert, die darauf<br />
verweisen, dass Emotionen eine wesentliche Rolle bei Entscheidungen, beim Lernen und weiteren<br />
kognitiven Prozessen spielen; vgl. etwa Damasio 1994. Intelligenz wird damit nicht mehr ausschließlich<br />
rational gefasst, son<strong>de</strong>rn mit Rückgriff auf Körper und Gefühle. Die Wahrnehmung <strong>de</strong>r sozialen Umgebung<br />
durch das Artefakt sowie seine Anpassungsfähigkeit daran – sei es als „sozial angemessene“ Reaktion<br />
o<strong>de</strong>r in Form <strong>de</strong>s (Maschinen-)Lernens - wird zum wesentlichen Faktor <strong>de</strong>r technischen Konzeption.<br />
Interaktion im Sinne <strong>einer</strong> ständigen Kommunikation mit <strong>de</strong>r (technischen, physischen o<strong>de</strong>r menschlichen)<br />
Umwelt gilt nun als notwendige Voraussetzung <strong>de</strong>r sozialen und emotionalen Intelligenz von Maschinen;<br />
vgl. hierzu auch Stein 1999.<br />
208
„Interaktion“ gegenüber Konzepten <strong>de</strong>r Algorithmisierung und Automatisierung<br />
durchsetzt (vgl. Wegner 1997). Während frühe Ansätze <strong>de</strong>r Informatik darauf zielten,<br />
formal strukturierte und rational-kognitive Prozesse zu mo<strong>de</strong>llieren, gerät nun auch die<br />
Mensch-Maschine-Kommunikation stärker in <strong>de</strong>n Blick. In <strong>de</strong>m Trend, die Maschine an<br />
die NutzerInnen anzupassen, wer<strong>de</strong>n Emotionen als zentraler Faktor angesehen.<br />
Die MIT-Forscherin Rosalind Picard rief bereits 1997 das ebenso visionäre wie<br />
provokative Programm <strong>de</strong>s „Affective Computing“ aus (Picard 1997). Dieses fokussiert<br />
jedoch stärker auf die maschinelle Erkennung von Emotionen als auf die technische<br />
Nachbildung emotionaler Prozesse bei Menschen (Trappl et al. 2002, Breazeal 2002,<br />
Paiva 2000, Minsky 2006), die im Folgen<strong>de</strong>n genauer betrachtet wer<strong>de</strong>n soll. Um <strong>einer</strong><br />
Maschine (z.B. einem Software- o<strong>de</strong>r Interfaceagenten) künstliche Gefühle verleihen<br />
zu können, ist das Emotionale auf drei Ebenen explizit zu mo<strong>de</strong>llieren: Es muss<br />
festgelegt wer<strong>de</strong>n, was Emotionen sind (statisches Mo<strong>de</strong>ll), wie sie entstehen und sich<br />
verän<strong>de</strong>rn (dynamisches Mo<strong>de</strong>ll), aber auch wie die Maschine ihre Emotionen nach<br />
außen hin „zeigt“ (Repräsentationsmo<strong>de</strong>ll). Für die Definition von Emotionen greifen<br />
die Forschen<strong>de</strong>n häufig auf 5-, 6- o<strong>de</strong>r 8-Faktoren-Mo<strong>de</strong>lle zurück. 294 Sie scheinen<br />
weniger an innerwissenschaftlichen Debatten <strong>de</strong>r Psychologie interessiert, wie sich<br />
Emotionen fassen lassen, als an <strong>de</strong>r Reduktion von Komplexität, die für die technische<br />
Reproduktion von Emotionen erfor<strong>de</strong>rlich ist. Ein zweiter Baustein bei <strong>de</strong>r Herstellung<br />
künstlicher Emotionen besteht in <strong>de</strong>r formalen Beschreibung, wie Emotionen bei<br />
Menschen entstehen und auch wie<strong>de</strong>r „abklingen“. Dabei nehmen die SoftwareagentenforscherInnen<br />
zumeist auf die Konzepte <strong>de</strong>r ebenfalls kognitionswissenschaftlich<br />
geprägten Einschätzungstheorien Bezug, <strong>de</strong>nen zufolge Emotionen primär<br />
aufgrund <strong>de</strong>r positiven o<strong>de</strong>r negativen Einschätzung <strong>de</strong>r Situation und Umgebung <strong>einer</strong><br />
Person hervorgerufen wer<strong>de</strong>n (siehe Ortony et al. 1988). Eine menschliche o<strong>de</strong>r<br />
technische AgentIn könne sich über die Folgen eines Ereignisses freuen o<strong>de</strong>r nicht, die<br />
eigenen Handlungen o<strong>de</strong>r die an<strong>de</strong>rer befürworten o<strong>de</strong>r ablehnen und Aspekte eines<br />
Objektes mögen o<strong>de</strong>r nicht. Dabei wür<strong>de</strong>n Ereignisse anhand zuvor festgelegter Ziele<br />
bewertet, Handlungen anhand von Normen und Objekte mittels Geschmack bzw.<br />
Einstellungen eingeschätzt (vgl. Rübenstrunk 1998, Ortony 2002, 195). Wird darüber<br />
hinaus noch ein Schwellenwert festgelegt, ab <strong>de</strong>m eine Emotion „subjektiv empfun<strong>de</strong>n“<br />
wer<strong>de</strong>n kann, so lässt sich das Entstehen und Vergehen von Emotionen in <strong>einer</strong><br />
formalen Sprache beschreiben und für einen konkreten Fall dynamisch berechnen. Die<br />
auf diese Weise erzeugten künstlichen Emotionen sind nun in Form innerer Zustän<strong>de</strong><br />
kodiert. Um sie <strong>de</strong>r technowissenschaftlichen Logik folgend zum Funktionieren zu<br />
bringen, müssen sie in einem dritten Schritt nach außen hin sichtbar gemacht wer<strong>de</strong>n.<br />
Je nach Emotion kann dies durch sprachliche Äußerungen (z.B. Konversationsinhalt,<br />
Wortwahl, Dialogstrategie o<strong>de</strong>r Intonation) bzw. eher körpersprachlich (z.B. durch Gesichtsausdruck,<br />
Gesten, Körperspannung, Bewegung und Pose) erfolgen. Ein in <strong>de</strong>r<br />
Softwareagentenforschung weit verbreiteter Ansatz 295 setzt beispielsweise das Mo<strong>de</strong>ll<br />
<strong>de</strong>r sechs Basisemotionen in eine feststehen<strong>de</strong> Relation zu bestimmten<br />
Gesichtsausdrücken, wobei auch „Mischungen“ von Emotionen durch Interpolation <strong>de</strong>r<br />
294 Z.B. die sechs Basisemotionen „Angst, Ärger, Freu<strong>de</strong>, Traurigkeit, Verachtung und Überraschung“; vgl.<br />
Ekman 1982. Darüber hinaus führte Tomkins 1962 auch Interesse und Scham an.<br />
295 Dieser Ansatz wird als Emotion Facial Action Coding System (EMFACS) bezeichnet, vgl. etwa Ekman/<br />
Friesen 1977.<br />
209
grafisch-mimischen Darstellung berechnet wer<strong>de</strong>n können. Wie die drei Ebenen<br />
künstlicher Emotionalität – das statische Mo<strong>de</strong>ll (Definition von Emotionen), das dynamische<br />
Mo<strong>de</strong>ll (Entstehen und Abklingen von Emotionen) sowie das Repräsentationsmo<strong>de</strong>ll<br />
(konkrete Äußerungsform) – konkret zusammenspielen, wird durch die Architektur<br />
<strong>de</strong>r SoftwareagentIn geregelt.<br />
Diese grobe Charakterisierung <strong>de</strong>s technowissenschaftlichen Zugriffs auf<br />
Emotionen ver<strong>de</strong>utlicht, dass Emotionen in <strong>de</strong>r Softwareagentenforschung als ein integraler<br />
Bestandteil kognitiver Prozesse verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. 296 Sie wer<strong>de</strong>n also nicht nur<br />
als eine Zusatzfunktion neben rationalen Entscheidungsprozessen begriffen, son<strong>de</strong>rn<br />
sind als ein relevantes Modul <strong>de</strong>s Kontrollsystems von Softwareagenten implementiert.<br />
Damit scheint zwar die traditionelle Dichotomie von Gefühl und Vernunft weitgehend<br />
aufgelöst. Jedoch geht dieser Grenzaufweichung eine fundamentale Neu-Definition<br />
von Emotionen voraus. Emotionen wer<strong>de</strong>n hier nicht mehr – wie von Feministinnen<br />
ehemals kritisiert – als unkontrollierte Natur verstan<strong>de</strong>n, die aus <strong>de</strong>m Körper ungebändigt<br />
hervorbrechen und nach Möglichkeit gezähmt wer<strong>de</strong>n müssen. Ebenso wenig<br />
wer<strong>de</strong>n sie als Gegensatz von Rationalität, Vernunft und Denken konzeptualisiert o<strong>de</strong>r<br />
in direkter Weise mit Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Das grob skizzierte Emotionsverständnis<br />
<strong>de</strong>r Softwareagentenforschung <strong>de</strong>utet vielmehr darauf hin, dass<br />
Emotionen gegenwärtig eine völlig neue Be<strong>de</strong>utung erhalten und nun im Sinne von<br />
Informationsflüssen aufgefasst wer<strong>de</strong>n (Bath 2010).<br />
Diese Re-Definition von Gefühl in Emotion basiert, wie ich in Bath (2010) ausführlich<br />
dargelegt habe, auf drei grundlegen<strong>de</strong>n Annahmen: 1. gelten Emotionen als i<strong>de</strong>ntifizierbare,<br />
klar voneinan<strong>de</strong>r unterscheidbare innere Zustän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s (menschlichen bzw.<br />
technischen) Agenten, die 2. ein<strong>de</strong>utig nach außen hin dargestellt wer<strong>de</strong>n können und<br />
damit durch einen individuellen Körper bzw. Geist eingeschlossen sind, <strong>de</strong>r als dynamisches<br />
Mo<strong>de</strong>ll konzipiert ist. 3. wer<strong>de</strong>n Emotionen als kulturell und zeithistorisch unabhängig<br />
angenommen, d.h. zumeist essentialistisch konzipiert. 297 Auf dieser Basis<br />
können Emotionen als Information begriffen wer<strong>de</strong>n.<br />
Dieses kognitionswissenschaftliche Verständnis überwin<strong>de</strong>t somit zwar insgesamt<br />
die Dichotomie von Gefühl und Verstand, die in westlichen Denktraditionen zutiefst<br />
vergeschlechtlicht ist. Der Preis dafür ist jedoch, das Emotionen in <strong>einer</strong> objektivistischen<br />
Weise re-<strong>de</strong>finiert wer<strong>de</strong>n, die vorherrschen<strong>de</strong> geschlechtsbela<strong>de</strong>ne Muster wie<br />
die hierarchische Subjekt-Objekt-Relation, <strong>de</strong>n Dualismus von privat und öffentlich<br />
o<strong>de</strong>r Universalismen, die einen weißen, heterosexuellen Mittelstandsmann implizit als<br />
I<strong>de</strong>al wissenschaftlicher Theorien voraussetzen, aufrechterhält und reaktiviert. 298 So<br />
wer<strong>de</strong>n Emotionen etwa innerhalb <strong>de</strong>s Körpers lokalisiert und gelten – im Gegensatz<br />
zu konstruktivistischen Auffassungen – als innerliche, privat-individuelle Prozesse (vgl.<br />
Bath 2010). Damit erscheint <strong>de</strong>r zunächst viel versprechen<strong>de</strong> Ansatz, <strong>de</strong>n technischen<br />
Objekten Emotionen einzuschreiben, aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive ebenso<br />
ernüchternd wie <strong>de</strong>r technowissenschaftliche Zugriff auf Verkörperungen im Feld <strong>de</strong>r<br />
Robotik.<br />
296 Marvin Minsky bringt das auf <strong>de</strong>n Punkt: „Emotions are different Ways to Think“ (Minsky 2006, 7).<br />
297 Vgl. hierzu auch die auf das „Affective Computing“-Programm fokussierte Analyse Suchmans<br />
(Suchman 2007, 232f).‘.<br />
298 Vgl. hierzu ausführlicher Bath 2010.<br />
210
Es wür<strong>de</strong> hier jedoch zu kurz greifen, die feministische Kritik auf diese Argumente<br />
zu beschränken. Denn <strong>de</strong>r kognitionswissenschaftliche Ansatz ist zwar <strong>de</strong>r <strong>de</strong>rzeit im<br />
Bereich <strong>de</strong>r emotionalen Softwareagenten und Interfaces dominante, jedoch kursieren<br />
dort noch weitere Zugänge, die sich von <strong>de</strong>m skizzierten grundlegend unterschei<strong>de</strong>n.<br />
So führt ein an<strong>de</strong>rer Ansatz Emotionen und Sozialität auf evolutionsbiologische<br />
Erklärungsmo<strong>de</strong>lle zurück, <strong>de</strong>nen entsprechend die Artefakte nachgebaut wer<strong>de</strong>n und<br />
dabei im Laufe ihrer Entwicklung lernen sollen (vgl. Minsky 2006). Dieser Zugriff kann<br />
als Re-Naturalisierung grundlegend kritisiert wer<strong>de</strong>n, wie Jutta Weber am Beispiel <strong>de</strong>r<br />
Robotik und <strong>de</strong>ren Anspruch auf Verkörperung vorgeführt hat. Statt diese Argumentationslinien<br />
auf Emotionen zu übertragen, aber letztendlich zu wie<strong>de</strong>rholen, möchte ich<br />
hier auf einen weiteren Ansatz hinweisen, <strong>de</strong>r die skizzierten Kritiken ergänzt und in<br />
einen allgem<strong>einer</strong>en Rahmen stellt.<br />
Suchman sieht in <strong>de</strong>m übergreifen<strong>de</strong>n Projekt <strong>de</strong>r menschenähnlichen Maschine,<br />
die verkörpert und emotional konzipiert wird, ein Fetischobjekt <strong>de</strong>r TechnologiegestalterInnen,<br />
in <strong>de</strong>m sich <strong>de</strong>ren Selbstverständnisse wi<strong>de</strong>rspiegeln: „More generally, the<br />
‚humanness‘ assumed in discussions of the potential success (or the inevitable failure)<br />
of attempts to replicate the human mechanically is typically a fetishised humanness,<br />
stripped of ist contingenciey, locatedness, historicity and particular embodiment. As<br />
comparably fetishised objects, machines can be fantasized as progressively more<br />
i<strong>de</strong>ntical to their human creators.“ (Suchman 2002b, o.S.). Die Künstliche Intelligenzforschung<br />
teilten mit <strong>de</strong>r Anthropologie zwar die Ablehnung eines materiellen<br />
Essentialismus, da Silizium als austauschbare Alternative zu Blut und Fleisch gesehen<br />
wer<strong>de</strong>. Die Zuschreibung eines sozialen Status, von „enchantment“ und religiöser<br />
Effizienz hinge bei bei<strong>de</strong>n nicht von davon ab, was ein Ding (o<strong>de</strong>r eine Person) „ist“.<br />
Ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Unterschied bestehe allerdings in <strong>de</strong>r radikalen Relationalität <strong>de</strong>r<br />
anthropologischen Ansätze. Die KI-Diskurse dagegen ersetzten gera<strong>de</strong> nicht die<br />
individuelle Konzeption von Handlungsfähigkeit durch eine relationale bzw. soziale,<br />
son<strong>de</strong>rn die biologische durch eine computerbasierte (vgl. Suchman 2007, 239f).<br />
Nach diesen ernüchtern<strong>de</strong>n Analysen möchte ich abschließend auf einen weiteren<br />
Strang von Forschungen über Emotionen in <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Interaktion<br />
aufmerksam machen, <strong>de</strong>r auf an<strong>de</strong>ren Grundlagen als <strong>de</strong>n bisher kritisierten Grundlagen<br />
basiert und <strong>de</strong>shalb aus <strong>einer</strong> wissenschaftstheoretisch-<strong>kritisch</strong>en und feministischen<br />
Perspektive interessant erscheint. „Design for Experience“ ist ein aktueller Trend<br />
in <strong>de</strong>r HCI, <strong>de</strong>r auf die NutzerInnen und ihre subjektiven Erfahrungen zielt (vgl.<br />
Sengers et al. 2002, Sengers 2003, Sengers et al. 2004, Blythe et al. 2003, McCarthy/<br />
Wright 2004). 299 Es geht darum, die Systeme so zu gestalten, dass NutzerInnen in die<br />
Interaktion mit <strong>de</strong>r Maschine quasi hineingezogen wer<strong>de</strong>n. Dabei kommen Emotionen<br />
an<strong>de</strong>re Weise als bisher betrachtet ins Spiel. Statt sie <strong>de</strong>r Maschine einzuschreiben,<br />
wird nun angestrebt, dass die technische Gestaltung <strong>de</strong>r Interaktion vielfältige emotionale<br />
Reaktionen hervorzurufen vermag bzw. ermöglicht. Waren traditionelle Softwareprodukte<br />
primär darauf ausgerichtet, die NutzerInnen effizient und effektiv bei <strong>de</strong>r<br />
Lösung konkreter Arbeitsaufgaben zu unterstützen, so soll <strong>de</strong>r Umgang mit <strong>de</strong>n neuen<br />
Systemen vor allem Spaß machen, motivieren und zugleich nützlich sein. Der neue<br />
299 Vgl. hierzu auch Kapitel 5.5, wo dieser Ansatz als Technoikgestaltungsmetho<strong>de</strong> für ein De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte diskutiert wird, während er hier als ein Beispiel dient, wie auf Emotionen Bezug<br />
genommen wer<strong>de</strong>n kann, ohne die Dichotomie von Gefühl und Vernunft erneut zu bestätigen.<br />
211
Ansatz wen<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>zidiert gegen herkömmliche Verständnisse von Softwareentwicklung,<br />
Ergonomie/Usability und Objektivität. Darüber hinaus stellt er <strong>de</strong>m<br />
kognitionswissenschaftlichen Konzept von „Emotion als Information“ und <strong>de</strong>m diesen<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n simplen Sen<strong>de</strong>r-Empfänger-Mo<strong>de</strong>ll ein konstruktivistisches Verständnis<br />
entgegen. Die Erfahrungen (und Emotionen) <strong>de</strong>r NutzerInnen wer<strong>de</strong>n nicht als<br />
Eigenschaft <strong>de</strong>s Systems betrachtet, son<strong>de</strong>rn vielmehr als etwas, das während <strong>de</strong>r<br />
Interaktion mit <strong>de</strong>r Maschine entsteht. „Rather than experience as something to be<br />
poured out into passive users, we argue that users actively and individually construct<br />
human experiences around technology. They do so through a complex process of<br />
interpretation, in which users make sense of the system in the full context of their<br />
everyday experience.“ (Sengers et al. 2004: 1, Hervorhebung im Orig.). Eine solche<br />
Verschiebung erfor<strong>de</strong>rt zugleich eine neue Sichtweise <strong>de</strong>ssen, wie Emotionen<br />
kommuniziert wer<strong>de</strong>n können. Während das Konzept „Emotion als Information“ auf<br />
einem Kommunikationsmo<strong>de</strong>ll basiert, bei <strong>de</strong>m das Individuum intern eine Nachricht<br />
erstellt und diese über einen störempfindlichen Kanal an die EmpfängerIn übermittelt,<br />
300 grün<strong>de</strong>t „Design for Experience“ auf <strong>de</strong>r Vorstellung, dass Be<strong>de</strong>utung<br />
zwischen NutzerIn und System ko-konstruiert wird. Be<strong>de</strong>utung wür<strong>de</strong> nicht zwischen<br />
Individuen transferiert. Vielmehr konstruierten menschliche wie nicht-menschliche<br />
Akteure diese aktiv und gemeinsam. Dementsprechend wird die Kommunikation von<br />
Emotionen nicht wie <strong>de</strong>r kognitionswissenschaftlichen Auffassung nach als eine<br />
Übertragung diskreter Zustän<strong>de</strong> von einem Sen<strong>de</strong>r zu einem Empfänger verstan<strong>de</strong>n,<br />
son<strong>de</strong>rn vielmehr als ein Prozess, durch <strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utung koordiniert, ausgehan<strong>de</strong>lt und<br />
damit unter <strong>de</strong>n Beteiligten hergestellt wird.<br />
Mit <strong>einer</strong> <strong>de</strong>zidierten Verortung innerhalb <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en, partizipativen<br />
Technikgestaltung positioniert sich „Design for Experience“ in Abgrenzung zur „I-methodology“,<br />
die von feministischen TechnikforscherInnen wie Rommes (2002) kritisiert<br />
wur<strong>de</strong> (vgl. hierzu auch Kapitel 4.1.4). Statt auf objektivistische Verfahren fokussiert<br />
<strong>de</strong>r Ansatz auf subjektive Nutzungserfahrungen mit Hilfe explorativer und qualitativer<br />
Metho<strong>de</strong>n. Ausgehend von <strong>de</strong>m theoretischen Rahmen, <strong>de</strong>r im Kapitel 3 entwickelt<br />
wur<strong>de</strong>, sind bei<strong>de</strong>s notwendige Voraussetzungen eines feministischen Technikgestaltungsansatzes<br />
in diesem Bereich. Darüber hinaus wirken die ontologisch-epistemologischen<br />
Annahmen <strong>de</strong>s „Design for Experience“ <strong>de</strong>r im Feld <strong>de</strong>r emotionalen<br />
Softwareagentenforschung weit verbreiteten Ten<strong>de</strong>nz zur Essentialisierung entgegen.<br />
Der epistemologische Pluralismus und die konstruktivistische Perspektive weisen über<br />
die konkrete Konzeptualisierung von Emotionen hinaus. Denn sobald Emotionen nicht<br />
nur als in einem Individuum körperlich verankerte, innerliche Informationsflüsse<br />
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die in vor<strong>de</strong>finierter, regelbasierter Weise mit rationalen Prozessen<br />
interagieren, eröffnet dies in einem Feld, in <strong>de</strong>m geschlechtliche Positionierung i.d.R.<br />
dichotom als Frau o<strong>de</strong>r Mann interpretiert wird, die Denkmöglichkeit, auch an<strong>de</strong>re<br />
vermeintlich körperlich <strong>de</strong>termininierte Eigenschaften als eine soziale Konstruktion zu<br />
begreifen.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re rückt <strong>de</strong>r neue Ansatz von <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r KI vorherrschen<strong>de</strong>n I<strong>de</strong>e ab,<br />
dass die bestmögliche Mo<strong>de</strong>llierung „virtueller Menschen“ durch eine „naturgetreue“<br />
300 Dies ist ein Verständnis, das im Wesentlichen auf die Informationstheorie von Shannon und Weavers<br />
(1963) zurückgeht.<br />
212
Nachbildung menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten zu erreichen wäre. Dieser<br />
Schritt erscheint aus <strong>einer</strong> gesellschaftstheoretischen, feministischen Perspektive als<br />
entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r. Denn <strong>de</strong>r Zwang zur Wie<strong>de</strong>rholung <strong>de</strong>s Bestehen<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n sich die<br />
ForscherInnen <strong>de</strong>s betrachteten Fel<strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>r Abbildi<strong>de</strong>e selbst auferlegt haben und<br />
<strong>de</strong>r oft zu stereotypen Reduktionen gesellschaftlicher Realität führt, könnte auf diese<br />
Weise durchbrochen wer<strong>de</strong>n. Eine solche Überwindung <strong>de</strong>r kognitionswissenschaftlich-positivistischen<br />
KI ist eine notwendige Bedingung feministischer Technikgestaltung,<br />
die das Ziel verfolgt, Verschiebungen in <strong>de</strong>n Festschreibungen von heteronormativer<br />
Zweigeschlechtlichkeit o<strong>de</strong>r gar Unterbrechungen in <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>rholungen von<br />
(Geschlechter-)Normen mittels Technologien zu verursachen.<br />
Der Ansatz <strong>de</strong>s „Design for experience“ versteht sich zwar, wie in Bath 2010<br />
bemerkt, nicht per se als feministisch. Im Kontext <strong>de</strong>r Diskussion um geschlechtsbela<strong>de</strong>ne<br />
Dichotomien, auf <strong>de</strong>nen die Formalisierungen, Abstraktionen <strong>de</strong>r Informatik häufig<br />
beruhen, erweist er sich jedoch als eine feministische Alternative. „Design for experience“<br />
ist ein Technikgestaltungsansatz, <strong>de</strong>r keine analytische Dekonstruktion <strong>de</strong>r<br />
Dichotomie von Gefühl und Vernunft mehr erfor<strong>de</strong>rt, son<strong>de</strong>rn diese bereits voraussetzt.<br />
Er gibt damit für <strong>de</strong>n in diesem Kapitel 4.3 betrachteten Bereich <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik<br />
und -epistemologie <strong>informatischer</strong> Artefakte eine Richtung an, wie sich einzelnen <strong>de</strong>r<br />
i<strong>de</strong>ntifizierten Gen<strong>de</strong>ringprozesse insgesamt begegnen lässt. Denn er räumt genau<br />
diejenigen Wi<strong>de</strong>rstän<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Weg, die eine <strong>kritisch</strong>e, feministische Gestaltung von<br />
Technologien sowohl methodologisch wie ontologisch und epistemologisch behin<strong>de</strong>rt<br />
haben und kann <strong>de</strong>shalb als <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r Ausgangspunkte für ein De-Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Technologien betrachtet wer<strong>de</strong>n, die im nächsten Kapitel 5 diskutiert wer<strong>de</strong>n.<br />
4.4. Resümee: Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
In diesem Kapitel wur<strong>de</strong> eine Systematisierung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
entwickelt, d.h. es wur<strong>de</strong>n Dimensionen und Mechanismen herausgearbeitet, wie<br />
Produkte, Theorien, Metho<strong>de</strong>n und Annahmen <strong>de</strong>r Informatik vergeschlechtlicht sein<br />
können. Anhand von Fallstudien, die in <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten zu dieser Fragestellung<br />
veröffentlicht wur<strong>de</strong>n, sind drei Dimensionen i<strong>de</strong>ntifiziert wor<strong>de</strong>n: Eine Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte kann 1. durch sozial-strukturelle Ausschlüsse<br />
von <strong>de</strong>r Nutzung produziert sein, die sich auf Annahmen und Problem<strong>de</strong>finitionen, die<br />
<strong>einer</strong> Technologie zugrun<strong>de</strong> liegen, zurück führen lassen. Dies ließ sich insbeson<strong>de</strong>re<br />
anhand intelligenter Häuser nachweisen, die an <strong>de</strong>r Zielgruppe technikfaszinierter<br />
BewohnerInnen ausgerichtet waren und Hausarbeit ignorierten, aber auch bei so<br />
genannten „digitalen Städten“ beobachten, die explizit mit <strong>de</strong>m Ziel <strong>de</strong>s „<strong>de</strong>sign for all“<br />
angetreten sind. Eine weitere Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung fand sich 2. in <strong>de</strong>n<br />
Festschreibungen geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung und Stereotype durch IT,<br />
die durch unreflektierte Geschlechtervorstellungen über Frauen und Männer entstehen.<br />
So führte etwa das Bild technisch inkompetenter Sekretärinnen zu einem Textverarbeitungsprogramm,<br />
das zwar je<strong>de</strong> <strong>de</strong>nkbare Fehlbedienung verhin<strong>de</strong>rt, aber <strong>de</strong>n<br />
Schreibprozess extrem verlangsamt. Auch die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung<br />
spiegelt sich in <strong>de</strong>n Systemen, in<strong>de</strong>m bestimmte Machtverhältnisse am Arbeits-<br />
213
platz ebenso ignoriert wer<strong>de</strong>n wie „unsichtbare Arbeit“, die häufig Teil <strong>de</strong>r Arbeit von<br />
Frauen ist. Wer<strong>de</strong>n diese Tätigkeiten jedoch nicht mo<strong>de</strong>lliert, so können sie auch nicht<br />
durch Technologien unterstützt o<strong>de</strong>r automatisiert wer<strong>de</strong>n. Eine weitere Variante <strong>de</strong>r<br />
Festschreibung von Geschlechtervorstellungen in <strong>de</strong>r Software fin<strong>de</strong>t sich bei Avataren,<br />
Computerspielfiguren und anthropomorphen Softwareagenten, die häufig ein<br />
stereotyp zugespitztes Aussehen und Verhalten von Frauen bzw. Männern verkörpern.<br />
Sämtliche dieser Artefakte wirken mit an <strong>de</strong>r Reproduktion <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n strukturellsymbolischen<br />
Geschlechterordnung. Eine 3. Dimension <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Tätigkeiten <strong>de</strong>r Klassifizierung, Abstraktion und<br />
Formalisierung verortet, durch die eine Abwesenheit von Geschlechterverhältnissen<br />
suggeriert und damit von <strong>de</strong>r (Geschlechter-)Politik und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen<br />
abgelenkt wird. Diese Dimension bezieht sich stärker auf die Grundannahmen <strong>de</strong>r<br />
Technologiegestaltung sowie auf wissenschaftstheoretische Annahmen und die Grundlagenforschung<br />
<strong>de</strong>r Informatik. Beispiele sind hier Algorithmen und Formalismen, die<br />
im Gebrauch Geschlechterdifferenzen erzeugen, wie etwa solche zur Bil<strong>de</strong>rzeugung<br />
aus computertomografischen Daten, o<strong>de</strong>r Kategorien und Klassifikationen, die mit <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterordnung korrelieren und jene während <strong>de</strong>r Nutzung von Technologien<br />
erneut hervorbringen. Ferner wur<strong>de</strong> aufgezeigt, dass Repräsentationen von Wissen im<br />
Wissensmanagement, in Wikis o<strong>de</strong>r Ontologien häufig implizit von einem als Mann,<br />
weiß, gebil<strong>de</strong>t, europäisch vorgestellten Subjekt <strong>de</strong>s Wissens ausgehen und damit<br />
ebenso wie die in <strong>de</strong>r Softwareentwicklung vorherrschen<strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>llierungsmetho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Objektorientierung auf <strong>einer</strong> cartesianischen Epistemologie beruhen. Dabei ist letztere<br />
ausschließlich in <strong>de</strong>r Lage, Hierarchien zu formalisieren, während sie soziale Prozesse<br />
nicht zu erfassen vermag. Deutlicher wur<strong>de</strong> die Ignoranz, Ausgrenzung und Abwertung<br />
von Bereichen menschlichen Han<strong>de</strong>lns, die traditionell <strong>de</strong>m „Weiblichen“ zugeschrieben<br />
sind (wie bspw. das Körperliche, Soziale, Emotionale), anhand von Dichotomien,<br />
auf <strong>de</strong>nen die Konzepte <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung grün<strong>de</strong>ten und grün<strong>de</strong>n.<br />
Die drei, anhand von Fallstudien veranschaulichten Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte wur<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Erkenntnisse von<br />
Kapitel 3 neu gelesen, um sie in <strong>de</strong>n Theorierahmen dieser Arbeit einordnen zu<br />
können. Dabei wur<strong>de</strong>n einige <strong>de</strong>r rezipierten Untersuchungen im Sinne Suchmans<br />
Konzept <strong>de</strong>r „accountable cuts“ re-interpretiert.<br />
Die <strong>de</strong>taillierte Analyse ermöglichte zugleich, einige grundlegen<strong>de</strong> Ursachen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte zu i<strong>de</strong>ntifizieren, die für die Informatik wesentlich<br />
sind.<br />
Dimensionen <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung<br />
Sozial strukturierte<br />
Ausschlüsse von <strong>de</strong>r<br />
Nutzung von Technologien<br />
Festschreibung<br />
geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung und<br />
Stereotype durch IT<br />
(Computerspiele)<br />
„intelligente“ Häuser<br />
Digitale Städte<br />
Beispiele Mechanismen <strong>de</strong>r<br />
Vergeschlechtlichung<br />
Frühe Textverarbeitung<br />
Krankenhausinformationssysteme<br />
Callcenter<br />
Avatare, Computerspielfiguren und<br />
anthropomorphe Softwareagenten<br />
214<br />
„I-methodology“<br />
Implizite und explizite<br />
Geschlechterannahmen,<br />
Ignoranz <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterpolitik im<br />
Anwendungsbereich
Geschlechterpolitik und<br />
Epistemologie <strong>de</strong>s<br />
Formalen<br />
Algorithmen (Bil<strong>de</strong>rzeugung<br />
Computertomografie)<br />
Kategorien/Klassifikationen<br />
Wissensordnungen<br />
(Medizininformationssystem)<br />
Mo<strong>de</strong>llierungsparadigma (OO)<br />
Dichotomien (Design/ Nutzung, Körper/<br />
Geist und Rationalität/ Emotionalität)<br />
215<br />
Dekontextualisierung,<br />
fragwürdige ontologische<br />
Grundannahmen,<br />
epistemologische<br />
Grundannahmen/<br />
traditionelles<br />
Objektivitätsverständnis<br />
So konnten Praktiken <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung auf die folgen<strong>de</strong>n drei Ursachen und<br />
Mechanismen zurückgeführt wer<strong>de</strong>n, die sich jedoch nicht gegenseitig ausschließen:<br />
1. die „I-methodology“, nach <strong>de</strong>r die TechnikgestalterInnen implizit annehmen, dass die<br />
NutzerInnen <strong>de</strong>r zukünftigen zu entwickeln<strong>de</strong>n Technologie ähnliche Präferenzen und<br />
Wünsche haben wie sie selbst.<br />
2. Implizite und explizite Annahmen über Frauen und Männer, Weiblichkeit und<br />
Männlichkeit, die sich in Vorstellungen von <strong>de</strong>n NutzerInnen (etwa hinsichtlich ihrer<br />
Kompetenzen, dargestellten Körperbil<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r Verhaltenszuschreibungen) manifestieren.<br />
Dazu gehören auch Einschreibungen <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung in Softwaresysteme durch Problem<strong>de</strong>finitionen und Mo<strong>de</strong>llierungen,<br />
die insbeson<strong>de</strong>re als „weiblich“ konnotierte Tätigkeiten nicht wahrnehmen, sowie<br />
die Ignoranz <strong>de</strong>s Anwendungsbereichs und <strong>de</strong>r dort vorliegen<strong>de</strong>n (Geschlechter-<br />
)Politik, die durch Informatisierung reproduziert wird.<br />
3. die Dekontextualisierung aufgrund von Formalisierung, bei <strong>de</strong>r die Effekte von<br />
Formalismen und Klassifikationen im Gebrauch sowie die damit verbun<strong>de</strong>ne<br />
(Geschlechter-)Politik <strong>de</strong>s Anwendungsbereichs ignoriert wer<strong>de</strong>n. Eine solche .<br />
Abstraktion vom Kontext öffnet die Tür für Einschreibungen von ontologischen<br />
Grundannahmen in die Technologie, die auf <strong>einer</strong> strukturell-symbolischen Ebene<br />
geschlechtlich aufgela<strong>de</strong>n sind (etwa Ausschlüsse, die mit traditionellen Dichotomien<br />
korrelieren). Ferner wer<strong>de</strong>n diese bei<strong>de</strong>n Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
häufig durch epistemologische Grundannahmen (z.B. durch ein Objektivitätsverständnis<br />
auf Grundlage positivistischer Epistemologie) legitimiert und damit<br />
abgesichert.<br />
Mit diesen drei Dimensionen und <strong>de</strong>n damit verbun<strong>de</strong>nen Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte wur<strong>de</strong> eine wesentliche Voraussetzung<br />
feministischer Technologiegestaltung in <strong>de</strong>r Informatik erarbeitet. Denn die Analyse<br />
und Systematisierung hat gezeigt, dass die Suche nach Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung,<br />
die im Vergleich zu <strong>de</strong>n herkömmlichen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Software-<br />
Engineering und an<strong>de</strong>rer Verfahren alternative Wege einschlagen, auszudifferenzieren<br />
sind, um die erkannten Probleme <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung bewusst zu vermei<strong>de</strong>n. Sie<br />
sollten <strong>de</strong>r „I-methodology“, <strong>de</strong>r Einschreibung von impliziten und expliziten<br />
Geschlechterannahmen sowie <strong>de</strong>r Dekontextualisierung, Einschreibung fragwürdiger<br />
ontologischer Annahmen und positivistischen Objektivitätsverständnissen entgegenwirken.<br />
Kapitel 4 liefert damit eine fundierte Grundlage für ein De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte.
216
Kapitel 5<br />
Alternative Technologiegestaltung: Methodische Konzepte für ein De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r letzten bei<strong>de</strong>n Kapitel war es, die Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte genauer zu fassen. Dazu wur<strong>de</strong> zunächst im Kapitel 3 mit<br />
Rückgriff auf Ansätze <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung ein theoretischer<br />
Rahmen entwickelt, wie das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft bzw.<br />
Geschlecht verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n kann, um auf dieser Basis ein Konzept <strong>de</strong>r „Ko-<br />
Materialisierung von Technik und Geschlecht“ vorzustellen, durch das sich die<br />
komplexen sozio-materiell-diskursiven Verwicklungen <strong>de</strong>r Herstellungsprozesse von<br />
Technologien und Geschlecht theoretisch beschreiben lassen. Im Kapitel 4 sind eine<br />
Reihe von Fallstudien <strong>informatischer</strong> Artefakte dargestellt wor<strong>de</strong>n, die anschauliche<br />
Einblicke in die Produktionsweisen von Technologien und Geschlecht gegeben haben.<br />
Die vielfältigen Facetten <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte wur<strong>de</strong>n<br />
entlang von Dimensionen systematisiert, wobei zugleich Mechanismen dieser<br />
Prozesse herausgearbeitet wer<strong>de</strong>n konnten. Gleichzeitig sind diese Ergebnisse mit<br />
<strong>de</strong>n theoretischen Erkenntnissen aus Kapitel 3 teils <strong>kritisch</strong> re-interpretiert gegengelesen<br />
wor<strong>de</strong>n. In diesem Kapitel sollen ausgehend von <strong>de</strong>r vorgestellten differenzierten<br />
Analyse Vorschläge gemacht wer<strong>de</strong>n, wie <strong>de</strong>n i<strong>de</strong>ntifizierten Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
durch geeignete Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung entgegengewirkt wer<strong>de</strong>n<br />
kann.<br />
Eine Schwierigkeit, die Ergebnisse <strong>de</strong>r Analyse aus Kapitel 4 in Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
zu übersetzen, besteht jedoch darin, dass die systematisch herausgearbeiteten<br />
Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring ausschließlich negativ<br />
bestimmen, welche Probleme in <strong>de</strong>n Prozessen und Produkten <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n sollen. Deshalb wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n drei Kategorien – Ausschluss<br />
bestimmter NutzerInnen, Festschreibung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n strukturell-symbolischen<br />
Geschlechterordnung durch Technologien sowie die Geschlechterpolitik und<br />
Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen – zunächst mit Hilfe <strong>de</strong>r Erkenntnisse feministischer<br />
Theorie positive Zielsetzungen alternativer Technologiegestaltung gegenüber gestellt<br />
(Abschnitt 5.1.). Dabei wird sich zeigen, dass die angestrebten Ergebnisse eines De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses auszudifferenzieren sind. Gegen strukturelle Ausschlüsse ist die<br />
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Vielfalt von NutzerInnen im Technikentwicklungsprozess zu<br />
setzen (Abschnitt 5.2.) und gegen die Einschreibung impliziter Geschlechterannahmen<br />
und geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung eine Gestaltung, die Frauen und<br />
Männern gleiche Kompetenzen und Zuständigkeiten zuweist (Abschnitt 5.3.). Im Fall<br />
expliziter Geschlechtseinschreibungen lässt sich das De-Gen<strong>de</strong>ring durch eine<br />
Dekonstruktion <strong>de</strong>s Zweigeschlechtlichkeitssystems erreichen (Abschnitt 5.4.). Formalabstrakte<br />
Artefakte sind dagegen zunächst zu rekontextualisieren, um sie <strong>de</strong>r<br />
Reflektion und Kritik zugänglich zu machen. Ein De-Gen<strong>de</strong>ring auf dieser Ebene sollte<br />
darauf zielen, ontologische Annahmen und Konzepte, die Technologien zugrun<strong>de</strong><br />
liegen, offen zu legen und zu revidieren. Dazu ist es in vielen Fällen zugleich<br />
notwendig, das gängige Verständnis von Objektivität und Neutralität mit Hilfe <strong>einer</strong><br />
konstruktivistischen Epistemologie o<strong>de</strong>r eines epistemologische Pluralismus zu<br />
überwin<strong>de</strong>n. In weiteren Fällen gilt es geschlechtskodierte Dichotomien zu überwin<strong>de</strong>n,<br />
217
sodass zuvor marginalisierte Aspekte menschlichen Han<strong>de</strong>lns ins Zentrum gestellt<br />
wer<strong>de</strong>n (Abschnitt 5.5.).<br />
In diesem Kapitel wer<strong>de</strong>n methodische Konzepte entwickelt, die für die<br />
Verwirklichung dieser vier Gestaltungsziele geeignet erscheinen. Es wird dazu auf die<br />
weitgehend etablierten Vorgehensweisen <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ und <strong>de</strong>n fundierten<br />
Metho<strong>de</strong>nkanon <strong>de</strong>s „Participatory Design“ Bezug zurückgegriffen, aber auch auf<br />
weniger bekannte Techniken aus <strong>de</strong>m Kontext <strong>de</strong>s „Critical Computing“ und <strong>de</strong>r sozial-<br />
und kulturwisssenschaftlichen Technikforschung Bezug genommen. Um das jeweils<br />
angestrebte Gestaltungsziel erreichen zu können, müssen die vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n<br />
zum Teil noch angepasst o<strong>de</strong>r ergänzt wer<strong>de</strong>n. Abschnitt 5.6. fasst die<br />
Potentiale <strong>de</strong>r in diesem Kapitel beschriebenen methodischen Konzepte für ein De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte zusammen und verweist auf bestehen<strong>de</strong><br />
Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate.<br />
5.1. Zielsetzung alternativer Technologiegestaltung: Was soll das Ergebnis<br />
eines De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses sein?<br />
Bevor im Folgen<strong>de</strong>n Vorschläge zur praktischen Umsetzung <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring in<br />
Form von Methodologien und Vorgehensweisen <strong>einer</strong> alternativen Technologiegestaltung<br />
diskutiert wer<strong>de</strong>n können, die <strong>de</strong>n bereits i<strong>de</strong>ntifizierten Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
entgegensetzt sind, gilt es zunächst zu klären, was De-Gen<strong>de</strong>ring im<br />
Kontext von Technologiegestaltung be<strong>de</strong>uten kann. Denn die Dimensionen und<br />
Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte geben zwar an, was<br />
vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n soll, dabei ist jedoch nicht notwendigerweise klar, was – positiv<br />
bestimmt – das Ergebnis eines De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses sein kann. Deshalb soll hier<br />
vorweg eine explizite Klärung <strong>de</strong>r Zielsetzung alternativer Technologiegestaltung aus<br />
<strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Geschlechterforschung vorgenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Ausgangspunkt <strong>de</strong>r Überlegungen sind die in Kapitel 4 systematisch herausgearbeiteten<br />
Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring: 1. <strong>de</strong>r strukturelle Ausschluss<br />
bestimmter Personengruppen, von <strong>de</strong>r Nutzung von Technologien, die zumeist auf die<br />
„I-methodology“ <strong>de</strong>r DesignerInnen zurückgeführt wer<strong>de</strong>n kann, 2. die Digitalisierung<br />
strukturell-symbolischer Ungleichheit, die mit <strong>de</strong>r Einschreibung implizierter o<strong>de</strong>r expliziter<br />
Geschlechterannahmen in die Technologien korreliert sowie 3. die Geschlechter-<br />
Politik und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen, die häufig auf <strong>einer</strong> De-Kontextualisierung<br />
sowie auf fragwürdigen ontologischen wie epistemologischen Annahmen grün<strong>de</strong>t.<br />
Wer<strong>de</strong>n diese Kategorien mit <strong>de</strong>n drei Hauptsträngen feministischer Theorie und Politik<br />
– Differenz, Gleichheit, De-/Konstruktion von Geschlecht – gegengelesen und um eine<br />
wissenschaftstheoretische Komponente – die Objektivitätskritik – ergänzt, so ergeben<br />
sich starke Korrelationen. Denn Ausschlüsse bestimmter NutzerInnen zu vermei<strong>de</strong>n,<br />
heißt vielfältige Differenzen in ihren Inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nzen (u.a. Geschlecht, Sexualität,<br />
Klasse, race, Ethnizität, Befähigung, Verortung, Alter) anzuerkennen und im Design zu<br />
berücksichtigen. Gilt es dagegen implizite Einschreibungen <strong>de</strong>r Geschlechterordnung<br />
zu verhin<strong>de</strong>rn, die durch Ignoranz und Ausblendung „<strong>de</strong>s An<strong>de</strong>ren“ zustan<strong>de</strong> kommen,<br />
so muss ein Gleichheitsanspruch durchgesetzt wer<strong>de</strong>n: „Weiblich“ konnotierte Tätigkeiten,<br />
Kompetenzen und Eigenschaften sollen bei <strong>de</strong>r Technologiegestaltung ebenso<br />
218
Berücksichtigung fin<strong>de</strong>n und technisch unterstützt wer<strong>de</strong>n wie die vorherrschend <strong>de</strong>r<br />
„vermännlichten“ Sphäre zugewiesenen. Auch <strong>de</strong>r zweiten Form <strong>de</strong>r impliziten<br />
Einschreibung <strong>de</strong>r Geschlechterordnung, die auf <strong>de</strong>r Ignoranz <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik<br />
im Anwendungsfelds beruht und dazu führt, dass geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilungen<br />
in <strong>de</strong>n Technologien fest- und fortgeschrieben wer<strong>de</strong>n, ist das Ziel <strong>de</strong>r<br />
Gleichheit zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n dominanten Genusgruppen, in diesem Fall die gleiche<br />
Verteilung von Tätigkeiten auf Frauen und Männer, entgegenzusetzen. Demgegenüber<br />
erfor<strong>de</strong>rn explizite Geschlechtseinschreibungen in Form von stereotypen Körperbil<strong>de</strong>r<br />
und Verhaltensnormen eine Strategie <strong>de</strong>r De-Konstruktion von Geschlecht, die <strong>de</strong>n<br />
sozialen Konstruktionscharakter <strong>de</strong>r Kategorie Geschlecht ver<strong>de</strong>utlicht o<strong>de</strong>r stärker<br />
noch das binäre System <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit zu unterminieren vermag. Um<br />
schließlich auch <strong>de</strong>r letzten Dimension <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
– <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik und Epistemologie <strong>de</strong>s Formalen – methodisch<br />
begegnen zu können, lässt sich auf die Debatten feministischer Objektivitätskritik<br />
zurückgreifen. Diese stellen zwar, in<strong>de</strong>m sie ausschließlich Kritik üben an <strong>de</strong>r De-<br />
Kontextualisierung, <strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>ckten fragwürdigen ontologischen Annahmen sowie am<br />
traditionellen Objektivitätsverständnis, keine positive Zielformulierung zur Verfügung.<br />
Jedoch lassen sich diese Kritiken direkt auf die positiven Strategien <strong>de</strong>r Re-<br />
Kontextualisierung sowie <strong>de</strong>r Reflektion und Revision ontologischer Setzungen und<br />
epistemologischer Annahmen wen<strong>de</strong>n. Ferner kann die Strategie, das bisher in <strong>de</strong>r<br />
informatischen Tätigkeit Marginalisierte ins Zentrum zu stellen, dazu beitragen, <strong>de</strong>r<br />
Verfestigung vorherrschen<strong>de</strong>r, vergeschlechtlicher Dichotomien entgegenwirken. Insgesamt<br />
erfor<strong>de</strong>rt insbeson<strong>de</strong>re diese Ebene <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte eine weiter gehen<strong>de</strong> feministische Intervention.<br />
Das theoretische Gedankenspiel, die Ergebnisse aus Kapitel 4 mit <strong>de</strong>n Grundansätzen<br />
feministischer Theorie gegenzulesen, ver<strong>de</strong>utlicht, dass für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r<br />
zweiten herausgearbeiteten Dimension <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte – <strong>de</strong>r technischen Reproduktion strukturell-symbolischer Ungleichheit – zwei<br />
unterschiedliche Prozesse differenziert wer<strong>de</strong>n müssen: implizite und explizite<br />
Geschlechtseinschreibungen. Denn implizite Einschreibungen von Geschlecht sind in<br />
<strong>de</strong>r Regel auf Ausblendungen <strong>de</strong>s als „weiblich“ Konnotierten und <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik<br />
im Anwendungsfeld zurückzuführen, während explizite Einschreibungen darin<br />
bestehen, dass Geschlechtsunterschie<strong>de</strong> in Bezug auf <strong>de</strong>n Körper, Verhaltensweisen<br />
o<strong>de</strong>r Kompetenzen in <strong>de</strong>r Technologie repräsentiert wer<strong>de</strong>n. Im ersten Fall ist im<br />
Ergebnis eine Geschlechtergleichheit anzustreben, im zweiten dagegen die Dekonstruktion<br />
von Geschlecht, die darauf zielt, Geschlechterstereotype zu überwin<strong>de</strong>n,<br />
in<strong>de</strong>m Geschlecht als ein Konstruktionsprozess sichtbar gemacht und das binäre<br />
Zweigeschlechtlichkeitssystem in Frage gestellt wird.<br />
Ebenso wären für die letzte Kategorie – Formalismen, Grundannahmen und Grundlagenforschung<br />
– genau genommen verschie<strong>de</strong>ne Positivstrategien zu formulieren, die<br />
aufgrund <strong>de</strong>s mangeln<strong>de</strong>n Forschungsstands zu Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Gestaltung<br />
hier <strong>de</strong>nnoch zusammengefasst wer<strong>de</strong>n sollen. Damit ergeben sich insgesamt vier<br />
verschie<strong>de</strong>ne De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziele für Technologiegestaltungsprozesse, die <strong>de</strong>n<br />
verbleiben<strong>de</strong>n Teil <strong>de</strong>s Kapitels 5 strukturieren:<br />
219
1. die Berücksichtigung <strong>de</strong>r Diversität <strong>de</strong>r NutzerInnen und ihrer vielfältigen Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
durch Anerkennung von Differenzen und adäquate Problem<strong>de</strong>finitionen<br />
(5.2.)<br />
2. die Sichtbarmachung „unsichtbarer Arbeit“ und die Egalisierung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung durch Ausrichtung <strong>de</strong>s Technikgestaltungsprozesses an<br />
<strong>de</strong>n tatsächlichen NutzerInnen sowie das bewusste Aufbrechen <strong>de</strong>r im Anwendungsfeld<br />
vorfindlichen Macht- und Geschlechterverhältnisse (5.3.)<br />
3. die De-Konstruktion von Geschlecht, etwa dadurch, dass die Aufmerksamkeit auf<br />
<strong>de</strong>n konstruktiven Charakter von Geschlecht gelenkt und eine <strong>kritisch</strong>e Reflektion<br />
<strong>de</strong>s Zweigeschlechtlichkeitssystems evoziert wird (5.4.)<br />
4. die Rekontextualisierung <strong>de</strong>s Formalen durch die Offenlegung, Reflektion und Revision<br />
ontologischer wie epistemologischer Grundannahmen sowie die Dekonstruktion<br />
von Dichotomien durch die Integration <strong>de</strong>s Ausgeschlossenen und die<br />
Invertierung zentraler Konzepte (5.5.).<br />
5.2. „Design for everyone“: Berücksichtigen <strong>de</strong>r Diversität von NutzerInnen<br />
In diesem Abschnitt wer<strong>de</strong>n Strategien und Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring für jene<br />
Klasse von Technologien diskutiert, <strong>de</strong>ren Vergeschlechtlichung aus <strong>de</strong>m im Kapitel 4<br />
beschriebenen Mechanismus <strong>de</strong>r „I-methodology“ resultiert. 301 Bei diesen Technologien<br />
besteht das Problem, wie wir gesehen haben, primär darin, dass sie als<br />
(geschlechts-)neutral angesehen wer<strong>de</strong>n. Die Technologie<strong>de</strong>signerInnen intendieren,<br />
unterschiedlichste NutzerInnen zu adressieren. Die Technologie soll für Je<strong>de</strong> und<br />
Je<strong>de</strong>n zugänglich und nutzbar sein. Tatsächlich wer<strong>de</strong>n jedoch bestimmte NutzerInnengruppen<br />
aufgrund implizit vorausgesetzter Annahmen, die in das Design <strong>de</strong>r<br />
Technologie eingegangen sind, strukturell bevorzugt. Das be<strong>de</strong>utet jedoch, dass<br />
an<strong>de</strong>re strukturell ausgeschlossen wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r einen beson<strong>de</strong>ren Aufwand leisten<br />
müssen, um die jeweilige Technologie für sich sinnvoll einsetzen zu können. Im letzten<br />
Kapitel 4, in <strong>de</strong>m die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte analysiert wor<strong>de</strong>n<br />
ist, wur<strong>de</strong> dieser Effekt darauf zurückgeführt, dass TechnikgestalterInnen ihre eigenen<br />
Vorstellungen, Wünsche und Interessen in <strong>de</strong>r Software vergegenständlichen. In<br />
diesem Abschnitt 5.2. wer<strong>de</strong>n primär methodische Ansätze diskutiert, die darauf zielen,<br />
eine „I-methodology“ bei <strong>de</strong>r Gestaltung von Technologien zu vermei<strong>de</strong>n. Dabei ist zu<br />
fragen, inwieweit diese Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n anhand von Fallbeispielen i<strong>de</strong>ntifizierten Vergeschlechtlichungsprozessen<br />
entgegen wirken können.<br />
Die „I-methodology“ ist ein relativ neues Konzept, das von Els Rommes (2000,<br />
2002) eingeführt wur<strong>de</strong>. Um diesem Problem, dass TechnikgestalterInnen unreflektiert<br />
eigene mentale Mo<strong>de</strong>lle in die Artefakte einschreiben, zu begegnen, haben sich schon<br />
in früheren Jahrzehnten verschie<strong>de</strong>ne Fachgebiete etabliert wie die Softwareergonomie<br />
(vgl. Maaß 1993, Herczeg 1994), die „Human-Computer Interaction“ (vgl.<br />
Dix et al. 1993, Sears/ Jacko 2002, 2008), das „User-Centered Design“ (vgl. etwa<br />
Holtzblatt et al. 2005) bzw. das „Human-Centered Design“ (Norman/ Draper 1986)<br />
sowie das „Participatory Design“ (Greenbaum/ Kyng 1991, Schuler/ Namioka 1993,<br />
301 Vgl. Rommes 2002 sowie Kapitel 4.1.4.<br />
220
Bødker et al.). 302 Diese Fachgebiete stellen die NutzerInnen in <strong>de</strong>n Mittelpunkt und<br />
haben bereits einen umfangreichen Korpus von Prinzipien, Metho<strong>de</strong>n und Vorgehensweisen<br />
zur Technikgestaltung hervorgebracht, die anhand von Projekten und<br />
Fallbeispielen sorgfältig empirisch evaluiert wor<strong>de</strong>n sind.<br />
Die Notwendigkeit, Software auf Anwen<strong>de</strong>rInnen auszurichten, die <strong>de</strong>n Computer<br />
nicht primär zum Programmieren gebrauchen, verstärkte sich mit <strong>de</strong>r Verbreitung von<br />
Personalcomputern in <strong>de</strong>n 1980er Jahren. Während die frühen NutzerInnen von<br />
Software zumeist die EntwicklerInnen <strong>de</strong>rselben waren und somit eine relativ homogene<br />
Gruppe bil<strong>de</strong>ten, stellen diese Nicht-ComputerexpertInnen neue Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
an die technischen Artefakte und ihre „Usability“. 303 „An<strong>de</strong>rs als die technikversierten<br />
Benutzer <strong>de</strong>r frühen Zeit <strong>de</strong>s Computereinsatzes hatten sie Schwierigkeiten mit<br />
formalen Kommandosprachen, Fehlerco<strong>de</strong>s, unübersichtlichen Systemausgaben und<br />
mangelhafter o<strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>r Dokumentation“ (Maaß 1993, 192). Bereits 1971 propagierte<br />
Hansen <strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>n Grundsatz „Know the user“ (Hansen 1971) für die Systementwicklung,<br />
um <strong>de</strong>n sich zu dieser Zeit abzeichnen<strong>de</strong>n historischen Verän<strong>de</strong>rungen<br />
durch <strong>de</strong>n Computereinsatz Rechnung zu tragen. Somit wur<strong>de</strong>n schon vor mehr als<br />
drei Jahrzehnten Ansätze entwickelt und erforscht, mit Hilfe <strong>de</strong>rer NutzerInnen<br />
untersucht wer<strong>de</strong>n können und die Software an <strong>de</strong>ren Fähigkeiten, Erfahrungen und<br />
Neigungen angepasst wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Ein Schwerpunkt <strong>de</strong>r frühen Software-Ergonomie 304 zielte darauf, die Erkenntnisse<br />
und Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Arbeitspsychologie für eine benutzerInnen- und aufgabenorientierte<br />
Systemgestaltung produktiv einzusetzen. Diese Forschungsrichtung konzentrierte sich<br />
seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren, als Computer zunehmend an Büroarbeitsplätzen eingesetzt<br />
wur<strong>de</strong>n, darauf, menschliches Arbeitshan<strong>de</strong>ln adäquat durch Computersysteme zu<br />
unterstützen. Arbeit sollte „menschengerecht“ gestaltet wer<strong>de</strong>n. Die VertreterInnen <strong>de</strong>r<br />
Software-Ergonomie for<strong>de</strong>rten, dass Softwaresysteme sieben Grundsätze <strong>de</strong>r Dialoggestaltung<br />
zu erfüllen hätten. Sie sollten aufgabenangemessen, selbstbeschreibungsfähig,<br />
steuerbar, erwartungskonform, fehlertolerant, individualisierbar und lernför<strong>de</strong>rlich<br />
sein. Die Aufnahme dieser Prinzipien in eine europäische Norm zu ergonomischen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten kann als Meilenstein betrachtet<br />
wer<strong>de</strong>n. 305 Im „User-Centered Design“ ist über solche Richtlinien und Grundsätze<br />
hinausgehend eine Reihe methodischer Vorschläge zur Technikgestaltung unterbreitet<br />
wor<strong>de</strong>n, um Softwaresysteme besser an die Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r NutzerInnen anzupassen<br />
(vgl. etwa Pain et al. 1993c für einen Überblick). Mittlerweile haben sich das Feld<br />
ebenso wie sein Metho<strong>de</strong>nkanon stark ausdifferenziert. So sind die Ansätze <strong>de</strong>s „User-<br />
Centered Design“ zum „Interaction Design“ weiter entwickelt wor<strong>de</strong>n (vgl. etwa Preim<br />
1999, Preece et al. 2002, Moggridge 2006). Diese Verschiebung ist aufgrund <strong>de</strong>s<br />
302 Eine genaue Abgrenzung zwischen <strong>de</strong>n genannten Gebieten ist schwierig. Doch haben sie z.T.<br />
unterschiedliche Schwerpunkte und stehen in verschie<strong>de</strong>nen Theorietraditionen, vgl. etwa Pain et al.<br />
1993, Törpel 2005 für einen Überblick. Ich wer<strong>de</strong> sie nachfolgend als benutzungszentrierte Ansätze<br />
bezeichnen. Dort, wo dies für das hier verfolgte Vorhaben <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
relevant ist, wird jedoch auf Differenzen hingewiesen.<br />
303 Der Begriff „Usability“ wird häufig im Sinne <strong>einer</strong> „Benutzbarkeit“ verstan<strong>de</strong>n. Innerhalb <strong>de</strong>s<br />
Fachdiskurses <strong>de</strong>r Softwareergonomie ist er jedoch treffen<strong>de</strong>r als „Gebrauchstauglichkeit“ – im Gegensatz<br />
zur „Nützlichkeit“ – ins Deutsche übersetzt.<br />
304 Maaß 1993 beschreibt drei Schwerpunkte <strong>de</strong>r frühen Software-Ergonomie: einen technischen, einen<br />
kognitiv-psychologischen und <strong>de</strong>n arbeitspsychologischen, auf <strong>de</strong>n hier Bezug genommen wird.<br />
305 Vgl. DIN 66234 /ISO 9241, Teil 110 von 1996. In <strong>de</strong>r neueren Version von 2006 blieben die Prinzipien<br />
erhalten, ihre Definitionen wur<strong>de</strong>n jedoch geschärft.<br />
221
Paradigmenwechsels von Algorithmen hin zu interaktiven Systemen (vgl. Wegner<br />
1997) sowie <strong>de</strong>r Verlagerung <strong>de</strong>s Schwerpunkts <strong>de</strong>r Anwendungen von Arbeitsplätzen<br />
zum Alltagsleben notwendig gewor<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r Veralltäglichung <strong>de</strong>s Internets entstand<br />
aus <strong>de</strong>n Ansätzen <strong>de</strong>r „Software-Ergonomie“ bzw. „Mensch-Computer-Interaktion“ 306<br />
die Richtung <strong>de</strong>r „Web-Usability“ (vgl. Nielsen/ Loranger 2006). 307<br />
Aus diesem breiten Spektrum methodischer Vorschläge sollen im Folgen<strong>de</strong>n<br />
diejenigen diskutiert wer<strong>de</strong>n, die für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r in Kapitel 4.1. aufgezeigten<br />
Vergeschlechtlichungsprozesse und Fallbeispiele vielversprechend erscheinen. Es<br />
wer<strong>de</strong>n zunächst das „User Centered Design“ und „Usability-Tests“, ferner ethnografische<br />
Metho<strong>de</strong>n und speziell „Cultural Probes“ sowie die „Personas“-Metho<strong>de</strong> und<br />
Probleme <strong>de</strong>r Auswahl von Testpersonen skizziert und auf ihre Reichweite, <strong>de</strong>m<br />
Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte entgegenzuwirken, untersucht.<br />
5.2.1. „User-Centered Design“ und „Usability-Tests“ für eine adäquate<br />
Mo<strong>de</strong>llierung von NutzerInnen<br />
Die verschie<strong>de</strong>nen Vorgehensweisen <strong>de</strong>r benutzungszentrierten Gestaltung 308 lassen<br />
sich grob in vier Phasen unterglie<strong>de</strong>rn: 1. Anfor<strong>de</strong>rungs- und Aufgabenanalyse, 2. die<br />
Entwicklung verschie<strong>de</strong>ner konzeptueller und gestalterischer Entwurfsalternativen, 3.<br />
die Entwicklung interaktiver Versionen dieser Entwürfe sowie 4. die Evaluierung <strong>de</strong>r<br />
Gestaltungsvorschläge. Bei <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse wird zunächst die Zielgruppe <strong>de</strong>s<br />
zu entwickeln<strong>de</strong>n Produkts bestimmt und es wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ren Bedürfnisse i.d.R. systematisch<br />
mittels Fragebögen, Interviews, Fokusgruppen o<strong>de</strong>r Beobachtungsstudien<br />
erhoben, um daraus typische Nutzungsaufgaben und Nutzungsszenarien (Use Cases)<br />
ableiten zu können. Beson<strong>de</strong>rs im Fall von Systemen, die für <strong>de</strong>n Einsatz an Arbeitsplätzen<br />
gedacht sind, umfasst dies eine <strong>de</strong>taillierte Aufgabenanalyse. Danach wer<strong>de</strong>n<br />
verschie<strong>de</strong>ne I<strong>de</strong>en entwickelt, wie die ermittelten Anfor<strong>de</strong>rungen erfüllt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Die anschließen<strong>de</strong> Phase <strong>de</strong>s konzeptuellen sowie gestalterisch-technischen<br />
Entwurfs umfasst die Ausarbeitung dieser Vorschläge in Form einfacher interaktiver<br />
Prototypen, die softwarebasiert o<strong>de</strong>r auch auf Papier umgesetzt sein können. 309<br />
Schließlich sind Design und Produkt auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu überprüfen.<br />
Solche Evaluationen wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel mit NutzerInnen aus <strong>de</strong>r Zielgruppe <strong>de</strong>s<br />
Produkts anhand <strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntifizierten typischen Nutzungsaufgaben durchgeführt. Usertests<br />
lassen sich am Produkt selbst realisieren, sind jedoch zugleich geeignet, bereits<br />
in <strong>de</strong>n frühen Phasen <strong>de</strong>r Konzeption und <strong>de</strong>s Designs <strong>de</strong>r Software eingesetzt zu<br />
wer<strong>de</strong>n, um bereits dort eine Beteiligung <strong>de</strong>r NutzerInnen zu ermöglichen. Im Detail<br />
variieren die vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n nach ihrem Grad <strong>de</strong>r Beteiligung von<br />
NutzerInnen am Design. So wird <strong>de</strong>ren Arbeit in ethnografischen Ansätzen <strong>de</strong>s „User-<br />
Centered Design“ o<strong>de</strong>r im „Contextual Design“ (Beyer/ Holtzblatt 1998) zwar <strong>de</strong>tailliert<br />
306 Im Englischen „Human Computer Interaction (HCI).<br />
307 Weitere Forschungsrichtungen sind „Design for all“ (vgl. Shnei<strong>de</strong>rman 2000, Lei<strong>de</strong>rmann et al. 2001,<br />
Horton 2005, siehe auch Maaß 2003), „Universal Design“ (vgl. Stephani<strong>de</strong>s 2001) und „Universal<br />
Usability“.<br />
308 Ich folge hiermit <strong>de</strong>r Darstellung <strong>de</strong>s „Interaction Design“ nach Preece et al. 2002, insb. 168ff, die<br />
an<strong>de</strong>ren Charakterisierungen <strong>de</strong>s „User-centered Design“ entspricht, jedoch spezifischer dargestellt ist.<br />
Als erste beschrieben Gould/ Lewis 1985 drei Prinzipien <strong>de</strong>s User-Centered Design: 1. früher Fokus auf<br />
NutzerInnen und Aufgaben, 2. empirische Metho<strong>de</strong>n und 3. iterative Gestaltung.<br />
309 Zu einfachen Prototypen und so genannten Mock-ups vgl. auch Abschnitt 5.3.<br />
222
untersucht, sie wer<strong>de</strong>n jedoch erst im „Participatory Design“ als gleichwertige<br />
PartnerInnen im technischen Gestaltungsprozess angesehen.<br />
Das „User-Centered Design“ stellt ein umfangreiches, wissenschaftlich fundiertes<br />
Metho<strong>de</strong>nrepertoire zur Verfügung, um reale Nutzungsanfor<strong>de</strong>rungen zu ermitteln und<br />
in die Technikgestaltung umzusetzen. Da hierbei nicht nur auf abstrahierte, messbare<br />
empirische Daten über die NutzerInnen zurückgegriffen wird wie in kognitivistisch<br />
ausgerichteten Zweigen <strong>de</strong>r Software-Ergonomie, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Umgang tatsächlicher<br />
NutzerInnen mit konkreten Prototypen untersucht wird, lassen sich aufgrund <strong>de</strong>r „Imethodology“<br />
entstan<strong>de</strong>ne Imaginationen <strong>de</strong>r TechnologiegestalterInnen über die NutzerInnen<br />
richtig stellen. Die nutzungszentrierte Technikgestaltung birgt das Potential,<br />
<strong>de</strong>r Vergegenständlichung unbewusster Annahmen <strong>einer</strong> von Männern dominierten,<br />
homosozialen Gruppe im technischen Design entgegenzuwirken. Selbstreferentielle<br />
Aussagen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen wie „I relied on my own experience“ (vgl. Oudshoorn<br />
et al. 2004, 48) wären auf dieser methodologischen Basis nicht möglich.<br />
Es wird allerdings immer wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>utlich, dass die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „User-Centered<br />
Designs“ in <strong>de</strong>r Praxis nicht angewandt wer<strong>de</strong>n. Tests mit NutzerInnen gelten als zu<br />
teuer und zu zeitaufwändig. Sie seien insbeson<strong>de</strong>re für kleine Firmen nicht leistbar, die<br />
ihre Produkte so schnell wie möglich auf <strong>de</strong>n Markt bringen müssen. Darüber hinaus<br />
wird befürchtet, dass konkurrieren<strong>de</strong> Firmen auf entsprechen<strong>de</strong> I<strong>de</strong>en aufmerksam<br />
wer<strong>de</strong>n und ein ähnliches Produkt schneller entwickeln könnten, insbeson<strong>de</strong>re, wenn<br />
Tests, wie angestrebt, in <strong>de</strong>n frühen Phasen <strong>de</strong>s Designs durchgeführt wer<strong>de</strong>n.<br />
Deshalb entstehen immer wie<strong>de</strong>r Produkte, die auf <strong>de</strong>r „I-methodology“ basieren und<br />
aufgrund <strong>de</strong>ssen vergeschlechtlicht sind. Die Studie über digitale Städte (vgl. 4.1.4) ist<br />
dafür ein prägnantes Beispiel. Entsprechend konzentriert sich die Kritik <strong>de</strong>r AutorInnen<br />
auf unzureichen<strong>de</strong> Tests mit „Usern“ (vgl. Oudshoorn et al. 2004). So seien im Fall <strong>de</strong>r<br />
ersten bei<strong>de</strong>n Versionen <strong>de</strong>r digitalen Stadt Amsterdam keine systematischen Tests<br />
<strong>de</strong>r Benutzungsoberflächen mit NutzerInnen durchgeführt wor<strong>de</strong>n, geschweige <strong>de</strong>nn<br />
mit Nicht-NutzerInnen. Die Überprüfung beschränkte sich auf technische Funktionalitäten,<br />
während eine breit verstan<strong>de</strong>ne Usability nicht Gegenstand <strong>de</strong>r Untersuchung<br />
war. We<strong>de</strong>r die Inhalte noch die <strong>de</strong>m Design zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Metaphern<br />
wur<strong>de</strong>n erprobt. Bei <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>r dritten Version <strong>de</strong>r Software wur<strong>de</strong>n zwar<br />
neun Frauen und zwei Männer involviert, die jedoch nicht mehr zu <strong>de</strong>n unerfahrenen<br />
InternetnutzerInnen gehörten. Zu<strong>de</strong>m seien die Tests nicht <strong>de</strong>r Methodik entsprechend<br />
durchgeführt wor<strong>de</strong>n.<br />
Usability-Tests sollten mit tatsächlichen NutzerInnen und anhand zuvor i<strong>de</strong>ntifizierter<br />
typischer Nutzungsaufgaben durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Häufig fin<strong>de</strong>n diese in eigens<br />
dafür eingerichteten Räumen, so genannten Usability-Laboren statt. Dabei besteht <strong>de</strong>r<br />
Versuchsaufbau üblicherweise darin, <strong>de</strong>n ausgewählten NutzerInnen Aufgaben zu stellen<br />
und sie aufzufor<strong>de</strong>rn, ihre I<strong>de</strong>en und Fragen bei <strong>de</strong>r Suche und Lösung dieser laut<br />
auszusprechen („thinking aloud“-Metho<strong>de</strong>). Neben diesen Äußerungen wer<strong>de</strong>n die<br />
Mausbewegungen <strong>de</strong>r NutzerInnen auf <strong>de</strong>m Bildschirm, in manchen Fällen darüber<br />
hinaus auch ihre Gesichtsausdrücke via Kamera o<strong>de</strong>r ihre Augen-Bewegungen mittels<br />
Eye-Tracking-Systemen aufgezeichnet. Diese Daten wer<strong>de</strong>n anschließend mit aufwendigen<br />
Verfahren ausgewertet und damit die Gebrauchstauglichkeit <strong>de</strong>r Software<br />
evaluiert. Im „User-Centered Design“ wer<strong>de</strong>n diese Tests entsprechend modifiziert, um<br />
sie bereits in frühen Phasen <strong>de</strong>r Konzeption und Entwicklung <strong>de</strong>r Software zur<br />
223
Überprüfung und zur Gestaltung durch die NutzerInnen heranziehen zu können,<br />
beispielsweise auf <strong>de</strong>r Grundlage von Papierprototypen. 310<br />
Es ist zu vermuten, dass die Resultate korrekt durchgeführter Tests mit Personen<br />
<strong>de</strong>r realen Zielgruppe zu <strong>einer</strong> Öffnung <strong>de</strong>s Zugangs zu <strong>de</strong>n digitalen Städten und<br />
<strong>einer</strong> besseren Gebrauchtauglichkeit geführt hätten, insbeson<strong>de</strong>re wenn soziale<br />
Gruppen, die zum damaligen Zeitpunkt in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n nicht nur qua Geschlecht,<br />
son<strong>de</strong>rn auch qua Sexualität, Klasse, race, Ethnizität, Befähigung, Verortung o<strong>de</strong>r Alter<br />
als InternetnutzerInnen stark unterrepräsentiert waren, einbezogen wor<strong>de</strong>n wären.<br />
Dazu wäre jedoch eine sorgfältige Auswahl <strong>de</strong>r Testpersonen entsprechend <strong>de</strong>s anvisierten<br />
Zugangs für Je<strong>de</strong> und Je<strong>de</strong>n notwendig gewesen sowie eine angemessene<br />
Wahl <strong>de</strong>r im Test zu überprüfen<strong>de</strong>n Aufgaben, die sich mehr an <strong>de</strong>r Gebrauchstauglichkeit<br />
als an <strong>de</strong>r technischen Performanz ausrichtet. Ferner hätte die Durchführung<br />
<strong>de</strong>r Tests entsprechend <strong>de</strong>r Methodik <strong>de</strong>s „User-Centered Designs“ umgesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n müssen. Die nie<strong>de</strong>rländische Studie über Digitale Städte zeigt auf, dass User-<br />
Tests, die nicht entsprechend dieser o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> an<strong>de</strong>ren Methodik durchgeführt<br />
wur<strong>de</strong>n, Gefahr laufen, ein unangemessenes o<strong>de</strong>r gar schlechtes Design zu legitimieren,<br />
weil die GestalterInnen diese als Bestätigung ihres Entwurfes mißverstehen<br />
können. Explizite NutzerInnen-Repräsentationstechniken wie Usability-Tests wür<strong>de</strong>n<br />
somit, wie bereits Akrich (1992) betonte: „often function as tools to legitimate the<br />
<strong>de</strong>sign process so that the <strong>de</strong>signers can claim that they have taken the needs of users<br />
into account as tool to gui<strong>de</strong> technological <strong>de</strong>cisions“ (Oudshoorn et al. 2004, 43). Sie<br />
kehren auf diese Weise die Absicht, <strong>de</strong>r „I-methodology“ entgegenwirken zu wollen, in<br />
ihrem Ergebnis ins Gegenteil.<br />
Auf einzelne Diskrepanzen zwischen <strong>de</strong>m NutzerInnenbild <strong>de</strong>r DesignerInnen und<br />
<strong>de</strong>n tatsächlichen NutzerInnen, die bei <strong>de</strong>r Digitalen Stadt Amsterdam in Bezug auf die<br />
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen <strong>de</strong>r Nutzung sowie das Design herausgearbeitet<br />
wur<strong>de</strong>n, hätten sicherlich auch Interviews mit Personen <strong>de</strong>r Zielgruppe und<br />
an<strong>de</strong>re Verfahren aufmerksam machen können. So ließe sich etwa die von <strong>de</strong>n<br />
Autorinnen <strong>de</strong>r Studie beanstan<strong>de</strong>te Lernstrategie <strong>de</strong>s „trial and error“, die die DesignerInnen<br />
voraussetzten, o<strong>de</strong>r die Inadäquatheit <strong>de</strong>s Handbuchs, das eher für ExpertInnen<br />
verfasst war, bereits mit einem Blick auf die Grundsätze <strong>de</strong>r Dialoggestaltung (EN<br />
ISO 9241-110) erkennen. Dies legt nahe, stets einen Mix an Metho<strong>de</strong>n (z.B. Überprüfung<br />
von ergonomischen Leitlinien, Interviews und Tests mit NutzerInnen) 311 einzusetzen,<br />
da je<strong>de</strong> einzelne Metho<strong>de</strong> Stärken und Schwächen aufweist, 312 sodass ein Mix<br />
unterschiedliche Problematiken eines Designentwurfes aufzu<strong>de</strong>cken vermag.<br />
Die genannten Techniken können zwar auf fehlen<strong>de</strong> Übereinstimmungen zwischen<br />
<strong>de</strong>r beabsichtigten Zielgruppe und <strong>de</strong>n Kompetenzen, Interessen und Präferenzen <strong>de</strong>r<br />
tatsächlich angesprochen NutzerInnen hinzuweisen. Aus <strong>einer</strong> Gestaltungsperspektive<br />
<strong>de</strong>r Informatik ist diese Erkenntnis jedoch nur ein erster Schritt. Denn wenn Software<br />
310<br />
Ausführlichere Beschreibungen <strong>de</strong>r hier nur ansatzweise skizzierten Metho<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>n sind in<br />
Lehrbüchern, vgl. etwa Preece et al. 2002, 2007.<br />
311<br />
Weitere Möglichkeiten, die Gebrauchtauglichkeit <strong>einer</strong> Benutzungsoberfläche zu überprüfen, bestehen<br />
darin, die Usability durch ExpertInnen zu analysieren, welche dazu heuristische Verfahren o<strong>de</strong>r so<br />
genannte „kognitive Walkthroughs“ (vgl. Wharton et al. 1994) anwen<strong>de</strong>n. Dabei wer<strong>de</strong>n die Abfolgen von<br />
Masken und Meldungen schrittweise durchdacht und mit <strong>de</strong>n BenutzerInnenanfor<strong>de</strong>rungen verglichen.<br />
312<br />
Beispielsweise erscheinen Usability-Tests primär bei <strong>de</strong>njenigen Produkten hilfreich, für die sich eine<br />
überschaubare Anzahl klar <strong>de</strong>finierbarer typischer Nutzungsaufgaben i<strong>de</strong>ntifizieren lassen.<br />
224
„besser“ gestaltet wer<strong>de</strong>n soll – beispielsweise entsprechend <strong>de</strong>r De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Perspektive dieser Arbeit –, so stellt sich die Frage, wie die Ergebnisse solcher<br />
Untersuchungen in alternative Entwürfe einfließen können. Das Potential nutzungszentrierter<br />
Entwicklungsmetho<strong>de</strong>n für ein alternatives Design wird erst dann ausgeschöpft,<br />
wenn Tests mit realen NutzerInnen wie oben skizziert in einen zyklischen Prozess <strong>de</strong>r<br />
Technikgestaltung integriert wer<strong>de</strong>n. User-Tests sollten auch Teil eines iterativen,<br />
evolutionären Gestaltungsprozesses sein. In diesem Rahmen bergen sie <strong>de</strong>n Vorteil,<br />
nicht nur Endprodukte, son<strong>de</strong>rn auch vorläufige Entwürfe und Prototypen durch NutzerInnen<br />
bewerten zu können. Ein solcher zyklischer Designprozess ermöglicht darüber<br />
hinausgehend, Studien aus <strong>de</strong>r feministischen Wissenschafts- und Technikforschung<br />
(wie etwa die von Rommes und ihren Kolleginnen über Digitale Städte) im<br />
Entwicklungsprozess zu berücksichtigen und die dort i<strong>de</strong>ntifizierten Mängel bereits<br />
während <strong>de</strong>s Entwicklungsprozesses zu beheben. Auf diese Weise lässt sich die<br />
Methodologie <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ mit Analysen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von<br />
Artefakten verknüpfen, um sie als De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie zu nutzen, die <strong>de</strong>r „I-methodology“<br />
entgegenwirkt.<br />
Die bislang diskutierten Vorgehensweisen liefern allerdings noch keinen Hinweis<br />
darauf, wie sich <strong>de</strong>m vergeschlechtlichten Design <strong>de</strong>r von Anne-Jorunn Berg<br />
untersuchten „intelligenten Häuser“ begegnen ließe (vgl. Kapitel 4.1.3). Dabei liegt die<br />
Schwierigkeit hier darin, die Aufgaben en <strong>de</strong>tail zu mo<strong>de</strong>llieren, die in Häusern bzw.<br />
beim Wohnen konkret ausgeführt wer<strong>de</strong>n. Nur wenn diese Aufgaben <strong>einer</strong>seits bekannt<br />
und an<strong>de</strong>rerseits technisch unterstützbar sind, können beispielsweise „Usability-<br />
Tests“ durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Für die technische Unterstützung wäre im Sinne eines De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring darauf zu achten, dass die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung nicht<br />
verstärkt, son<strong>de</strong>rn aufgebrochen wird. Es ist zu diskutieren, ob das Ziel <strong>de</strong>r gesuchten<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie sein soll, Hausarbeit, so wie sie immer noch vornehmlich von<br />
Frauen ausgeführt wird, sichtbar zu machen und die Unterstützung bzw. Automatisierung<br />
solcher Tätigkeiten als Anfor<strong>de</strong>rung in die Gestaltung einzuschließen, wie dies<br />
aus Bergs Studie abzuleiten wäre. O<strong>de</strong>r ob es vielmehr darum geht, die Dichotomie<br />
von „männlich“ konnotierter Technikfaszination und von als „weiblich“ verstan<strong>de</strong>ner<br />
Hausarbeit qua Design aufzubrechen. Auf Metho<strong>de</strong>n, die darauf zielen, die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung technisch nicht zu reproduzieren, komme ich<br />
weiter unten zurück. Zunächst ist jedoch die Frage <strong>de</strong>r Aufgabenanalyse zu<br />
diskutieren, da die Problematik <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung im Fall „intelligenter Häuser“<br />
bereits auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Problem<strong>de</strong>finition, auf <strong>de</strong>r die Technologie grün<strong>de</strong>t,<br />
angesie<strong>de</strong>lt ist. Haushaltstätigkeiten wur<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung intelligenter Häuser<br />
bislang ignoriert. Somit stellt sich die Frage, welche Analysemetho<strong>de</strong>n auf<br />
Alltagsaktivitäten wie das Wohnen zu fokussieren vermögen und <strong>de</strong>r, in intelligenten<br />
Häusern festgeschriebenen Technikfixierung entgegenwirken können.<br />
5.2.2. Ethnographische Studien und „Cultural Probes“ für adäquate<br />
Problem<strong>de</strong>finitionen von Technologien privater Nutzung<br />
Für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Alltagsnutzung von Technologien wer<strong>de</strong>n gemeinhin Konsument-<br />
Innenbefragungen und Marktanalysen als geeignete Metho<strong>de</strong>n angesehen, um die<br />
Produkte besser an die Bedürfnisse, Geschmäcker und Wünsche potentieller<br />
225
KäuferInnen bzw. KundInnen anpassen zu können. Um weitergehen<strong>de</strong> Informationen<br />
über zukünftige NutzerInnen zu gewinnen, gelten auch Interviews, Fokusgruppen und<br />
an<strong>de</strong>re sozialwissenschaftliche Metho<strong>de</strong>n als hilfreich (vgl. Bührer 2006). Mit all diesen<br />
Techniken ist es zwar möglich, grob abzuschätzen, welche Technologien marktwirtschaftlich<br />
aussichtsreich erscheinen, und damit Produkti<strong>de</strong>en nach ökonomischen<br />
Kriterien <strong>de</strong>r Verwertbarkeit zu evaluieren. Es können damit allerdings we<strong>de</strong>r Produkti<strong>de</strong>en<br />
generiert noch Festschreibungen <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n Geschlechterordnung im<br />
Design erkannt wer<strong>de</strong>n. Um neue Technologien zu entwickeln, die alternative Problem<strong>de</strong>finitionen<br />
adressieren und bislang ausgeschlossene Perspektiven zu integrieren<br />
vermögen, genügen solche Metho<strong>de</strong>n nicht. Ein erster Ansatzpunkt, um die Gestaltung<br />
von Technologie auf dieser Ebene für eine Vielfalt von NutzerInnen offen zu halten und<br />
strukturelle Ausschlüsse zu vermei<strong>de</strong>n, ist es, Analysen aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Wissenschafts-<br />
und Technikforschung, die wie Berg (1999 [1994]) auf ein gen<strong>de</strong>rsensbiles<br />
Design hinweisen o<strong>de</strong>r vorausgegangene Aneignungsprozesse von NutzerInnen untersuchen<br />
(vgl. Rohracher 2006), im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Ferner<br />
fin<strong>de</strong>n sich im Bereich <strong>de</strong>s nutzungszentrierten User-Centered Designs Metho<strong>de</strong>n, die<br />
für diesen Zweck adaptiert wer<strong>de</strong>n können.<br />
Eine Möglichkeit, Anfor<strong>de</strong>rungen an Technologien zu ermitteln, die sich nicht wie<br />
Arbeitsprozesse zielgerichtet untersuchen lassen, besteht in <strong>de</strong>r Nutzung ethnografischer<br />
Verfahren. 313 Beispielsweise führten Michael Mateas und seine KollegInnen<br />
(Mateas et al. 1996) eine Pilotstudie durch, bei <strong>de</strong>r sie 10 Familien in ihren Häusern<br />
besuchten und untersuchten. Dabei war das Ziel, ein hausinternes Computersystem zu<br />
entwerfen und zu entwickeln. Bei <strong>de</strong>r Durchführung <strong>de</strong>r Feldstudie achteten die<br />
DesignerInnen insgesamt auf eine Atmosphäre, in <strong>de</strong>r sich die Untersuchten wohl<br />
fühlen können. So brachten die WissenschaftlerInnen ein Aben<strong>de</strong>ssen mit, um einen<br />
persönlichen Zugang zu <strong>de</strong>n einzelnen Familienmitglie<strong>de</strong>rn zu fin<strong>de</strong>n, bevor jene nach<br />
einem typischen Tag in ihrem Haus/ ihrer Wohnung befragt wur<strong>de</strong>n. Dazu wur<strong>de</strong>n sie<br />
aufgefor<strong>de</strong>rt, mit Hilfe <strong>einer</strong> Filzpappe, auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Grundriss ihres Hauses dargestellt<br />
war, <strong>de</strong>n Ablauf eines typischen Tages zu erklären. Als Hilfsmittel konnten sie Repräsentationen<br />
<strong>de</strong>r Räume, Produkte, Aktivitäten und Menschen auf <strong>de</strong>r Pappe umherbewegen.<br />
Aus diesen Daten gewannen die EthnographInnen Erkenntnisse über die<br />
<strong>de</strong>m Leben und Wohnen zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Konzepte von Raum, Zeit und sozialer<br />
Kommunikation in <strong>de</strong>n untersuchten Familien. Die Untersuchung zeigte, dass die Familienaktivitäten<br />
über mannigfache Räume verteilt stattfan<strong>de</strong>n. Die Familienmitglie<strong>de</strong>r<br />
waren nur selten allein, vielmehr stellten Interaktionen eine wesentliche Voraussetzung<br />
<strong>de</strong>s Familienlebens dar. Genau diese Aktivitäten lassen sich jedoch von <strong>de</strong>m<br />
Standardmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s PC, <strong>de</strong>r von <strong>einer</strong> Person an einem Ort für eine längere, ununterbrochene<br />
Zeitspanne genutzt wird, nicht unterstützen. Die ForscherInnen schlugen<br />
<strong>de</strong>shalb die Entwicklung kl<strong>einer</strong>, integrierter elektronischer Geräte vor, die von <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen an verschie<strong>de</strong>nen Orten eingesetzt wer<strong>de</strong>n können und die zur<br />
Unterstützung häuslicher Aktivitäten und Kommunikationsprozesse angemessener<br />
seien als ein PC.<br />
313 Auch Arbeitsprozesse wer<strong>de</strong>n häufig mit ethnographischen Verfahren wie beispielsweise <strong>de</strong>m<br />
Contextual Design untersucht, vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt 5.3.<br />
226
Mateas und seine KollegInnen interpretieren die Ergebnisse ihrer ethnografischen<br />
Untersuchung mit Referenz auf <strong>de</strong>n PC. Die Erkenntnis, dass Familienleben vornehmlich<br />
aus gemeinsamen Aktivitäten und Kommunikation besteht, ließe sich jedoch ebenso<br />
fruchtbar für das Design intelligenter Häuser einsetzen, das von Berg kritisiert<br />
wor<strong>de</strong>n ist. Hätten sich die Entwickler dieser Artefakte auf die BewohnerInnen <strong>de</strong>r<br />
Häuser konzentriert und ethnographische Verfahren benutzt, so wäre vermutlich ein<br />
Entwurf entstan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r eher die Kommunikation und das Zusammenspiel unter <strong>de</strong>n<br />
Familienmitglie<strong>de</strong>rn technisch unterstützt. Ein solcher Designvorschlag kann gegenüber<br />
<strong>de</strong>m auf die Kontrolle <strong>de</strong>r Sicherheit, Energie und multimedialen Vernetzung<br />
fokussierten System, das Berg aufgezeigt hat, als eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie bewertet<br />
wer<strong>de</strong>n. Denn er zielt darauf, eine breitere Vielfalt von Zielgruppen anzusprechen<br />
als die technikfaszinierten Nerds, die von Berg als NutzerInnenbild <strong>de</strong>r intelligenten<br />
Häuser i<strong>de</strong>ntifiziert wor<strong>de</strong>n sind. Gleichzeitig kann eine solche Ausrichtung <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung die erneute Festschreibung von Geschlechterdifferenz vermei<strong>de</strong>n, solange<br />
die Kommunikationsanfor<strong>de</strong>rung nicht als „weibliches Anliegen“, son<strong>de</strong>rn als Ergebnis<br />
<strong>de</strong>r empirischen Untersuchung ge<strong>de</strong>utet wird.<br />
Wäre die ethnografische Untersuchung aus Bergs Perspektive durchgeführt wor<strong>de</strong>n,<br />
hätte sie wahrscheinlich auch die Be<strong>de</strong>utung von manueller Hausarbeit als Grundlage<br />
für das Funktionieren <strong>de</strong>s Familienlebens auf<strong>de</strong>cken können. Um diese Einsicht jedoch<br />
in ein neues Design umzusetzen, 314 wären allerdings noch grundlegen<strong>de</strong> Ansätze zu<br />
entwickeln, wie Hausarbeit technisch unterstützt wer<strong>de</strong>n kann, da dieses Feld in <strong>de</strong>r<br />
Informatik seit jeher unterbelichtet ist – im Vergleich etwa zur computervermittelten<br />
Kommunikation, auf die Mateas Studie rekurrieren kann.<br />
Eine weitere in <strong>de</strong>r Tradition ethnografischer, nutzerInnenzentrierter Verfahren<br />
stehen<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong> für das Design von Technologien in alltagsweltlichen Umgebungen,<br />
die nicht nur die Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r NutzerInnen ermittelt, son<strong>de</strong>rn gera<strong>de</strong> auf die<br />
Entwicklung neuer Denk- und Nutzungsrichtungen zielt, wur<strong>de</strong> von Bill Gavers, Tony<br />
Dunnes und Elena Pacentis entwickelt: „Cultural Probes“ (Gaver et al. 1999) gelten im<br />
Feld <strong>de</strong>r HCI mittlerweile als eines <strong>de</strong>r einflussreichsten Konzepte <strong>de</strong>s letzten<br />
Jahrzehnts. Bei dieser Metho<strong>de</strong> wer<strong>de</strong>n Freiwillige (bzw. potentielle NutzerInnen) mit<br />
kleinen, speziell gestalteten Päckchen ausgestattet, die verschie<strong>de</strong>ne Materialien enthalten,<br />
beispielsweise Postkarten mit bestimmten vorbereiteten Fragen, eine Einwegkamera,<br />
ein günstiges digitales Diktiergerät, ein Fotoalbum, ein Notizbuch zum Führen<br />
eines Nutzungstagebuchs, eine Sammlung von Stadtplänen bzw. „Freun<strong>de</strong>s- o<strong>de</strong>r<br />
Familienplänen“. Damit sollen die NutzerInnen I<strong>de</strong>en, spontane Reaktionen und<br />
routinemäßige Praktiken während <strong>einer</strong> Phase von ca. ein bis vier Wochen auf<br />
subjektive Art und Weise dokumentieren. So können sie <strong>de</strong>n DesignerInnen etwa auf<br />
<strong>einer</strong> Postkarte erklären, welches Gerät für sie wichtig ist, im Stadtplan markieren, wo<br />
sie Menschen treffen o<strong>de</strong>r hingehen, um allein zu sein, das Diktiergerät nach <strong>de</strong>m<br />
Aufwachen als „dream recor<strong>de</strong>r“ benutzen und mittels Fotos zeigen, wo und wie sie<br />
314 Auf die grundlegen<strong>de</strong> Problematik, Ethnographie und System<strong>de</strong>sign methodisch zu integrieren,<br />
machen etwa Preece et al. aufmerksam: „Design is concerned with abstraction and rationalization.<br />
Ethnography, on the other hand, is about <strong>de</strong>tail. An ethnographer’s account will be concerned with the<br />
minutiae of observation, while the <strong>de</strong>signer is looking for useful abstractions that can be used to inform<br />
<strong>de</strong>sign“ (Preece et al. 2002, 292). Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die „Coherence“-Metho<strong>de</strong><br />
(Viller/ Sommerville 1999), die genau diesen Übersetzungsprozess von Ethnographie in<br />
Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse und Verfahren <strong>de</strong>r traditionellen Softwaretechnik adressiert.<br />
227
leben, was sie sich wünschen o<strong>de</strong>r langweilig fin<strong>de</strong>n. Der offene Charakter <strong>de</strong>s<br />
Umgangs mit <strong>de</strong>n Materialien lädt zu reichhaltigen, situierten Antworten ein. Auf diese<br />
Wiese erhalten die TechnologiegestalterInnen eine Vielfalt von Rückmeldungen über<br />
subjektive Erfahrungen während „realer“ alltagsweltlicher Situationen, ohne dass diese<br />
während <strong>de</strong>r Untersuchungsphase ständig anwesend sein o<strong>de</strong>r ein Laborexperiment<br />
durchführen müssten.<br />
Gaver und seine KollegInnen verstehen „Cultural Probes“ als „experimental <strong>de</strong>sign<br />
in a responsive way“ (Gaver et al. 1999, 22), es geht ihnen darum, inspirieren<strong>de</strong><br />
Reaktionen bei potentiellen NutzerInnen zu provozieren und letztere gleichzeitig in das<br />
Design einzubin<strong>de</strong>n. Mit informellen Analysen und <strong>einer</strong> eher spekulativen Interpretation<br />
<strong>de</strong>s umfangreichen Materials stellen sie sich in die Tradition von Künstler-<br />
DesignerInnen und grenzen sich von natur- und technikwissenschaftlich basierten<br />
Ansätzen <strong>de</strong>r Technologiegestaltung ab. Fünf Jahre nach <strong>de</strong>r ersten Veröffentlichung<br />
<strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> berichten sie darüber, dass ihr Ansatz häufig verengt rational angewandt<br />
wird, statt die Offenheit und Unsicherheit <strong>de</strong>s Prozesses zu wahren und auszuhalten:<br />
„The problem is there has been a strong ten<strong>de</strong>ncy to rationalize the Probes. People<br />
seem unsatisfied with the playful, subjective approach embodied by the original<br />
Probes, and so <strong>de</strong>sign theirs to ask specific questions and produce comprehensible<br />
results. They summarize the results, analyze them, even use them to produce<br />
requirements analyses.“ (Gaver et al. 2004, 53).<br />
Mit <strong>de</strong>n „Cultural Probes“ wird Design dagegen zum Forschungsprozess <strong>de</strong>klariert,<br />
um neue Verständnisse von Technologie zu gewinnen und die Grenzen bislang<br />
existieren<strong>de</strong>r Artefakte zu erweitern, in<strong>de</strong>m Funktionen, Erfahrungen und kulturelle<br />
Settings über die Norm hinausgehend erkun<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n sollen. „Instead of <strong>de</strong>signing<br />
solutions for user needs, then, we work to provi<strong>de</strong> opportunities to discover new<br />
pleasures, new forms of sociability, and new cultural forms. We often act as provocateurs<br />
through our <strong>de</strong>signs, trying to shift current perceptions of technology functionally,<br />
aesthetically, culturally, and even politically“ (Gaver et al. 1999, 25). Die Metho<strong>de</strong><br />
nimmt Anleihen bei politischen Strömungen aus <strong>de</strong>r Kunstszene wie <strong>de</strong>m<br />
Situationismus, Dada o<strong>de</strong>r Surrealismus, in<strong>de</strong>m sie Kommerzialität durch ihre visuellen<br />
und textuellen Produkte subversiv zu unterminieren sucht. Es wer<strong>de</strong>n Taktiken <strong>de</strong>r<br />
Ambiguität, Absurdität und <strong>de</strong>s Rätselhaften eingesetzt, um neue Perspektiven auf das<br />
Alltagsleben zu provozieren. Auf diese Weise versuchen Gaver und seine KollegInnen<br />
<strong>de</strong>m Problem, dass Wissen stets Grenzen habe und die TechnologiegestalterInnen<br />
nicht in die Köpfe potentieller NutzerInnen hineinschauen könnten, gerecht zu wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Ansatz „values uncertainty, play, exploration, and subjective interpretation as ways<br />
of <strong>de</strong>aling with those limits“ (Gaver et al. 2004, 53f).<br />
Die AutorInnen sind sich bewusst, dass die „Probes“ nicht entlang <strong>einer</strong> schrittweise<br />
<strong>de</strong>finierten Vorgehensweise analysiert o<strong>de</strong>r klar interpretiert wer<strong>de</strong>n können, weil sie<br />
zu vielen subjektiven Einflüssen und Bedingungen ausgesetzt sind (vgl. Gaver et al.<br />
2004, 55). Deshalb stellt sich die Frage, wie die vielfältigen Materialien in ein Design<br />
übersetzt wer<strong>de</strong>n sollen. Gaver und seine KollegInnen geben dabei selbst zu, dass die<br />
„Cultural Probes“ zwar eine wertvolle Inspiration sind, aber nicht die einzige Quelle<br />
ihrer Designvorschläge darstellen. Vielmehr seien ihre Entwürfe zugleich von ihren<br />
eigenen konzeptionellen Interessen und ihren Untersuchungen vor Ort geprägt sowie<br />
durch Elemente <strong>de</strong>r Alltagskultur inspiriert wie Anekdoten o<strong>de</strong>r die populäre Presse<br />
228
(vgl. Gaver et al. 1999, 29). Zugleich wür<strong>de</strong>n auch die jeweils vorhan<strong>de</strong>nen<br />
technologischen Möglichkeiten in <strong>de</strong>n konzeptionellen Entwurf mit einbezogen. „Our<br />
<strong>de</strong>sign i<strong>de</strong>as are formed from a combination of conceptual interests, technological<br />
possibilities, imaginary scenarios and i<strong>de</strong>as for how to implement them.“ (Gaver et al.<br />
2004, 56). Dies be<strong>de</strong>utet jedoch, dass die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Cultural Probes“ zwar die<br />
NutzerInnen in <strong>de</strong>n Mittelpunkt stellt, die Interpretation <strong>de</strong>r Materialien jedoch stark von<br />
<strong>de</strong>n Vorannahmen und Zielen <strong>de</strong>r DesignerInnen abhängt. Aus <strong>einer</strong> De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Perspektive betrachtet heißt dies, dass es in <strong>de</strong>r Verantwortung <strong>de</strong>r DesignerInnen<br />
liegt, ob Geschlecht als Analyse- und Strukturkategorie in das Design eingebracht wird<br />
o<strong>de</strong>r auch nicht. Generell erscheint es bei <strong>de</strong>n ethnografischen Metho<strong>de</strong>n notwendig,<br />
GeschlechterforscherInnen mit einem breiten Hintergrundwissen über <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong>n<br />
Korpus feministischer Forschung in das Designteam aufzunehmen, damit diese<br />
Perspektiven vertreten sind. Dies vorausgesetzt, ließen sich die „Cultural Probes“<br />
wahrscheinlich so gestalten, dass diejenigen Erfahrungen, die als subjektive bislang in<br />
herkömmlichen <strong>de</strong>n Verfahren 315 unterrepräsentiert bzw. ignoriert waren, stärker zum<br />
Ausdruck gebracht wer<strong>de</strong>n können. Damit könnte auch <strong>de</strong>r Blick auf manuelle Haushaltstätigkeiten<br />
o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re nicht-technikzentrierte Aspekte <strong>de</strong>s Alltags möglich<br />
wer<strong>de</strong>n. Auch um die Probes zu interpretieren und in ein geschlechter<strong>kritisch</strong>es Design<br />
zu übersetzen, bedarf es eines für die bestehen<strong>de</strong>n Geschlechterverhältnisse und<br />
symbolischen Ordnungen geschärften o<strong>de</strong>r geschulten Blickes. Dabei ist häufig eine<br />
zweite Reflektionsstufe nötig, wie die Studie von Katharina Bredies, Sandra Buchmüller<br />
und Gesche Joost (Bredies et al. 2006) zeigt. Die Forscherinnen versuchten, „Cultural<br />
Probes“ aus <strong>einer</strong> geschlechter<strong>kritisch</strong>-<strong>de</strong>konstruktiven Perspektive anzuwen<strong>de</strong>n,<br />
mussten jedoch im Nachhinein feststellen, dass sie in ihre Auswahl und das Design <strong>de</strong>r<br />
Materialien, die sie <strong>de</strong>n NutzerInnen zur Verfügung stellten, eigene geschlechtsstereotype<br />
Annahmen eingingen. Diese Vorstellungen spiegeln sich in <strong>de</strong>n Ergebnissen <strong>de</strong>r<br />
Studie wi<strong>de</strong>r.<br />
Dies <strong>de</strong>utet darauf hin, dass Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung „an sich“ nicht bereits<br />
<strong>de</strong>n Unterschied produzieren, ob die auf diese Weise produzierten Artefakte vergeschlechtlicht<br />
sein wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r als „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ bezeichnet wer<strong>de</strong>n<br />
können. Es kommt <strong>einer</strong>seits auf die konkrete Umsetzung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n an. Ferner<br />
kommen einige methodische Ansätze einem De-Gen<strong>de</strong>ring entgegen, während<br />
herkömmliche Software-Entwicklungsverfahren <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
technischer Artefakte eher beför<strong>de</strong>rn. Ethnographien erscheinen für <strong>de</strong>n Zweck <strong>de</strong>s<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring geeignet, da sie generell darauf zielen, das Implizite – also das, was<br />
häufig weiblich konnotiert ist o<strong>de</strong>r realiter von Frauen ausgeführt wird – explizit zu<br />
machen. Die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Cultural Probes“ erscheint dabei noch aussichtsreicher als<br />
an<strong>de</strong>re Verfahren, um „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ zu entwerfen, da sie sich explizit<br />
gegen die vorherrschen<strong>de</strong>n Untersuchungen von „technologies for the home“ wen<strong>de</strong>t,<br />
die zumeist auf fragwürdigen Stereotypen darüber, wie Menschen leben, grün<strong>de</strong>n,<br />
etwa: „that ‚home‘ equals ‚family‘, for instance, or that the activities of home revolve<br />
around consumption and recreation, domestic chores and paid employment.“ (Gaver et<br />
al. 2004, 54).<br />
315 Dabei wären auch die Auffor<strong>de</strong>rungen an die ProbandInnen, wie sie das Material nutzen können,<br />
entsprechend zu formulieren.<br />
229
Tatsächlich berichtet die Designerin Gesche Joost von <strong>einer</strong> Studie ihrer Stu<strong>de</strong>ntin<br />
Sandra Ro<strong>de</strong>, die die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Selbstbeobachtung durch „Cultural Probes“ mit<br />
Interviews und teilnehmen<strong>de</strong>r Beobachtung kombiniert hat, um eine Kampagne für die<br />
„Familie von heute“ jenseits <strong>de</strong>s traditionellen Musters von Hausfrau, Familienernährer,<br />
Kind zu entwerfen (vgl. Joost o.J.). Ro<strong>de</strong> untersuchte eine Familie, in <strong>de</strong>r die Mutter<br />
berufstätig und ihr Mann vorwiegend für die Kin<strong>de</strong>r zuständig war. Dabei hätten Wi<strong>de</strong>rsprüche<br />
zwischen <strong>de</strong>n Selbstbeschreibungen <strong>de</strong>r ProbandInnen und <strong>de</strong>r teilnehmen<strong>de</strong>n<br />
Beobachtung wertvolle Hinweise auf die Motive <strong>de</strong>r Einzelnen und Machtkonstellation<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Familie gegeben. Ferner wur<strong>de</strong>n Diskrepanzen zwischen<br />
<strong>de</strong>n gelebten Rollen und gesellschaftlichen Ansprüchen <strong>de</strong>utlich. Insbeson<strong>de</strong>re die<br />
Frau schien aufgrund <strong>de</strong>r Berufstätigkeit gegenüber <strong>de</strong>r Familie ein schlechtes<br />
Gewissen zu haben und sie beschrieb sich selbst als Nervensäge. „Anhand von eigenen<br />
Geschichten in <strong>de</strong>n Cultural Probes-Tagebüchern, anhand von selbstgemachten<br />
Fotos, die die Familie in wichtigen Augenblicken ihres Zusammenlebens zeigen, o<strong>de</strong>r<br />
anhand <strong>de</strong>r Metaphern, die Mutter und Vater für ihre eigenen Rollen in <strong>de</strong>r Familie<br />
gefun<strong>de</strong>n haben, entstand ein vielschichtiges und unebenes Portrait <strong>de</strong>r Familie, die<br />
selbst immer wie<strong>de</strong>r mit Zuschreibungen und Normen <strong>de</strong>r Gesellschaft konfrontiert<br />
wird, wie die ‚richtige‘ Rollenverteilung sein soll“ (Joost o.J., 8).<br />
„Cultural Probes“ eröffnen in <strong>de</strong>r Kombination mit an<strong>de</strong>ren Metho<strong>de</strong>n die<br />
Möglichkeit, auch aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive heterogene o<strong>de</strong>r gar<br />
wi<strong>de</strong>rsprüchliche Anfor<strong>de</strong>rungen an Technologie aufzuzeigen, die aus <strong>de</strong>n vielfältigen<br />
Materialien heraus interpretiert wer<strong>de</strong>n können. Zugleich hat die Metho<strong>de</strong> das<br />
Potential, gera<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Ebene von Problem<strong>de</strong>finitionen, die <strong>de</strong>r Technologie<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen, wirksam zu wer<strong>de</strong>n. Zwar bemerken die EntwicklerInnen <strong>de</strong>s<br />
Ansatzes, dass diese in <strong>de</strong>r Regel viel pragmatischer und verengter angewen<strong>de</strong>t wird.<br />
Doch selbst wenn <strong>de</strong>r Erfolg <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> in Bezug auf das De-Gen<strong>de</strong>ring maßgeblich<br />
von <strong>de</strong>r Durchführung abhängt, z.B. von <strong>de</strong>r Beteiligung von Geschlechterforscher-<br />
Innen am Interpretationsprozess, kann festgehalten wer<strong>de</strong>n, dass ethnografische<br />
Verfahren insgesamt Ansätze zur Verfügung stellen, die potentiell dafür genutzt<br />
wer<strong>de</strong>n können, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien für die private Nutzung im<br />
Alltag entgegenzuwirken. Deshalb kommt es bei <strong>de</strong>r Anwendung dieser Techniken vor<br />
allem darauf an, die Bedingungen für ein De-Gen<strong>de</strong>ring zu schaffen.<br />
5.2.3. „Personas“: Zur Problematik <strong>de</strong>r Auswahl von Testpersonen und<br />
Freiwilligen<br />
Ein wesentlicher Aspekt <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring mit Hilfe <strong>de</strong>r bis hierher diskutierten<br />
Metho<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r durch das Beispiel <strong>de</strong>r Kampagne für die „Familie von heute“<br />
angesprochen wur<strong>de</strong>, ist die Frage, wie die Testpersonen, ProbenutzerInnen bzw. Freiwilligen<br />
für die empirischen Verfahren bestimmt wer<strong>de</strong>n sollen. Das Problem <strong>de</strong>r Auswahl<br />
von RepräsentantInnen für die Zielgruppe eines Produkts stellt sich bei <strong>de</strong>n in<br />
diesem Abschnitt betrachteten Technologien, die „für je<strong>de</strong> und je<strong>de</strong>n“ nutzbar und<br />
nützlich sein sollen, im beson<strong>de</strong>ren Maße. Sie tritt ebenso <strong>de</strong>utlich bei Webanwendungen<br />
und Interfaces hervor, die gleichzeitig unterschiedliche Demografien, Sprachen<br />
und kulturelle Orientierungen ansprechen möchten. In diesen Fällen erscheint es auf<br />
<strong>de</strong>n ersten Blick nahe liegend, eine größtmögliche Diversität von Testpersonen<br />
230
einzubeziehen. An<strong>de</strong>rs als jedoch quantitative Umfragen mit durchstrukturierten<br />
Fragen und vorgegebenen Antworten, die mit Unterstützung von Software und<br />
Internetanwendungen regelbasiert erhoben und ausgewertet wer<strong>de</strong>n können, sind<br />
Usabilitytests, Prototypingverfahren, ethnographische Metho<strong>de</strong>n und Cultural Probes<br />
zu aufwendig, um sie mit <strong>einer</strong> repräsentativen Auswahl von Personengruppen durchzuführen.<br />
Für die Verfahren wer<strong>de</strong>n oft nur ca. fünf bis 12 Freiwillige gesucht. Es gilt<br />
als methodisches Dilemma, dass die Anzahl von NutzerInnentests i.d.R. durch <strong>de</strong>n<br />
Projektzeitplan, finanzielle Ressourcen sowie die Verfügbarkeit von TeilnehmerInnen<br />
und <strong>einer</strong> entsprechen<strong>de</strong>n Einrichtung beschränkt wird, während mehr Tests eine<br />
größere Repräsentativität <strong>de</strong>r Ergebnisse garantieren (vgl. Preece et al. 2002, 440f). 316<br />
Deshalb wer<strong>de</strong>n Usertests in <strong>de</strong>r Praxis häufig doch nur mit (vorwiegend weißen,<br />
Informatik studieren<strong>de</strong>n Männern <strong>de</strong>r eigenen Universität durchgeführt. 317 Diese bil<strong>de</strong>n<br />
jedoch in Bezug auf die Kategorien Geschlecht, Bildungsstand etc. ebenso wie<br />
hinsichtlich ihrer Vorerfahrungen mit und Begeisterung für die jeweilige Technik einen<br />
im Vergleich zur offenen Zielgruppe relativ homogenen Personenkreis, <strong>de</strong>r zu<strong>de</strong>m<br />
<strong>de</strong>rjenigen <strong>de</strong>r TechnologiegestalterInnen ähnlich ist. Die „I-methodology“ kann auf<br />
diese Weise gera<strong>de</strong> nicht durchbrochen wer<strong>de</strong>n.<br />
Im „User-Centered Design“ wird i.d.R. allgemein empfohlen, ein für die angestrebte<br />
Zielgruppe repräsentatives Sample zu wählen und sich auf „typische“ NutzerInnen zu<br />
konzentrieren. Insbeson<strong>de</strong>re soll auf eine gleiche Anzahl von Frauen und Männern<br />
geachtet wer<strong>de</strong>n sowie auf eine entsprechen<strong>de</strong> Verteilung von NutzerInnen unterschiedlicher<br />
Vorerfahrung mit Computern (ebd.). Doch selbst wenn versucht wird, eine<br />
breite Diversität von NutzerInnen durch die ausgewählten Testpersonen zu repräsentieren,<br />
erfor<strong>de</strong>rt dies aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive ein reflektiertes Vorgehen.<br />
So unterstellten beispielsweise Mateas und seine KollegInnen (1996) implizit, dass<br />
Häuser und Wohnungen primär von Kleinfamilien bewohnt wer<strong>de</strong>n. Damit wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Kreis an ProbandInnen im Vorhinein verengt, da Personen, die nicht-traditionelle<br />
Wohn- und Lebensformen praktizieren, ausgeschlossen waren. Im Sinne <strong>einer</strong> De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Strategie käme es hier darauf an, <strong>de</strong>n Blick auf an<strong>de</strong>re mögliche<br />
NutzerInnen zu erweitern. Das Beispiel <strong>de</strong>r unkonventionellen Kleinfamilie von Joost,<br />
bei <strong>de</strong>r die Mutter berufstätig und <strong>de</strong>r Vater für die Familienarbeit zuständig ist, 318 zeigt,<br />
wie dies methodisch unterstützt wer<strong>de</strong>n kann. Auch weitergehend ließen sich, um <strong>de</strong>r<br />
inhärent heteronormativen Ten<strong>de</strong>nz ethnographischer Verfahren zu begegnen,<br />
ProbandInnen beteiligen, die allein, all<strong>einer</strong>ziehend, in Großfamilien, Kommunen und in<br />
generationenübergreifen<strong>de</strong>n Wohngemeinschaften leben, o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re, die ihr Wohnen<br />
wie viele Lesben, Schwule und Transsexuelle jenseits traditioneller Kleinfamilienmo<strong>de</strong>lle<br />
organisieren. Daran zeigt sich, dass es bei <strong>de</strong>n ethnografischen Verfahren nicht<br />
allein darauf ankommt, gleich viele Frauen wie Männer auszuwählen, son<strong>de</strong>rn neben<br />
„Geschlecht“ zugleich an<strong>de</strong>re Kategorien sozialer Ungleichheit zu beachten. Der<br />
Intersektionalität verschie<strong>de</strong>ner Ungleichheitsstrukturen mit Geschlecht tragen<br />
nutzerInnenzentrierte Ansätze bisher jedoch nicht in ausreichen<strong>de</strong>m Maße Rechnung.<br />
316 Tatsächlich liegt hier jedoch ein prinzipielles erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretisches Problem vor.<br />
317 Dies konnten Jutta Weber und ich beispielsweise etwa im Rahmen <strong>einer</strong> Studie über „sozioemotionale“<br />
Softwareagenten beobachten, vgl. Bath/Weber 2006, 119f. Solche Usertests halten <strong>de</strong>n<br />
gängigen sozialwissenschaftlichen Standards nicht stand.<br />
318 Vgl. hierzu <strong>de</strong>n letzten Abschnitt zu „Cultural Probes“.<br />
231
Die einzige im „User-Centered Design“ vorgeschlagene Metho<strong>de</strong>, welche die<br />
Problematik <strong>de</strong>r Auswahl von NutzerInnen adressiert und über allgemeine Hinweise<br />
auf eine größtmögliche Repräsentativität hinausgeht, ist „Personas“ (vgl. Cooper<br />
1999). Dabei wer<strong>de</strong>n mehrere fiktive Charaktere kreiert, welche verschie<strong>de</strong>ne NutzerInnentypen<br />
<strong>de</strong>r Zielgruppe repräsentieren. Diese Personas sind jeweils auf ein bis<br />
zwei Seiten zu charakterisieren, wobei die Beschreibung <strong>de</strong>ren Verhaltensmuster,<br />
Ziele, Fähigkeiten, Einstellungen und Umgebung umfassen soll. Darüber hinaus sind<br />
auch einige persönliche Eigenschaften hinzuzufügen und <strong>de</strong>r Persona ein Name zu<br />
geben, um sie quasi zum Leben erwecken. Im Vergleich zu herkömmlichen technischen<br />
Sprachen soll „Personas“ eine nutzerInnenzentrierte Gestaltung erleichtern, da<br />
mit <strong>de</strong>n Charakterisierungen ein emphatisches Verständnis <strong>de</strong>r DesignerInnen für die<br />
gewünschten NutzerInnen hergestellt wer<strong>de</strong>n soll. Die Metho<strong>de</strong> wird als hilfreich<br />
erachtet, um die Zielgruppe während <strong>de</strong>s gesamten Technikgestaltungsprozesses im<br />
Sinn zu behalten. Denn sie ermöglicht <strong>de</strong>n EntwicklerInnen bei je<strong>de</strong>m Schritt, bei <strong>de</strong>m<br />
Designentscheidungen über das Produkt, <strong>de</strong>ssen Funktionalität, NutzerInnenführung<br />
etc. gefällt wer<strong>de</strong>n, zu fragen: Wie wür<strong>de</strong> Persona Katrin o<strong>de</strong>r Peter darauf<br />
reagieren? 319<br />
Die Ursprünge von „Personas“ lassen sich auf die Schauspielkunst zurückführen.<br />
Die Metho<strong>de</strong> an sich wird seit langem in <strong>de</strong>r HCI genutzt (vgl. Pruitt/ Adlin 2006), sie<br />
wur<strong>de</strong> jedoch erst durch Alan Coopers renommiertes Buch „The inmates are running<br />
asylum“ (1999) unter diesem Namen bekannt gemacht. Cooper betont darin drei<br />
Vorteile von „Personas“. Neben <strong>de</strong>r bereits angesprochenen Hilfe bei Designentscheidungen,<br />
unterstütze es die Mitglie<strong>de</strong>r eines Entwicklungsteams, die oft aus<br />
verschie<strong>de</strong>nen Bereichen (z.B. Design, Ingenieurwissenschaften, Marketing) stammen,<br />
durch leicht merkbare Charakterisierungen, ein spezifisches, aber zugleich geteiltes<br />
Verständnis von <strong>de</strong>n NutzerInnen <strong>de</strong>r Zielgruppe zu entwickeln. Ferner befreie es von<br />
<strong>de</strong>n Schwierigkeiten eines zu umfangreichen Datenmaterials bzw. unangemessener<br />
Verallgem<strong>einer</strong>ung.<br />
Das „Personas“-Verfahren intendiert zwar, <strong>de</strong>r „I-methodology“ bewusst entgegenzuwirken,<br />
in<strong>de</strong>m i.d.R. an<strong>de</strong>re Charaktere beschrieben wer<strong>de</strong>n als die <strong>de</strong>r GestalterInnen<br />
selbst. Dies bewahrt jedoch nicht notwendigerweise vor einem Design, das an <strong>de</strong>n<br />
Bedürfnissen, Wünschen und Interessen realer NutzerInnen vorbeigeht, da letztere<br />
nicht in <strong>de</strong>n Prozess involviert wer<strong>de</strong>n. I<strong>de</strong>alerweise sollen die durch „Personas“<br />
beschriebenen „archetypischen“ NutzerInnen auf Grundlage empirischer, möglichst<br />
ethnographischer Studien entworfen wer<strong>de</strong>n. Jedoch können auch in diesem<br />
Interpretationsprozess bei <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen fehlgeleitete Bil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r NutzerInnen<br />
entstehen. Diese Gefahr droht <strong>einer</strong>seits, da die Metho<strong>de</strong> oft für Situationen<br />
empfohlen wird, in <strong>de</strong>nen sich keine Tests mit VertreterInnen <strong>de</strong>r Zielgruppe durchführen<br />
lassen. In <strong>de</strong>r Praxis wird <strong>de</strong>r notwendige empirische Bezug <strong>de</strong>shalb häufig<br />
ignoriert und es wer<strong>de</strong>n rein fiktionale Personas kreiert, die ggf. mehr über die<br />
DesignerInnen aussagen als über die potentiellen NutzerInnen. An<strong>de</strong>rerseits wird eine<br />
Stereotypisierung, die insbeson<strong>de</strong>re aus <strong>einer</strong> Geschlechterperspektive problematisch<br />
erscheint, zur Grundlage <strong>de</strong>r „Personas“-Metho<strong>de</strong> erhoben, da die Charaktere zur<br />
319 Da verschie<strong>de</strong>ne Personas unterschiedliche o<strong>de</strong>r gar wi<strong>de</strong>rsprüchliche Empfehlungen für Designentscheidungen<br />
geben können, empfiehlt Cooper 1999 eine Prioritätsmatrix aufzustellen, in <strong>de</strong>r zunächst<br />
festgelegt wird, welche Persona welches Gewicht im Designprozess bekommen soll.<br />
232
Repräsentation <strong>de</strong>r NutzerInnen stereotyp beschrieben wer<strong>de</strong>n sollen. Aufgrund<br />
<strong>de</strong>ssen können nicht nur die Bil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r NutzerInnen fehl liegen, son<strong>de</strong>rn auch – da<br />
diesen üblicherweise eines von zwei Geschlechtern zugewiesen wird –, erneut binäre<br />
Geschlechtsfestschreibungen vorgenommen wer<strong>de</strong>n. Insofern kann „Personas“ nur<br />
bedingt als eine geeignete Metho<strong>de</strong> angesehen wer<strong>de</strong>n, die „I-methodology“ und damit<br />
verbun<strong>de</strong>ne Vergeschlechlichungen <strong>de</strong>s Produkts zu vermei<strong>de</strong>n. Sie zeigt allerdings<br />
ferner <strong>de</strong>utlich die grundlegen<strong>de</strong> (und prinzipiell unauflösbare) methodische<br />
Schwierigkeit auf, eine „allgemeine“ NutzerIn zu repräsentieren, um technische<br />
Produkte „für Je<strong>de</strong> und Je<strong>de</strong>n“ zu gestalten.<br />
5.3. Design für spezifische NutzerInnengruppen: Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Kompetenzannahmen und Arbeitsteilung überwin<strong>de</strong>n<br />
Eine weitere Klasse von Technologien umfasst Software und Informationssystemen,<br />
die – im Gegensatz zu <strong>de</strong>n im letzten Abschnitt betrachteten Artefakten – nicht für die<br />
„allgemeine Anwen<strong>de</strong>rIn“, son<strong>de</strong>rn für spezifische NutzerInnengruppen konzipiert<br />
wer<strong>de</strong>n. Im Kontext <strong>de</strong>r Fragestellung dieser Arbeit von beson<strong>de</strong>rem Interesse sind<br />
dabei Technologien, die explizit o<strong>de</strong>r implizit für Nutzerinnen gedacht sind, d.h. etwa<br />
Frauen als Kundinnen direkt ansprechen sollen o<strong>de</strong>r an Arbeitsplätzen eingesetzt<br />
wer<strong>de</strong>n, die strukturell betrachtet typische Frauenarbeitsplätze darstellen. 320 Bei diesen<br />
besteht das Problem <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung häufig darin, dass stereotype<br />
Vorstellungen von „Weiblichkeit“ (wie Technikinkompetenz bei <strong>de</strong>n frühen Textverarbeitungssystemen)<br />
o<strong>de</strong>r die vorherrschen<strong>de</strong> geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilung<br />
(wie etwa zwischen KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen) in <strong>de</strong>r Software festgeschrieben<br />
und damit technisch reproduziert wer<strong>de</strong>n. Ferner sind als „weiblich“ konnotierte<br />
Tätigkeiten für formale Metho<strong>de</strong>n häufig unsichtbar und wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung<br />
ignoriert (vgl. hierzu Kapitel 4.2.). Im Vergleich zu <strong>de</strong>n Strategien <strong>de</strong>s letzten Abschnitts<br />
5.2., die auf die Anerkennung <strong>de</strong>r Diversität von NutzerInnen im Gestaltungsprozess<br />
gerichtet waren, geht es bei diesen Technologien darum, eine Geschlechtergleichheit<br />
zu erzielen. Frauen und Männern sollten im Prozess <strong>de</strong>r Technikgestaltung die<br />
gleichen Kompetenzen, Vorlieben etc. zugeschrieben bekommen. Ferner sind<br />
unsichtbare – und häufig von Frauen ausgeübte – Tätigkeiten sichtbar zu machen und<br />
ggf. zu mo<strong>de</strong>llieren. Auch <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n Geschlechterhierarchie am Arbeitsplatz ist<br />
entgegenzuwirken.<br />
Liegt das Problem wie bei <strong>de</strong>m Beispiel <strong>de</strong>s User-Interface für amerikanische<br />
Frauen und europäische, erwachsene, intellektuelle Männer (vgl. Marcus 1993) 321 auf<br />
<strong>de</strong>r Ebene von Stereotypen, so lassen sich zugrun<strong>de</strong> gelegte Vorurteile leicht durch<br />
Tests mit NutzerInnen als solche aufzu<strong>de</strong>cken. Es wur<strong>de</strong> bereits darauf verwiesen (vgl.<br />
Kapitel 4.1.1.), dass die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Usertests darin erfolgreich war, die <strong>de</strong>m Design<br />
zugrun<strong>de</strong> gelegte Annahme zu wi<strong>de</strong>rlegen, dass Frauen run<strong>de</strong> und Männer eher<br />
320 Auch explizit für Männer als Zielgruppen konzipierte Artefakte wären hier prinzipiell spannend anzuschauen,<br />
allerdings sind mir dazu keine Studien bekannt. Implizit für Männer als Zielgruppen gestaltete<br />
Technologien fin<strong>de</strong>n sich dagegen – wie bereits aufgezeigt – viele. Da diese häufig als geschlechtsneutral<br />
angesehen wer<strong>de</strong>n, können in diesen Fällen die im letzten Abschnitt 5.2. diskutierten De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Strategien eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
321 Siehe dazu ausführlicher Kapitel 4.1.1.<br />
233
eckige Formen bevorzugen wür<strong>de</strong>n. Auch in Fällen wie <strong>de</strong>r Textverarbeitungssoftware,<br />
welche die Nutzerinnen (Sekretärinnen) im Umgang mit <strong>de</strong>r Technologie im Stadium<br />
<strong>de</strong>r ständigen Anfängerin hält (vgl. Hofmann 1999), 322 können Analyse- und Designmetho<strong>de</strong>n<br />
aus <strong>de</strong>r nutzungszentrierten Technologiegestaltung hilfreich sein, um ein<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring zu beför<strong>de</strong>rn. Die Problematik <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring lässt sich dabei zum Teil<br />
jedoch auf ein mangeln<strong>de</strong>s Verständnis <strong>de</strong>r Arbeit von SekretärInnen bzw. Schreibtätigkeit<br />
zurückführen. Deshalb erscheinen für diesen Fall insbeson<strong>de</strong>re Elemente aus<br />
<strong>de</strong>m „Contextual Design“ (Beyer/ Holtzblatt 1998, Holtzblatt et al. 2005) sowie<br />
„Szenarien-basierte Ansätze“ (vgl. McGraw/ Harbisson 1997, Rosson/ Carroll 2002)<br />
nützlich, die nachfolgend diskutiert wer<strong>de</strong>n sollen. Anschließend wird in die Designphilosophie<br />
<strong>de</strong>s „Participatory Design“ <strong>de</strong>r Skandinavischen Schule eingeführt und ihre<br />
Techniken <strong>de</strong>r Organisations-Design-Spiele und <strong>de</strong>r Zukunftswerkstätten erläutert.<br />
Diese Ansätze erweisen sich als geeignet, um weiteren Fällen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
von IT zu begegnen, in <strong>de</strong>nen die bestehen<strong>de</strong> geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung durch IT reproduziert wird (vgl. Kapitel 4.2.2.-4.2.4.). Zum Abschluss<br />
dieses Abschnitts 5.3. wer<strong>de</strong>n Erfahrungen diskutiert, die in partizipativen Projekten<br />
„von und für Frauen“ auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r skizzierten methodischen Ansätze bereits<br />
gewonnen wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
5.3.1. „Contextual Design“ und Szenarien-basierte Ansätze: Arbeit verstehen<br />
und „unsichtbare Arbeit“ erkennen<br />
Im „Contextual Design“ wer<strong>de</strong>n Untersuchungen von Arbeitsplätzen primär anhand so<br />
genannter Interviews im Kontext („Contextual Interviews“) durchgeführt, die darauf<br />
zielen, die Arbeitstätigkeiten <strong>de</strong>r NutzerInnen genau zu verstehen. Interviews im Kontext<br />
basieren auf vier Grundprinzipien: Kontext, Partnerschaft, Interpretation und<br />
Fokus. Erstens wird das Interview am Arbeitsplatz <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>rIn durchgeführt, um<br />
die Vorgänge konkret und <strong>de</strong>tailliert erfassen zu können. Die DesignerInnen beobachten<br />
die Arbeit, während sie ausgeführt wird. Dadurch sollen auch Aspekte, die <strong>de</strong>n<br />
Anwen<strong>de</strong>rInnen als Routine o<strong>de</strong>r selbstverständlich erscheinen und auf direkte<br />
Nachfrage schwer artikulierbar sind („unsichtbare Arbeit“), in das Blickfeld genommen<br />
wer<strong>de</strong>n. Zweitens sollen die DesignerInnen versuchen, die NutzerInnen zu Lehren<strong>de</strong>n<br />
zu machen. Es wird die Grundhaltung <strong>einer</strong> Meister-/Lehrlings-Beziehung empfohlen,<br />
bei <strong>de</strong>r die NutzerIn als ExpertIn ihrer Arbeit (Meister) verstan<strong>de</strong>n wird, während die<br />
DesignerInnen als Lehrlinge von ihnen lernen und nachfragen. Damit soll vermie<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n, dass die Interviewen<strong>de</strong>n eine dominante Rolle haben und <strong>de</strong>n Gegenstand<br />
abstrakt <strong>de</strong>finieren. Zum dritten sollen die DesignerInnen ihre Verständnisse <strong>de</strong>r<br />
untersuchten Arbeit bereits während sie diese beobachten in ihrer eigenen Sprache<br />
beschreiben. Dies eröffnet <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen die Möglichkeit, diese Interpretationen<br />
ggf. zu korrigieren. Viertens haben die DesignerInnen ein bestimmtes Ziel, z.B. die Entwicklung<br />
<strong>einer</strong> neuen Version <strong>de</strong>r eingesetzten Software. Sie sollen <strong>de</strong>shalb versuchen,<br />
die Anwen<strong>de</strong>rInnen im Interview stets auf diesen Fokus (z.B. Herausfin<strong>de</strong>n von<br />
Problemen bei <strong>de</strong>m alten Produkt) im Rahmen <strong>de</strong>r Lehrlingsrolle hinzuführen und<br />
primär die für das Projekt relevanten Aspekte <strong>de</strong>r Arbeit beobachten.<br />
322 Siehe dazu ausführlicher Kapitel 4.2.1.<br />
234
Insgesamt wird empfohlen, zwei o<strong>de</strong>r drei repräsentative NutzerInnen pro relevanter<br />
Funktion in <strong>einer</strong> Organisation zu interviewen bzw. sechs bis 10 Interviews durchzuführen,<br />
falls nur eine Rolle zu mo<strong>de</strong>llieren ist. Dabei sollten übliche Aufgaben und<br />
Routinen beobachtet wer<strong>de</strong>n, aber ebenso ununterbrechbare Aufgaben, lang andauern<strong>de</strong><br />
Aufgaben sowie „unsichtbare“ Tätigkeiten. Im Vergleich zu an<strong>de</strong>ren ethnografischen<br />
Studien, die über Wochen und Monate angelegt sein können, sind Interviews im<br />
Kontext sehr viel kürzer. Sie dauern nur zwei bis drei Stun<strong>de</strong>n. Gleichzeitig sind sie<br />
jedoch fokussierter, da das Ziel ist, ein System zu gestalten und zu diesem Zwecks die<br />
Arbeit, Abläufe und Umgebung <strong>de</strong>r NutzerInnen zu verstehen. Ein Interview im Kontext<br />
ist somit keine teilnehmen<strong>de</strong> Beobachtung, son<strong>de</strong>rn eine Arbeitsplatzuntersuchung, bei<br />
<strong>de</strong>r es darum geht zu fragen und zu interpretieren.<br />
„Contextual Design“ umfasst eine strukturierte Vorgehensweise, wie die ethnografisch<br />
durch Interviews im Kontext erhobenen Daten in ein Technologie<strong>de</strong>sign übersetzt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Um das empirische Material auswerten zu können, sollen die DesignerInnen<br />
während und nach <strong>de</strong>n Interviews alles, was ihnen auffällt, auf Zetteln<br />
notieren und diese später sortieren. Als Ergebnis dieses Strukturierungsprozesses wird<br />
ein Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r beobachteten Arbeit erstellt, das verschie<strong>de</strong>ne Sichtweisen umfasst: ein<br />
Arbeitsorganisations- und Workflow-Mo<strong>de</strong>ll (Menschen, Kommunikation, Koordination),<br />
ein Ablaufmo<strong>de</strong>ll (konkrete Arbeitschritte in ihrer Abfolge), ein Artefaktmo<strong>de</strong>ll (Beschreibung<br />
<strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong>, die für die Tätigkeit gebraucht wer<strong>de</strong>n), ein Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r<br />
Unternehmensorganisation und -kultur (organisatorische Rahmenbedingungen) und<br />
ein physisches Mo<strong>de</strong>ll (Darstellung <strong>de</strong>r Arbeitsumgebung inkl. technischer Ausstattung).<br />
Später sollen die aus <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen Interviews gewonnenen Arbeitsmo<strong>de</strong>lle<br />
in <strong>einer</strong> Interpretationssitzung <strong>de</strong>s Designteams konsolidiert wer<strong>de</strong>n.<br />
Die anschließen<strong>de</strong>n, stärker zum Design hin führen<strong>de</strong>n Schritte 323 sollen an dieser<br />
Stelle nicht <strong>de</strong>taillierter beschrieben wer<strong>de</strong>n, da <strong>de</strong>r meines Erachtens entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />
Schritt <strong>de</strong>r Methodik <strong>de</strong>s „Contextual Design“, <strong>de</strong>r zu einem De-Gen<strong>de</strong>ring beitragen<br />
kann, in <strong>de</strong>r Erhebungstechnik <strong>de</strong>s Interviews im Kontext besteht. Denn dieses Arbeitsanalyseverfahren<br />
birgt die Chance, ein Verständnis von <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r NutzerInnen zu<br />
gewinnen, das für die Gestaltung von Softwaresystemen, die gera<strong>de</strong> jene unterstützen<br />
sollen, notwendig ist. In Bezug auf das angeführte Beispiel <strong>de</strong>r Textverarbeitungssoftware<br />
wür<strong>de</strong> darüber hinaus vermie<strong>de</strong>n, dass die BenutzerInnen im Status <strong>de</strong>r ewigen<br />
Anfängerin gehalten wer<strong>de</strong>n, vielmehr versucht die Metho<strong>de</strong>, die Kompetenzen <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>rInnen<br />
wahrzunehmen und zu würdigen. Das Verfahren lenkt die Aufmerksamkeit<br />
nicht nur auf die routinemäßigen Tätigkeiten, die bereits von <strong>de</strong>r Organisation bzw.<br />
<strong>de</strong>m Management <strong>einer</strong> Firma als maßgebliche Arbeit betrachtet wird, o<strong>de</strong>r auf Probleme<br />
mit <strong>de</strong>r Software bei <strong>de</strong>r Anwendung, son<strong>de</strong>rn ebenso auf „unsichtbare Arbeit“.<br />
Diese wur<strong>de</strong> im vorangehen<strong>de</strong>n Kapitel (vgl. Kapitel 4.2.3. und 4.2.4.) nicht nur als<br />
diejenige entlarvt, die in traditionellen Systementwicklungsmetho<strong>de</strong>n (z.B. Objektorientierung<br />
inklusive <strong>de</strong>s „Rational Unified Process“-Mo<strong>de</strong>lls) häufig ignoriert o<strong>de</strong>r zumin<strong>de</strong>st<br />
nicht als ein funktionaler Bestandteil von Arbeit anerkannt, son<strong>de</strong>rn zugleich<br />
insbeson<strong>de</strong>re von Frauen ausgeübt wird. Demzufolge lässt sich das Interview im<br />
Kontext in einem doppelten Sinne als eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie betrachten. Mit<br />
323 Dazu gehören das Arbeits-Re-Design, das Arbeitsumgebungs<strong>de</strong>sign, Mock-ups <strong>de</strong>r Software und<br />
Tests mit Anwen<strong>de</strong>rInnen sowie <strong>de</strong>r Einsatz in <strong>de</strong>r Praxis.<br />
235
Hilfe dieser Metho<strong>de</strong> können DesignerInnen ein Verständnis von <strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen gewinnen, und zugleich vermag sie auf unsichtbare Arbeit aufmerksam zu<br />
machen. In diesem zweiten Sinne wur<strong>de</strong> sie im Rahmen eines Projekts zur Callcenter<br />
Arbeit erfolgreich eingesetzt, wo sie aufzu<strong>de</strong>cken vermochte, dass flexible Kommunikation<br />
und Emotionsarbeit maßgebliche Bestandteile <strong>de</strong>r Tätigkeit von Callcenter-<br />
AgentInnen sind (vgl. etwa Maaß/ Rommes 2007). Diese Analyse kann nun bei <strong>de</strong>r<br />
Weiterentwicklung von Callcenter-Software genutzt wer<strong>de</strong>n, um Softwaremängel zu<br />
beheben, in<strong>de</strong>m die zuvor nicht mo<strong>de</strong>llierte Interaktionsarbeit <strong>de</strong>r vornehmlich von<br />
Frauen repräsentierten Beschäftigten im Callcenter in zukünftigen Versionen tatsächlich<br />
unterstützt wird (vgl. hierzu auch Kapitel 4.2.4.).<br />
Insgesamt ist die Strategie <strong>de</strong>s Sichtbarmachens von unsichtbarer Arbeit jedoch,<br />
wie Bowker und Star (2000) herausgestellt hatten, eine ambivalente. Sie ist mit<br />
Vorsicht einzusetzen, da Sichtbarkeit nicht nur für die Tätigkeit notwendige Aspekte in<br />
das Blickfeld rückt, die <strong>de</strong>r technischen Unterstützung bedürfen, son<strong>de</strong>rn stets zugleich<br />
Kontrollmöglichkeiten durch das Management bietet, was mit einem politischen<br />
Verständnis von Technologiegestaltung nicht zu vereinbaren ist. 324 So gesehen kann<br />
das Interview im Kontext zwar prinzipiell als eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong> verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n, wobei jedoch am jeweiligen konkreten Fall zu überprüfen ist, ob sie in <strong>de</strong>m<br />
betrachteten Kontext in <strong>de</strong>r beabsichtigten Weise wirksam wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Weitere Kritiken <strong>de</strong>utet darauf hin, dass die vom „Contextual Design“ vorgeschlagenen<br />
Metho<strong>de</strong>n aus partizipativ-praktischen, feministischen und wissenschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
Perspektiven fragwürdig sind (vgl. Törpel 2008). Törpel arbeitet heraus, dass „Contextual<br />
Design“ keine partizipative Metho<strong>de</strong> ist, durch die NutzerInnen auf Technikgestaltung<br />
Einfluss nehmen können. Statt <strong>de</strong>r Beschäftigten, für <strong>de</strong>ren Tätigkeit<br />
Technik entwickelt wer<strong>de</strong>n soll, repräsentiere sie die Sicht <strong>de</strong>s Managements. „Rather<br />
than becoming equal co-<strong>de</strong>signers, e.g. members of the <strong>de</strong>sign team, the ‚normal‘<br />
working people in Contextual Design are conceptualized to be mere sources of data in<br />
the service of rationalization efforts“ (Törpel 2008, o.S.). Das Problem dieses<br />
politischen Standpunkts bestün<strong>de</strong> darin, dass <strong>de</strong>n Untersuchten nicht klar sei, wofür<br />
die erhobenen Daten verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Eine Klärung <strong>de</strong>r Machtkonstellationen, in <strong>de</strong>r<br />
die Erhebung stattfin<strong>de</strong>t ist, nicht Bestandteil <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>. Deshalb sei <strong>de</strong>r Status <strong>de</strong>r<br />
Ergebnisse, die mit Hilfe <strong>de</strong>s „Contextual Design“ ermittelt wer<strong>de</strong>n, unklar: repräsentieren<br />
sie – wie intendiert – „authentische Arbeitspraktiken“ o<strong>de</strong>r eher Praktiken <strong>de</strong>r<br />
Vermeidung und <strong>de</strong>s Wi<strong>de</strong>rstands <strong>de</strong>r Beschäftigten, etwa weil sie annehmen, dass sie<br />
ihren Arbeitsplatz durch die Ergebnisse <strong>de</strong>r Untersuchung verlieren könnten.<br />
Ferner wür<strong>de</strong>n die im Rahmen <strong>de</strong>s „Contextual Design“ erstellten Mo<strong>de</strong>lle sowie <strong>de</strong>r<br />
„Kontext“ sehr eng gefasst. Vielfalt und Wan<strong>de</strong>l in <strong>de</strong>n Arbeitstätigkeiten könnten mit<br />
<strong>de</strong>n vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n kaum erfasst wer<strong>de</strong>n. Vielmehr ziele die Untersuchung<br />
primär auf Wie<strong>de</strong>rholbares, so dass eine (für die Informatik typische) Ten<strong>de</strong>nz<br />
zur Vereinheitlichung bestehe. Hinzuzufügen ist, dass dabei ebenso wenig die<br />
Möglichkeit <strong>einer</strong> objektiven Darstellung <strong>de</strong>s Beobachteten in Frage gestellt wird, so<br />
dass die Mo<strong>de</strong>lle Gefahr laufen, auf verschie<strong>de</strong>ne Ebenen an <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen an das System vorbeizugehen.<br />
324 Vgl. hierzu die ausführliche Diskussion unsichtbarer Arbeit im Abschnitt 4.2.3.<br />
236
Insgesamt vermag „Contextual Design“ somit unter guten Umstän<strong>de</strong>n „unsichtbare<br />
Arbeit“ sichtbar zu machen und kann auf diese Weise zu einem De-Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Technologie beitragen. Aufgrund <strong>de</strong>r von Törpel aufgezeigten methodischen und politischen<br />
Voraussetzungen <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> können jedoch vermittelte Einschreibungen<br />
impliziter Vorstellungen <strong>de</strong>r Designer (z.B. Geschlechtsstereotype) in die zu erstellen<strong>de</strong>n<br />
Mo<strong>de</strong>lle nicht verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. In diesem Fall kann erneut eine Variante <strong>de</strong>r „I-<br />
Methodology“ wirksam wer<strong>de</strong>n. So betrachtet, tendiert die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Contextual<br />
Designs“ dazu, Geschlecht als binäre, strukturell-symbolische Ordnung festzuschreiben,<br />
wenn sie nicht um grundsätzliche, wissenschafts<strong>kritisch</strong>e, macht<strong>kritisch</strong>e und<br />
feministische Perspektiven ergänzt wird.<br />
Szenarienbasierte Ansätze stellen eine weitere Metho<strong>de</strong> dar, wie die Ergebnisse<br />
von Interviews – speziell zu Arbeitsabläufen und Problemen bei <strong>de</strong>r Benutzung<br />
bestehen<strong>de</strong>r Systeme – dargestellt wer<strong>de</strong>n können. Diese vermögen zwar die grundsätzliche<br />
politische Problematik <strong>de</strong>s „Contextual Design“ nicht aufzulösen. Im<br />
Gegensatz zum „Contextual Design“, bei <strong>de</strong>m die Mo<strong>de</strong>lle von <strong>de</strong>n Arbeitsprozessen<br />
im Designteam erstellt wer<strong>de</strong>n, hat diese Metho<strong>de</strong> aber <strong>de</strong>n Anspruch, verständliche<br />
Beschreibungen zu produzieren, die als Grundlage für die Kommunikation zwischen<br />
DesignerInnen und NutzerInnen dienen. Damit erscheint sie partizipativer und ist auch<br />
wissenschaftstheoretisch weniger fragwürdig als <strong>de</strong>r zuvor diskutierte Ansatz <strong>de</strong>s<br />
„Contextual Design“.<br />
„Scenarios are example ‚stories‘ of normal events and critical inci<strong>de</strong>nts that<br />
represent the types of situations with which the performers must work and use the<br />
system“ (McGraw/ Harbisson 1997, 120). Sie wer<strong>de</strong>n in verschie<strong>de</strong>nen Bereichen wie<br />
<strong>de</strong>r Strategischen Planung, HCI, Anfor<strong>de</strong>rungsanalysen und <strong>de</strong>r Objektorientierten<br />
Analyse und Design genutzt und zumeist in Textform, manchmal auch als Graphik,<br />
Vi<strong>de</strong>o o<strong>de</strong>r Storyboard dargestellt (vgl. Gro/ Carroll 2004). Speziell eignen sich<br />
Szenarien dazu, Arbeitstätigkeiten, Abläufe und die Benutzung von Systemen narrativ<br />
zu beschreiben. Sie lassen sich als einfaches Hilfsmittel einsetzen, um Akteure, ihre<br />
Ziele und <strong>kritisch</strong>e Erfolgsfaktoren, Hauptereignisse, <strong>de</strong>n räumlichen und logischen<br />
Kontext ihrer Handlungen (u.a. auch Randbedingungen), verwen<strong>de</strong>te Ressourcen<br />
(Technik, Hilfsmittel, Informationen) und Entscheidungen, die bei <strong>de</strong>r Durchführung<br />
getroffen wer<strong>de</strong>n müssen, zu charakterisieren. Sollen sie als Benutzungsszenarien<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n, beschreiben sie die verwen<strong>de</strong>ten Daten und Informationen (Inhalt,<br />
Format, Quelle und Ziel, Ein-/Ausgabe) und die Benutzungsschnittstelle (Funktionalität,<br />
Ergonomie etc.) sowie Störungen und Mängel im Zuge <strong>de</strong>r betrachteten Tätigkeiten.<br />
Die Szenariotechnik kann <strong>einer</strong>seits dafür genutzt wer<strong>de</strong>n, die aus einem Interview<br />
im Kontext gewonnenen Erkenntnisse über typische Arbeitsabläufe und Probleme bei<br />
<strong>de</strong>r Systembenutzung in <strong>einer</strong> Form zu repräsentieren, 325 die eine leichte Kommunikation<br />
und gute Verständigung mit <strong>de</strong>n NutzerInnen erleichtert. Sie ermöglicht ein schnelles<br />
Feedback von <strong>de</strong>n NutzerInnen an die DesignerInnen, <strong>de</strong>nn die Geschichten<br />
lassen sich leicht korrigieren. Somit eignet sie sich als ein Mittel zur Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse.<br />
Die Szenarien-Metho<strong>de</strong> kann jedoch an<strong>de</strong>rerseits ebenso eingesetzt wer<strong>de</strong>n,<br />
um zu veranschaulichen, wie die zukünftige Technologie aussehen könnte. Denn die<br />
325 Vgl. hierzu etwa Hecht/ Maaß 2008, die eine vergleichbare Kombination von „Contextual Interview“ und<br />
Szenarien-basierter Gestaltung in Lehrveranstaltungen zum „Participatory Design“ in <strong>de</strong>r Informatik<br />
einsetzen.<br />
237
Benutzung <strong>de</strong>s zu entwickeln<strong>de</strong>n Systems kann als erzählen<strong>de</strong> Beschreibung von<br />
Benutzungs-Episo<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r erhobenen Arbeitsabläufe dargestellt wer<strong>de</strong>n,<br />
ohne dass dieses bereits realisiert o<strong>de</strong>r auch nur durch eine Spezifikation festgelegt<br />
wor<strong>de</strong>n wäre. Allerdings fehlen <strong>de</strong>n Szenarien grafische Darstellung und Vollständigkeit<br />
<strong>de</strong>r Systembeschreibung. Ebenso wenig sind die Systemfunktionen daraus direkt<br />
ableitbar. So betonen Kentara Go und John Carroll, dass Szenarien keine Spezifikationen<br />
sind, in<strong>de</strong>m sie Unterschie<strong>de</strong> konkret benennen: „Scenarios are (1) concrete<br />
<strong>de</strong>scriptions, (2) focus on particular instances, (3) work driven, (4) open-en<strong>de</strong>d,<br />
fragmentary, (5) informal, rough, colloquial and (6) envisioned outcomes. In contrast,<br />
specifications are (1) abstract <strong>de</strong>scriptions, (2) focus on generic types, (3) technology<br />
driven, (4) complete, exhaustive, (5) formal, rigorous and (6) specific outcomes.“ (Go/<br />
Carroll 2004, 49) 326 Dennoch sind Szenarien an die herkömmlichen Ansätze <strong>de</strong>r<br />
Software-Entwicklung wie das Requirements-Engineering o<strong>de</strong>r die Objektorientierung<br />
anschlussfähig.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>r Vorteile, leicht und in je<strong>de</strong>r Designphase erstellt wer<strong>de</strong>n zu können<br />
sowie die Verständigung mit <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen zu verbessern, d.h. <strong>de</strong>r Möglichkeit in<br />
einen iterativen Designprozess eingebettet zu wer<strong>de</strong>n, zählt die Szenario-Technik<br />
primär zu <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „User-Centered Design“. Ebenso wie die Erhebungsmetho<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Interviews im Kontext erscheinen sie dann als Teil <strong>einer</strong> De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Strategie geeignet, wenn die Vergeschlechtlichung von Software aufgrund eines mangeln<strong>de</strong>n<br />
Verständnisses von <strong>de</strong>r Arbeit Einzelner droht. Insofern vermögen „Interview<br />
im Kontext“ und Szenariotechnik <strong>de</strong>r ersten Problematik, die durch das Beispiel <strong>de</strong>r<br />
Textverarbeitungssoftware angesprochen wur<strong>de</strong>, das Verständnis und die Anerkennung<br />
<strong>de</strong>r Arbeit <strong>de</strong>r NutzerInnen, zu begegnen. Das zweite Problem, die implizite<br />
Unterstellung, dass Sekretärinnen als Frauen keine technischen Kompetenzen hätten,<br />
wird mit diesen Metho<strong>de</strong>n allerdings nicht explizit adressiert. Rosson und Carroll (2002)<br />
empfehlen zwar eine Vorgehensweise <strong>de</strong>s „Scenario-based Designs“, bei <strong>de</strong>m die<br />
einem Szenario zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Annahmen reflektiert wer<strong>de</strong>n sollen. 327 Sie<br />
erläutern jedoch nicht ausreichend, auf welcher theoretischen Grundlage diese Reflektion<br />
vorgenommen wer<strong>de</strong>n kann. Deshalb fiele TechnikgestalterInnen eine solche<br />
Empfehlung zur Reflektion eigener Selbstverständnisse häufig schwer (vgl. Hecht/<br />
Maaß 2008). Diese Variante <strong>de</strong>s Einsatzes von Szenarien im Technikgestaltungsprozess<br />
ist zwar prinzipiell dafür offen, Stereotypisierungen wie das Vorurteil <strong>de</strong>r Technikinkompetenz<br />
von Frauen zu entlarven und zu vermei<strong>de</strong>n, allerdings erscheinen<br />
an<strong>de</strong>re Metho<strong>de</strong>n hinsichtlich eines De-Gen<strong>de</strong>ring auf dieser Ebene aussichtsreicher.<br />
5.3.2. „Participatory Design“ und „Collective Resource Approach“:<br />
Parteinahme für strukturell Benachteiligte in <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
Ein Ansatz, <strong>de</strong>r explizit einen politischen Standpunkt in <strong>de</strong>r Technikgestaltung vertritt<br />
und dabei teils auch feministische For<strong>de</strong>rungen wie die technische Qualifizierung von<br />
326 Die Beispielhaftigkeit und Konkretheit unterschei<strong>de</strong>t Szenarien ebenso von <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Objektorientierung<br />
genutzten Use Cases. Szenarien liegen auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Instanzen von Use cases, wenngleich sie<br />
eine an<strong>de</strong>re Form haben als ihre Entsprechungen in <strong>de</strong>r OO.<br />
327 Sie schlagen vor, die positiven und negativen Konsequenzen <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Szenarien beschriebenen<br />
Funktionen <strong>de</strong>r Artefakte zunächst herauszuarbeiten und zu bewerten, um auf dieser Grundlage neue<br />
Szenarien zu generieren, vgl. Rosson/ Carroll 2002.<br />
238
Frauen berücksichtigt, ist das Participatory Design <strong>de</strong>r Skandinavischen Tradition. 328<br />
Speziell <strong>de</strong>r „Collective Resource Approach (CRA)“ beansprucht, vermittelt über <strong>de</strong>n<br />
Einsatz von Computern an Arbeitsplätzen für abhängig Beschäftigte Partei zu ergreifen<br />
(vgl. Ehn/ Kyng 1987). 329 Auf <strong>de</strong>r Basis verschie<strong>de</strong>ner politik- und gestaltungsorientierter<br />
Forschungsprojekte 330 wur<strong>de</strong> CRA seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren zu einem eigenständigen<br />
Ansatz ausgearbeitet, <strong>de</strong>r zunächst primär darauf zielte, die Position von<br />
Arbeiten<strong>de</strong>n gegenüber <strong>de</strong>m Management zu stärken, sie zu qualifizieren und insgesamt<br />
eine Demokratisierung <strong>de</strong>s Arbeitslebens („industrial <strong>de</strong>mocracy“, „workplace<br />
<strong>de</strong>mocracy“) zu beför<strong>de</strong>rn. Die Projekte basierten gesellschafts- und techniktheoretisch<br />
auf <strong>de</strong>n damaligen gewerkschaftlichen Positionen. Sie gingen vom Wi<strong>de</strong>rspruch von<br />
Kapital und Arbeit aus und beruhten auf <strong>de</strong>r marxistisch begrün<strong>de</strong>ten Annahme, dass<br />
<strong>de</strong>r Einsatz von Computertechnologie die Beschäftigten <strong>de</strong>qualifiziere, die<br />
Arbeitsteilung verstärke, mehr Routine- und monotone Tätigkeiten hervorbringe und<br />
<strong>de</strong>n Managern mehr Macht und Kontrolle über die Beschäftigten gebe. Dagegen<br />
versuchten die VertreterInnen <strong>de</strong>s CRA zu intervenieren. Tatsächlich gelang ihnen<br />
bereits in <strong>de</strong>n ersten Projekten, betriebliche Vereinbarungen sowie gesetzliche<br />
Vorgaben über die Planung, Kontrolle und Computernutzung bei <strong>de</strong>r Einführung neuer<br />
Technologien zu erreichen. 331 Eine Voraussetzung <strong>de</strong>s Erfolgs war, dass GewerkschaftsvertreterInnen<br />
in kleinen Studiengruppen weitergebil<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, um über diese<br />
Fragen kompetent verhan<strong>de</strong>ln zu können. Die Gewerkschaften wur<strong>de</strong>n somit als eine<br />
grundlegen<strong>de</strong> gesellschaftliche Institution verstan<strong>de</strong>n, welche die Arbeiten<strong>de</strong>n als<br />
Interessengemeinschaft gegenüber <strong>de</strong>n UnternehmerInnen zu repräsentieren vermag.<br />
332 Es zeigte sich jedoch früh, dass die Arbeiten<strong>de</strong>n keine homogene Gruppe<br />
darstellen, in <strong>de</strong>r alle gleichberechtigt sind, son<strong>de</strong>rn dass die Gewerkschaftsorganisation<br />
von Hierarchien durchdrungen ist. Ferner wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich, dass eine starke<br />
gewerkschaftliche Position nicht ausreicht, um alternative Technologien zu entwickeln.<br />
Deshalb konzentrierten sich die nachfolgen<strong>de</strong>n Projekte stärker auf die Arbeitsbedingungen<br />
und -prozesse von Anwen<strong>de</strong>rInnen sowie <strong>de</strong>ren computerbasierte Unterstützung.<br />
Sie richteten sich nach <strong>de</strong>m Grundsatz, Werkzeuge für qualifizierte Arbeit<br />
herzustellen. „The computer should be a tool for the skilled worker, and the worker<br />
328<br />
Vgl. Greenbaum/ Kyng 1991, Kuhn/ Muller 1993, für einen zusammenfassen<strong>de</strong>n Überblick vgl. etwa<br />
Törpel 2005.<br />
329<br />
Ein an<strong>de</strong>rer verwandter Ansatz, <strong>de</strong>r hier nicht betrachtet wer<strong>de</strong>n soll, ist das „Joint Application Design“<br />
(JAD), das insbeson<strong>de</strong>re im nordamerikanischen Raum verbreitet ist.<br />
330<br />
Die ersten und bekanntesten Projekte sind das NJMF-Projekt mit <strong>de</strong>r norwegischen Stahl- und<br />
Metallgewerkschaft (1971-1973), das schwedische DEMOS-Projekt (Democratic Control and Planning in<br />
Work Life: On Computers, Tra<strong>de</strong> Unions and Industrial Democracy), das dänische DUE-Projekt<br />
(Democracy, Development and Electronic Data Processing) sowie etwas später das UTOPIA-Projekt, in<br />
<strong>de</strong>m die Nordische Grafikergewerkschaft mit dänischen und schwedischen Forschungsgruppen<br />
kooperierte. Vgl. dazu zusammenfassend etwa Ehn/ Kyng 1987, Bjerknes/ Bratteteig 1994, 1995.<br />
331<br />
Auch aus <strong>einer</strong> feministischen Perspektive kann es sinnvoll sein, Betriebvereinbarungen anzustreben.<br />
So wur<strong>de</strong> auf diese Weise und mit Hilfe <strong>de</strong>s in Abschnitt 4.2.2 angeführten Projekts in <strong>de</strong>r Bremer<br />
Stadtverwaltung ein Konzept <strong>de</strong>r Mischarbeit eingeführt, welches die Arbeitsbedingungen <strong>de</strong>r vorwiegend<br />
von Frauen reprüäsentierten Beschäftigten strukturell verbesserte, in<strong>de</strong>m die Bürotätigkeiten, die durch<br />
eine starke Zerglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Arbeit, sich wie<strong>de</strong>rholen<strong>de</strong> Tätigkeiten, einförmige Bewegungsabläufe und<br />
eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit gekennzeichnet sind, durch qualifizierte Sacharbeit angereichert<br />
wur<strong>de</strong>n, vgl. Winker 1995.<br />
332<br />
„Collective“ im Titel <strong>de</strong>s CRA be<strong>de</strong>utet, dass es in diesem Ansatz nicht darum geht, Individuen an ihren<br />
Arbeitsplätzen zu unterstützen, son<strong>de</strong>rn ein Kollektiv von abhängig Beschäftigten. Mit Hilfe von Forschung<br />
für die Beschäftigten sollten gemeinsame (Wissens-)„Ressourcen“ geschafften wer<strong>de</strong>n. Dafür wur<strong>de</strong>n die<br />
Gewerkschaften als ein wichtiger Ort angesehen.<br />
239
should be in control of the tool“ (Bjerknes/ Bratteteig 1994, 5). Ziel war es, eine<br />
qualifizierte Arbeit mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen zu ermöglichen sowie eine<br />
<strong>de</strong>mokratische Organisation von Arbeit. Dabei stellte sich heraus, dass, um die<br />
Positionen <strong>de</strong>r jeweils Schwächeren in <strong>de</strong>r Gestaltung von Technologie zu stärken,<br />
nicht nur die hierarchischen Verhältnisse im Anwendungsfeld zu berücksichtigen sind,<br />
son<strong>de</strong>rn auch das Machtgefälle zwischen DesignerInnen und NutzerInnen 333 adressiert<br />
wer<strong>de</strong>n muss. Insbeson<strong>de</strong>re das „Cooperative Design“ beanspruchte, Metho<strong>de</strong>n zu<br />
entwickeln und zu erproben, mit <strong>de</strong>nen sich eine gleichberechtigte Kommunikation<br />
zwischen EntwicklerInnen und NutzerInnen bzw. Arbeiten<strong>de</strong>n herstellen lässt. Die<br />
VertreterInnen wiesen darauf hin, dass es dafür notwendig sei, die Machtpositionen zu<br />
reflektieren, die <strong>de</strong>n Softwareentwicklungs- und <strong>de</strong>n Beteiligungsprozess durchdringen<br />
und <strong>einer</strong> gleichberechtigte Teilhabe an Information und Kommunikation entgegenstehen<br />
können.<br />
Der „Collective Resource Approach“ als <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r wesentlichen partizipativen<br />
Ansätze teilt mit <strong>de</strong>n zuvor betrachteten Ansätzen <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ <strong>de</strong>n<br />
Grundsatz, Arbeit und die fachliche Kompetenz <strong>de</strong>r Arbeiten<strong>de</strong>n als Ausgangspunkt<br />
von Technologiegestaltung zu verstehen. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n allein auf die NutzerInnen<br />
konzentrierten Zugängen, die zumeist auf das Verhältnis von Individuum und<br />
Computer fokussieren, d.h. auf die Unterstützung von EinzelnutzerInnen ausgerichtet<br />
sind, 334 wird hier davon ausgegangen, dass die Beschäftigten <strong>einer</strong>seits ein Kollektiv<br />
bil<strong>de</strong>n und an<strong>de</strong>rerseits Technologie, Arbeit und Organisation voneinan<strong>de</strong>r abhängig<br />
sind und <strong>de</strong>shalb stets nur gemeinsam gestaltet wer<strong>de</strong>n können. Dementsprechend<br />
trägt <strong>de</strong>r „Collective Resource-Ansatz“ <strong>de</strong>n betrieblichen, gesellschaftlichen und<br />
gesetzlichen Rahmenbedingungen auch in <strong>de</strong>n methodischen Konzepten <strong>de</strong>r<br />
Beteiligung <strong>de</strong>r NutzerInnen stärker Rechnung als etwa das „Contextual Design“,<br />
Szenarien-basierte Ansätze und an<strong>de</strong>re Varianten <strong>de</strong>r nutzungszentrierten Gestaltung.<br />
Die grundlegen<strong>de</strong> Annahme <strong>einer</strong> engen Verflochtenheit von organisatorischen, arbeitsbezogenen<br />
und technischen Aspekten teilt <strong>de</strong>r CRA mit <strong>de</strong>m sozio-technischen<br />
Systemgestaltungsansatz, gegenüber <strong>de</strong>m er sich ursprünglich herausgebil<strong>de</strong>t und abgegrenzt<br />
hat. 335 Was <strong>de</strong>n „Collective Resource Approach“ gegenüber <strong>de</strong>n sozio-technischen<br />
und <strong>de</strong>n nutzerInnenzentrierten Ansätzen auszeichnet, ist die Annahme unauflösbarer<br />
gesellschaftlicher Interessenskonflikte und Machtstrukturen, von <strong>de</strong>nen je<strong>de</strong><br />
lokale Situation durchdrungen ist und die <strong>de</strong>shalb auch in je<strong>de</strong>m Technikgestaltungsprozess<br />
sorgfältig zu berücksichtigen seien. Die VertreterInnen <strong>de</strong>s CRA werfen <strong>de</strong>nen<br />
<strong>de</strong>s sozio-technischen Systemgestaltungsansatzes vor, dass sie mit ihren Bemühungen<br />
um Arbeitszufrie<strong>de</strong>nheit und Vereinbarkeit <strong>de</strong>r Interessen von Management und<br />
Beschäftigten eine Harmonieperspektive verfolgten, die gleiche Chancen in Aussicht<br />
stelle. Demgegenüber nähmen sie selbst eine parteiliche Perspektive ein, in<strong>de</strong>m sie<br />
sich innerhalb <strong>de</strong>s Konfliktes auf die Seite <strong>de</strong>r Schwächeren stellten und die Position<br />
333 Bråten 1973 sprach in diesem Zusammenhand von <strong>de</strong>r „Mo<strong>de</strong>llmacht“ <strong>de</strong>r DesignerInnen, die es <strong>de</strong>n<br />
Anwen<strong>de</strong>rInnen erschwert, sich gleichberechtigt in <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess einzubringen.<br />
334 Mit Fragen <strong>de</strong>r technischen Unterstützung von Zusammenarbeit beschäftigt sich das Fachgebiet<br />
„Computer Supported Cooperative Work“, das hier nicht diskutiert wer<strong>de</strong>n kann.<br />
335 Vgl. etwa Mumford 1987 für eine Darstellung <strong>de</strong>r Grundzüge <strong>de</strong>s sozio-technischen Systemgestaltungsansatzes<br />
sowie Schulz-Schaeffer 1994 für eine vergleichen<strong>de</strong> und Bath 2006a für eine feministische<br />
Perspektive.<br />
240
<strong>de</strong>r abhängig Beschäftigten gegenüber Management und UnternehmerInnen zu<br />
stärken suchten.<br />
In dieser politischen Intention lassen sich Parallelen zur feministischen Theorie<br />
erkennen. Der CRA versteht gesellschaftliche Ungleichheitstrukturen als situierte und<br />
geht von einem grundsätzlich unlösbaren Konflikt zwischen UnternehmerInnen und<br />
Beschäftigten aus. Hingegen gehen GeschlechterforscherInnen davon aus, dass<br />
Be<strong>de</strong>utungen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ zwar historisch und kulturell variieren<br />
und Frauen keine homogene Gruppe von Marginalisierten und Männer keine<br />
homogene Gruppe von Privilegierten bil<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn innerhalb verschie<strong>de</strong>ner Ungleichheitsstrukturen<br />
auch unterschiedliche gesellschaftliche Positionen inne haben<br />
können, dass das Zweigeschlechtlichkeitssystem und die strukturell-symbolische<br />
Geschlechterordnung zentrale Merkmale vergangener und aktueller Gesellschaften<br />
sind.<br />
Insgesamt erscheint <strong>de</strong>r „Collective Resource“-Ansatz aufgrund s<strong>einer</strong> <strong>de</strong>zidiert<br />
herrschafts<strong>kritisch</strong>en Ausrichtung und emanzipatorischen Ziele, die Arbeiten<strong>de</strong>n/<br />
NutzerInnen zu qualifizieren, ihnen Teilhabe am Technikentwicklungsprozess zu<br />
ermöglichen und die Systemgestaltung selbst als ein politisches Unterfangen zu<br />
begreifen, beson<strong>de</strong>rs anschlussfähig an feministische Positionen. Zu<strong>de</strong>m stellen die<br />
Prinzipien, <strong>de</strong>nen er folgt, beispielsweise die Grundsätze „<strong>de</strong>sign for skill and<br />
<strong>de</strong>mocracy“, „<strong>de</strong>sign by doing“, „<strong>de</strong>sign as situated” und „<strong>de</strong>sign as mutual learning“, 336<br />
allesamt in einem Kontext von Arbeit, <strong>de</strong>r zutiefst geschlechtlich durchdrungen ist, De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Perspektiven dar. So wirken die Qualifizierung von Frauen und an<strong>de</strong>ren qua<br />
Geschlecht marginalisierten und untergeordneten Gruppen als Beschäftigten und die<br />
Demokratisierung von Arbeit potentiell <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n, strukturell geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung entgegen. „Design-by-Doing“ vermag die Arbeit von qua<br />
Geschlecht marginalisierten und untergeordneten Gruppen anzuerkennen, implizites<br />
Wissen über die Arbeit <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>rInnen aufzu<strong>de</strong>cken und unsichtbare Arbeit auch<br />
körperlich-manuell erfahrbar zu machen. 337 Gegenseitige Lernprozesse zwischen<br />
EntwicklerInnen und Anwen<strong>de</strong>rInnen stehen insbeson<strong>de</strong>re in einem Bereich typischer<br />
Frauenarbeit vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechtsstereotypen Kompetenzzuschreibungen in<br />
Bezug auf das Technische und das Soziale, die in <strong>de</strong>n Fallstudien <strong>de</strong>s letzten Kapitels<br />
herausgearbeitet wur<strong>de</strong>n, diametral entgegen. 338<br />
Um die Prinzipien <strong>de</strong>s CRA in Softwareentwicklungsprojekten praktisch umzusetzen,<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten ein umfangreicher Korpus von Metho<strong>de</strong>n<br />
336 Vgl. dazu ausführlicher Ehn/ Kyng 1987, Greenbaum/ Kyng 1991, Bødker et al. 1993.<br />
337 Vgl. hierzu die vorangegangenen Ausführungen in 5.2 und in diesem Abschnitt.<br />
338 Bestätigt wur<strong>de</strong> dieser letzte Aspekt anhand erster feministischer Projekte „von Frauen für Frauen“ im<br />
CRA, die nicht wie die vorangegangenen Studien auf typische Männerberufe, etwa in <strong>de</strong>r Stahlproduktion<br />
o<strong>de</strong>r im Grafiksatz, fokussierten, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n IT-Einsatz in einem traditionellen Frauenberuf untersuchte.<br />
Das Ziel das FLORENCE-Projekts (vgl. Bjerknes/ Bratteteig 1987, 1994, 1995, Bratteteig 2003) bestand<br />
beispielsweise darin, ein Computersystem für die alltägliche Arbeit von Krankenschwestern zu gestalten,<br />
das auf <strong>de</strong>ren professioneller Sprache und <strong>de</strong>ren professionellen Fähigkeiten beruht. Die Studie betont,<br />
dass Nutzerinnen und EntwicklerInnen ein Wissen und Verständnis <strong>de</strong>s Gegenübers entwickeln müssen,<br />
um miteinan<strong>de</strong>r über <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess kommunizieren zu können. Partizipatives Design in diesem<br />
Sinne be<strong>de</strong>utet in einem Kontext vorwiegend aus Frauen bestehen<strong>de</strong>n Krankenpflegepersonals und<br />
vorwiegend von Männern repräsentierter Entwickler jedoch ten<strong>de</strong>nziell eine technische Qualifizierung von<br />
Frauen und eine kommunikativ-soziale Qualifizierung von Männern.<br />
241
ausgearbeitet. 339 Diese Techniken zur Analyse von Arbeit, Beteiligung von NutzerInnen<br />
am Softwareentwicklungsprozess und Verständigung zwischen Technologiegestalter-<br />
Innen und Anwen<strong>de</strong>rInnen überwin<strong>de</strong>n im Einzelnen nicht nur die im herkömmlichen<br />
Software-Engineering üblichen formalen Darstellungsweisen. Vielmehr wen<strong>de</strong>n sie sich<br />
zugleich gegen das implizite Versprechen herkömmlicher Zugänge, dass es nur einen<br />
„best way“ <strong>de</strong>r Technikgestaltung gäbe. 340 Statt<strong>de</strong>ssen stellt <strong>de</strong>r CRA quasi einen<br />
Werkzeugkasten zur Verfügung und geht davon aus, dass die Wahl <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n und<br />
ihre Kombination stets eine politische ist, die von <strong>de</strong>n konkreten Bedingungen abhängt<br />
(vgl. Törpel 2007). Zu <strong>de</strong>n wesentlichen und vielfach variierten Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s CRA<br />
gehören gegenseitige Befragungen an Arbeitsplätzen, Workshops mit NutzerInnen<br />
(z.B. Zukunftswerkstätten), Metaphern-Design („metaphorical <strong>de</strong>sign“), Organisations-<br />
Designspiele („organisational <strong>de</strong>sign games“), „Mock-ups“ und einfache Prototypen<br />
sowie kooperatives Erstellen von Prototypen („cooperative prototyping“).<br />
Einige dieser Techniken sind vom „Usability“-Engineering, „User-Centered Design“<br />
und <strong>de</strong>r „Human-Computer Interaction“-Forschung aufgegriffen wor<strong>de</strong>n, wo sie mittlerweile<br />
zum Kanon gehören. Das gilt zum einen für die bereits angeführten Metho<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r ethnographisch inspirierten Analyse und <strong>de</strong>s Interviews im Kontext, zum an<strong>de</strong>ren<br />
für Mock-ups, Prototyping-Verfahren und Designspiele wie CARD und PICTIVE, die im<br />
folgen<strong>de</strong>n kurz skizziert wer<strong>de</strong>n sollen. 341<br />
Mock-Ups und einfache Prototypen für frühe Projektphasen, die Gestaltungsi<strong>de</strong>en<br />
erfahrbar machen sollen, wur<strong>de</strong>n Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre im UTOPIA-Projekt (vgl.<br />
Bødker et al. 1987) entwickelt. Die ForscherInnen beschreiben diese als „more or less<br />
sophisticated, like paper boxes representing mouse and laser printers, or large paper<br />
drawings and (later on) sli<strong>de</strong>s showing alternative screen lay-outs“ (Bjerknes/ Bratteteig<br />
1995, 77). Der Vorteil dieser Metho<strong>de</strong> besteht darin, dass die Mo<strong>de</strong>llierung von Arbeit<br />
dabei nicht nur auf Beobachtung und sprachlicher Reflektion beruht, son<strong>de</strong>rn die<br />
Anwen<strong>de</strong>rInnen ihre vor allem handwerklichen Fähigkeiten <strong>de</strong>monstrieren können. Im<br />
Vergleich zu <strong>de</strong>n oben erläuterten ethnografisch inspirierten Verfahren, wie <strong>de</strong>m<br />
Interview im Kontext, kann auf diese Weise implizites Wissen über die Arbeit <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>rInnen<br />
auch auf <strong>de</strong>r körperlich-manuellen Ebene erfahrbar gemacht wer<strong>de</strong>n. 342<br />
Weitere Techniken, die auf Papier-Simulationen beruhen und die NutzerInnen in das<br />
Design zukünftiger Systeme einbeziehen, sind CARD (Collaborative Analysis of Requirements<br />
and Design) (Tudor 1993) und PICTIVE (Plastic Interface for Collaborative<br />
Technology Initiatives through Vi<strong>de</strong>o Exploration) (Muller 1991). Bei CARD wer<strong>de</strong>n von<br />
<strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen Spielkarten kreiert, auf <strong>de</strong>nen sie ihre eigenen Ziele und<br />
Intentionen, mögliche Bildschirmausgaben o<strong>de</strong>r Aufgaben darstellen können. Die<br />
Metho<strong>de</strong> eignet sich dazu, Arbeitsabläufe und ihre technische Unterstützung zu<br />
339 Vgl. Greenbaum/ Kyng 1991, Schuler/ Namioka 1993, Kuhn/Muller 1993 für einen Überblick vgl. etwa<br />
Muller 2003, spezielle methodische Ansätze, die nicht direkt in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>s CRA stehen, wohl aber<br />
von diesem inspiriert sind, stellen STEPS (Floyd et al. 1989) sowie MUST (Bødker et al. 2004) dar.<br />
340 Diese Weigerung, die Vorgehensweise schrittweise klar und strukturiert zu beschreiben, brachte <strong>de</strong>m<br />
Ansatz insbeson<strong>de</strong>re von US-amerikanischer Seite <strong>de</strong>n Vorwurf ein, dass er sich allein auf politische<br />
Dogmen beriefe, methodisch allerdings im Nebulösen verbliebe (vgl. hierzu etwa Asaro 2000) – obwohl<br />
die einzelnen Metho<strong>de</strong>n und ihr Zusammenspiel anhand vieler konkreter Projekte höchst <strong>de</strong>tailliert und<br />
anschaulich erläutert wur<strong>de</strong>n.<br />
341 Diese Metho<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n beispielsweise im „Interaction Design“ (Preece et al. 2002, 2007) und im<br />
„Usability Engineering“ (vgl. Burmester 2007) angeführt.<br />
342 Mock-ups gelten als beispielhafte Veranschaulichung <strong>de</strong>s „Design-by-doing“-Prinzips im CRA.<br />
242
erproben. Bei PICTIVE dagegen wer<strong>de</strong>n einfache Büroutensilien wie Klebezettel und<br />
Stifte benutzt, um bestimmte Bildschirmlayouts zu entwerfen. Ferner wird dabei die<br />
Sitzung, in <strong>de</strong>r die Anwen<strong>de</strong>rInnen zusammen mit <strong>de</strong>n GestalterInnen unterstützt durch<br />
die Utensilien über ein angemessenes Design brainstormen, auf Vi<strong>de</strong>o aufgezeichnet,<br />
um mögliche Darstellungen und Abfolgen <strong>de</strong>s User-interface sowie Entscheidungen zu<br />
dokumentieren und später nachvollziehen zu können. 343 Im Gegensatz zu herkömmlichen<br />
Verfahren, bei <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Prototyp „im Labor“ entwickelt und später von <strong>de</strong>n NutzerInnen<br />
getestet wird, fin<strong>de</strong>n diese Prototyp-Entwicklungen als kooperativer Designprozess<br />
zwischen TechnikgestalterInnen und Anwen<strong>de</strong>rInnen in gemeinsamen<br />
Sitzungen statt.<br />
Während einfache Prototypen und kooperative Designspiele bereits auf <strong>de</strong>m Weg<br />
sind, in <strong>de</strong>n Mainstream <strong>de</strong>r Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik zu gelangen, wo sie<br />
dazu genutzt wer<strong>de</strong>n, die Technologie besser an die zukünftigen NutzerInnen anzupassen,<br />
wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re vom CRA vorgeschlagene Metho<strong>de</strong>n wie kreative, beispielsweise<br />
am Schauspiel orientierte Designspiele und Workshops bzw. Zukunftswerkstätten<br />
dort kaum wahrgenommen. 344 Dabei erlauben gera<strong>de</strong> diese Techniken,<br />
strukturelle Aspekte <strong>de</strong>r Arbeitsorganisation zu betrachten, d.h. auch eine geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Verteilung von Tätigkeiten in <strong>einer</strong> Organisation infrage zu stellen.<br />
Ferner zielen sie darauf strukturell und hierarchisch Benachteiligte – etwa Frauen an<br />
typischen Frauenarbeitsplätzen – zu ermächtigen.<br />
5.3.3. Organisations-Design-Spiele und Zukunftswerkstätten: Geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung in Organisationen aushan<strong>de</strong>ln<br />
Organisations-Design-Spiele (ODS) sind ebenso wie das Interview im Kontext, CARD<br />
und PICTIVE dazu gedacht, die gegenwärtige Arbeit <strong>de</strong>r Anwen<strong>de</strong>rInnen besser zu<br />
verstehen und Verän<strong>de</strong>rungen durch Software in eine realistische, angemessene und<br />
von <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen gewünschte Richtung zu lenken. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n zuvor<br />
skizzierten Metho<strong>de</strong>n, die auf eine adäquate Erfassung <strong>de</strong>r Arbeitsabläufe und eine<br />
Gestaltung <strong>de</strong>r Benutzungsschnittstelle zielen, welche die Arbeitspraktiken angemessen<br />
unterstützt, steht bei <strong>de</strong>n Designspielen darüber hinaus die Arbeitsorganisation im<br />
Mittelpunkt. Während bei ethnografisch inspirierten Metho<strong>de</strong>n die DesignerInnen von<br />
<strong>de</strong>n BenutzerInnen lernen und bei CARD und PICTIVE Abläufe mit einfachen Prototypen<br />
erprobt wer<strong>de</strong>n, sollen im ODS Aspekte <strong>de</strong>r aktuellen und zukünftigen Arbeit<br />
nach <strong>de</strong>m Grundsatz „Playing in reality“ (Ehn et al. 1990) durchgespielt wer<strong>de</strong>n Organisations-Design-Spiele<br />
sind Rollenspiele mit <strong>de</strong>n NutzerInnen. Auch hier wird somit<br />
auf das Wissen, die Erfahrung und vor allem die Kreativität <strong>de</strong>r TeilnehmerInnen<br />
343 Der Unterschied zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n besteht im Detaillierungsgrad. PICTIVE ist auf eine<br />
(mikroskopische) Beschreibung <strong>de</strong>r Systemaspekte ausgerichtet, während CARD eine ausführliche<br />
(makroskopische) Sicht auf <strong>de</strong>n Arbeitsfluss darstellt, insofern lässt es sich auch als eine Konzeptausarbeitung<br />
verstehen. Die Metho<strong>de</strong>n können <strong>de</strong>shalb gut ergänzend eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
344 Von <strong>de</strong>n acht Trends <strong>de</strong>s „Participatory Design“, die Muller 2003 in seinem Überblicksartikel i<strong>de</strong>ntifiziert,<br />
– die Wahl <strong>de</strong>s Schauplatzes <strong>de</strong>r gemeinsamen Arbeit, Workshops, Geschichten (u.a. Szenarien),<br />
EndnutzerInnen-Photographie, Schauspiel, die Herstellung gemeinsamer Sprachen, beschreiben<strong>de</strong> Artefakte<br />
(Mock-ups und Papierprototypen) sowie funktionieren<strong>de</strong> Prototypen – fin<strong>de</strong>n sich speziell die<br />
kreativen Techniken kaum im Mainstream wie<strong>de</strong>r. Speziell Organisations-Design-Spiele o<strong>de</strong>r am Theater<br />
bzw. Film orientierte Spiele, die grundlegen<strong>de</strong>r Bestandteil <strong>de</strong>s „Collective Resource“-Ansatzes sind,<br />
haben bislang kaum über <strong>de</strong>n Skandinavischen Raum hinaus in <strong>de</strong>r nutzungszentrierten Technikgestaltung<br />
Beachtung gefun<strong>de</strong>n.<br />
243
ekurriert. Dabei zeigt die Spielmetapher an, dass das Ermitteln von Anfor<strong>de</strong>rungen<br />
Spaß machen und spielerisch-lustvoll sein soll.<br />
Das Beispiel von Pelle Ehn, Bengt Möllerud und Dan Sjögren 1990 ist zwar recht<br />
alt, gibt aber bis heute einen guten Einblick, wie ein Organizational-Design-Game organisiert<br />
wer<strong>de</strong>n kann. Die Autoren beschreiben einen Spielaufbau und -ablauf für <strong>de</strong>n<br />
Kontext <strong>de</strong>s Desktop Publishing. In <strong>de</strong>r Vorbereitungsphase wird <strong>de</strong>r Spielort gestaltet.<br />
Typische Arbeitssituationen wer<strong>de</strong>n auf großen Papieren visualisiert und im<br />
Hintergrund aufgehängt, um sie während <strong>de</strong>s Spielablaufs in Erinnerung zu behalten.<br />
Ferner wer<strong>de</strong>n Skripte für die professionellen Rollen <strong>de</strong>s Rollenspiels vorbereitet (z.B.<br />
HerausgeberIn, AutorIn und GrafikerIn). Das Spiel selbst wird durch (ebenfalls zuvor<br />
erstellte) Situationskarten gesteuert, die typische Störfälle, Probleme im Ablauf o<strong>de</strong>r<br />
Situationen <strong>de</strong>s Zusammenbruchs beschreiben und von <strong>de</strong>n Teilnehmen<strong>de</strong>n<br />
nacheinan<strong>de</strong>r gezogen wer<strong>de</strong>n. Dazu können die einzelnen RollenspielerInnen Vorschläge<br />
machen, wie sie die beschriebene Situation lösen wür<strong>de</strong>n. Nach <strong>einer</strong> Diskussion<br />
in <strong>de</strong>r Gruppe sollen die TeilnehmerInnen, die entsprechend <strong>de</strong>n gewählten Rollen<br />
agieren, Bedingungen über Vorgehensweisen und Verantwortlichkeiten festlegen.<br />
Nach <strong>de</strong>m Spiel wer<strong>de</strong>n sämtliche besprochenen Bedingungen, Verpflichtungen und<br />
Absprachen für eine zweite Run<strong>de</strong> auf Papier festgehalten und wie<strong>de</strong>rum im Hintergrund<br />
(Spielort) platziert. In diesem zweiten Durchgang sollen die getroffenen Vereinbarungen<br />
entlang <strong>de</strong>r Rollen durchgespielt wer<strong>de</strong>n, wobei neue Situationskarten ins<br />
Spiel kommen und die Spielregeln geän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n können. Abschließend wird ein<br />
Aktionsplan für die Umsetzung <strong>de</strong>r Vorschläge innerhalb <strong>de</strong>r Organisation beschlossen,<br />
bei <strong>de</strong>m die Vereinbarungen systematisiert und nach Priorität geordnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Zusammenfassend basiert das Spiel auf sechs Grundkonzepten: „The playground is a<br />
subjective but collectively negotiated interpretation of the work organization in question.<br />
The professional roles are the union of individual professional ambitions and the need<br />
for qualifications from an organizational perspective. The situation cards introduce<br />
prototypical examples of breakdown situations. Commitments are ma<strong>de</strong> by individual<br />
role players as actions related to a situation card. Conditions for these commitments<br />
are negotiated, and an action plan for the negotiations with the surrounding<br />
organization is formulated. These concepts were used throughout four <strong>de</strong>velopment<br />
steps.“ (Ehn et al. 1990, 110, Hervorhebungen im Original).<br />
Diese Spielregeln sind jedoch nicht als strikte Anweisungen gedacht, son<strong>de</strong>rn als<br />
Inspiration, um geeignete Spiele für die jeweilige Problemstellung und Organisation zu<br />
entwickeln. So wur<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r Tischlerei und <strong>de</strong>r Fabrikhallengestaltung<br />
entsprechend entwickelte Organisations-Design-Spiele vorgeschlagen (vgl. Ehn/ Sjögren<br />
1991). Weitere Umsetzungen <strong>de</strong>s „Design-by-playing“-Ansatzes beziehen sich<br />
weniger auf Rollenspiele, son<strong>de</strong>rn stellen sich in <strong>kritisch</strong>e Traditionen <strong>de</strong>s Schauspiels<br />
wie etwa das Theater <strong>de</strong>r Unterdrückten (Boal 1974) o<strong>de</strong>r wen<strong>de</strong>n Tableau-Techniken<br />
an (vgl. Muller 2002 für einen Überblick). Gemeinsam ist diesen Metho<strong>de</strong>n, dass<br />
<strong>einer</strong>seits die bestehen<strong>de</strong> Arbeitsorganisation erfasst wer<strong>de</strong>n kann. An<strong>de</strong>rerseits<br />
können zukünftige Möglichkeiten <strong>de</strong>r Organisation von Arbeit inklusive ihrer technischen<br />
Unterstützung spielerisch erprobt wer<strong>de</strong>n, auch um kreativ alternative Lösungen<br />
zu fin<strong>de</strong>n, die sich wie<strong>de</strong>rum im Durchspielen auf ihre Praktikabilität hin überprüfen<br />
lassen. Organisations-Design-Spiele bieten dabei prinzipiell insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>njenigen,<br />
die sonst keine Stimme haben o<strong>de</strong>r nicht gehört wer<strong>de</strong>n, die Möglichkeit, Arbeit,<br />
244
Organisation und Technik mitzugestalten und sind damit an feministische Ansätze<br />
anschlussfähig. Vor allem aber stellen sie mit ihrem starken Fokus auf die Gestaltung<br />
gesellschaftlicher Organisation von Arbeit, betrieblicher Arbeitsteilung sowie Arbeitsbeziehungen<br />
und Kooperationsprozesse in Aussicht, Aspekte <strong>de</strong>r strukturell geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung im Anwendungsbereich zu adressieren, die mittels <strong>de</strong>r<br />
bislang diskutierten Metho<strong>de</strong>n nicht ansprechbar sind. 345 Die Metho<strong>de</strong> bietet damit<br />
einen Zugang zu <strong>de</strong>r Problematik <strong>de</strong>r Festschreibung geschlechtlich kodierter<br />
Strukturen in und durch IT, die im Kapitel 4.2.2 diskutiert wor<strong>de</strong>n sind. Denn auf diese<br />
Weise ließe sich in Abhängigkeit von <strong>de</strong>n nationalstaatlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen<br />
etwa in bestimmte Ausschnitte <strong>de</strong>s Gefüges von Gesundheitssystemen,<br />
beispielsweise <strong>de</strong>n Verhältnissen zwischen PatientInnen und ÄrztInnen und<br />
Krankenkassen o<strong>de</strong>r zwischen KrankenpflegerInnen und ÄrztInnen gesellschafts<strong>kritisch</strong><br />
und feministisch intervenieren.<br />
Auch an<strong>de</strong>re Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s CRA vermögen bereits vorgefasste I<strong>de</strong>en über <strong>de</strong>n<br />
Einsatz und Nutzen von Software vermittelt über die Partizipation von NutzerInnen<br />
tiefer gehend infrage zu stellen, als nur hinsichtlich <strong>de</strong>s Designs <strong>de</strong>r Benutzungsschnittstelle<br />
und <strong>de</strong>s reibungslosen Ablaufs computergestützter Arbeitsschritte. Dazu<br />
gehören etwa Workshops mit <strong>de</strong>n BenutzerInnen, die im Participatory Design häufig<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n, um Interessenkonflikte zu thematisieren und Probleme, Ziele und<br />
Strategien von VertreterInnen verschie<strong>de</strong>ner Interessengruppen („stakehol<strong>de</strong>r“) zu<br />
diskutieren. 346 Das in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung bekannteste Workshop-Format sind<br />
die Zukunftswerkstätten (Jungk/ Müllert 1989), die ursprünglich entwickelt wur<strong>de</strong>n, um<br />
<strong>de</strong>njenigen, die sonst nicht gefragt wer<strong>de</strong>n, z.B. BürgerInneninitiativen, einen Raum zur<br />
kreativen Lösung gesellschaftlicher Probleme in Bereichen wie <strong>de</strong>r Stadtplanung und<br />
<strong>de</strong>m Umweltschutz zu geben. Als ein erfahrungsbasiertes, teilnehmerInnen- und handlungsorientiertes<br />
Konzept soll es die TeilnehmerInnen zur Eigeninitiative und Übernahme<br />
von Verantwortung für die Zukunft anregen. Zukunftswerkstätten sind methodisch<br />
klar strukturiert. Eingebettet in eine Vor- und Nachbereitung, in <strong>de</strong>r die TeilnehmerInnen<br />
sich kennen lernen bzw. nachfolgen<strong>de</strong> Schritte klären, glie<strong>de</strong>rn sie sich in drei<br />
Phasen: eine Kritikphase, eine Utopiephase und eine Verwirklichungsphase. In <strong>de</strong>r<br />
Kritikphase wer<strong>de</strong>n Probleme, Kritikpunkte und negative Erfahrungen stichpunktartig<br />
gesammelt und thematisch geordnet. Ausgewählten Schwerpunkten wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
anschließen<strong>de</strong>n Utopiephase Wünsche, Träume und Visionen <strong>de</strong>r TeilnehmerInnen<br />
entgegengesetzt. In <strong>de</strong>r Verwirklichungsphase wie<strong>de</strong>rum soll die Verbindung von <strong>de</strong>r<br />
Utopie zum Realen hergestellt wer<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m konkrete und praktische Schritte zur<br />
Umsetzung <strong>de</strong>r Visionen entwickelt wer<strong>de</strong>n. Eine wesentliche Rolle im Gruppenprozess<br />
nimmt die Mo<strong>de</strong>rationsperson ein, die für die Einhaltung grundlegen<strong>de</strong>r Regeln<br />
wie die Ausrichtung auf das Konkrete, das Zulassen von Visionen, aber auch das<br />
Unterbin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Diskussion einzelner Beiträge bzw. von Metakommunikation zuständig<br />
ist. Ziel ist es, je<strong>de</strong>r TeilnehmerIn in allen Phasen die Chance zur Äußerung bzw.<br />
Stellungnahme zu geben. Dabei wirken die vorgesehenen strikten Re<strong>de</strong>zeitbegrenzungen<br />
geschlechtstypischem Kommunikationsverhalten entgegen. Insgesamt stellen<br />
345<br />
Mir ist jedoch keine Fallstudie bekannt, in <strong>de</strong>r die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Organisations-Design-Spiele zu diesem<br />
Zweck eingesetzt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
346<br />
Zum Design mit Metaphern, das ebenfalls zu CRA gehört und grundsätzlichere Fragen aufwerfen kann<br />
vgl. auch die Ausführungen im Abschnitt 5.5.<br />
245
Zukunftswerkstätten eine strukturierte Brainstorming-Metho<strong>de</strong> dar, in <strong>de</strong>r ein<br />
spezifisches Problem in Gruppen von 10 bis 30 TeilnehmerInnen mit ein bis zwei<br />
Mo<strong>de</strong>ratorInnen über mehrere Stun<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r Tage nach basis<strong>de</strong>mokratischen Prinzipien<br />
bearbeitet wird.<br />
Zukunftswerkstätten wur<strong>de</strong>n für die Systementwicklung erstmals von Finn Kensing<br />
(1987) vorgeschlagen (siehe auch Kensing/ Madsen 1991). Doch auch das kooperative<br />
Design (Bødker et al. 1993) sieht etwa vor, nach <strong>einer</strong> Arbeitsanalyse und vor <strong>de</strong>m<br />
Designprozess im engeren Sinne eine Zukunftswerkstatt mit <strong>de</strong>n NutzerInnen<br />
durchzuführen. Ebenso wie die bisher vorgestellten Techniken kann die Metho<strong>de</strong> dazu<br />
beitragen, NutzerInnen am Technikgestaltungsprozess zu beteiligen, da in <strong>de</strong>r<br />
Alltagssprache kommuniziert wird und auf die Probleme, Bedürfnisse und Visionen<br />
realer NutzerInnen fokussiert wird. Sie ermöglicht sogar in <strong>einer</strong> noch früheren Phase<br />
als die papierbasierten Prototypen eine partizipative Intervention, da mit ihrer Hilfe<br />
neue Problem<strong>de</strong>finitionen und grundsätzliche Designi<strong>de</strong>en entwickelt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Da sie thematisch offen und nicht auf <strong>de</strong>n Kontext von Arbeit beschränkt ist, könnte sie<br />
somit auch in Fällen wie <strong>de</strong>n intelligenten Häusern eingesetzt wer<strong>de</strong>n, um Hausarbeit<br />
bei <strong>de</strong>r Technikgestaltung zu berücksichtigen. Für <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r Erwerbsarbeit wird<br />
sie vor allem dann empfohlen, wenn durch <strong>de</strong>n Einsatz von Technologien gravieren<strong>de</strong><br />
Än<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Arbeitsabläufe und <strong>de</strong>r Organisationsstruktur eingeführt wer<strong>de</strong>n<br />
sollen. Damit bietet sie <strong>de</strong>n Vorteil, dass auch auf <strong>de</strong>r Ebene von geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r<br />
Arbeitsteilung Einfluss genommen wer<strong>de</strong>n kann. Festschreibungen gesellschaftlicher<br />
und betrieblicher Geschlechterhierarchien durch die Software, wie im Fall<br />
<strong>de</strong>s Krankenpflegepersonals und an<strong>de</strong>rer typischer Frauenberufe im Kapitel 4<br />
beschrieben, können auf diese Weise bereits in <strong>de</strong>r Phase <strong>de</strong>r Konzeptualisierung<br />
eines neuen Systems o<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>ssen Re-Design im Prinzip vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.<br />
Allerdings kann die Methodik keine Analyse <strong>de</strong>r im spezifischen Fall vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Zweigeschlechtlichkeit konstituieren<strong>de</strong>n Praktiken und Strukturen leisten, insbeson<strong>de</strong>re<br />
wenn diese komplexer Natur sind. An<strong>de</strong>rs als die bisher vorgestellten Verfahren<br />
grün<strong>de</strong>t diese Möglichkeit jedoch nicht nur auf <strong>einer</strong> geschlechter<strong>kritisch</strong>en Perspektive<br />
<strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen, die als Mo<strong>de</strong>ratorInnen zu <strong>einer</strong> neutralen Rolle gegenüber<br />
<strong>de</strong>m verhan<strong>de</strong>lten Problem verpflichtet sind. Vielmehr hängt es hier zugleich von <strong>de</strong>n<br />
TeilnehmerInnen und ihrem spezifischen Hintergrund ab, ob feministische Fragestellungen<br />
in <strong>de</strong>r Kritik, Vision und Verwirklichung thematisiert wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r nicht. Sie<br />
erscheint vor allem dann als De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie viel versprechend, wenn die<br />
GestalterInnen feministische Ziele verfolgen und die BenutzerInnen vorwiegend abhängig<br />
Beschäftigten sind, die in betrieblichen Hierarchieverhältnissen stehen.<br />
Ob jedoch in <strong>de</strong>mokratisch organisierten Workshops generierte Vorschläge am<br />
En<strong>de</strong> tatsächlich in Software umgesetzt wer<strong>de</strong>n, hängt von vielen weiteren Umstän<strong>de</strong>n<br />
ab, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r generellen Unterstützung durch das auftraggeben<strong>de</strong> Management.<br />
Kensing und Madsen erwähnen eine Reihe von praktischen Problemen bei <strong>de</strong>r<br />
Umsetzung von Zukunftswerkstätten, beispielsweise <strong>de</strong>n Zeitdruck, die Auswahl <strong>de</strong>r<br />
TeilnehmerInnen und die Schwierigkeit, dass die Mo<strong>de</strong>ratorInnen die Gruppe inspirieren<br />
sollen, ohne zu manipulieren (vgl. Kensing/ Madsen 1991, 167). An<strong>de</strong>re kritisieren<br />
die Metho<strong>de</strong> als zu diskurslastig: „Future workshops are purely intellectual/reflective<br />
and <strong>de</strong>tached from the practice they are meant to change – the discussions are about<br />
the practice, not in the practice“ (Mogensen 1991, 45). Diesem Argument lässt sich hier<br />
246
sicherlich insoweit folgen, als dass eine reine Diskursivierung nicht ausreicht, um<br />
alternative bzw. „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ zu produzieren. Dennoch lassen sich<br />
gera<strong>de</strong> Geschlechtseinschreibungen – wie das Kapitel 4 gezeigt hat – nicht durch<br />
Praktiken, die allein auf Alltagswissen beruhen, begegnen. Vielmehr ist hierzu ein<br />
grundlegen<strong>de</strong>s Wissen über Geschlechterverhältnisse und hegemoniale Geschlechtersymbolisierungen<br />
notwendig. Im Gegensatz zu an<strong>de</strong>ren bislang diskutierten Ansätzen<br />
liegt jedoch gera<strong>de</strong> in Bezug auf Workshops und die kooperative Gestaltung von<br />
Software mit NutzerInnen eine Reihe von Erfahrungen in feministischen Projekten vor.<br />
5.3.4. Projekte „von und für Frauen“: Erfahrungen mit Qualifizierung,<br />
betrieblichem und technischem Empowerment in <strong>de</strong>r Praxis<br />
Seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren wur<strong>de</strong>n immer wie<strong>de</strong>r partizipative Softwareentwicklungsprojekte<br />
mit Frauen durchgeführt, die in Bereichen so genannter typischer Frauenarbeit<br />
tätig waren. 347 Diese <strong>de</strong>uteten die Parteinahme <strong>de</strong>s CRA für die strukturell Schwächeren<br />
im Sinne dieser Nutzerinnen. Bereits in <strong>de</strong>n frühen Projekten wur<strong>de</strong> dabei <strong>de</strong>utlich,<br />
dass in Bereichen wie <strong>de</strong>r Büroarbeit, Krankenpflege und Bibliothek nicht nur die<br />
betrieblichen Hierarchien, son<strong>de</strong>rn zugleich die Beziehungen zwischen EntwicklerInnen<br />
und Anwen<strong>de</strong>rInnen zutiefst von <strong>de</strong>r strukturell-symbolischen Geschlechterordnung<br />
geprägt sind. Deshalb zielten die Vorhaben sowohl auf <strong>de</strong>r organisatorischen Ebene<br />
wie in technischer Hinsicht auf ein Empowerment <strong>de</strong>r Frauen..<br />
So trat etwa das britische „City Library“-Projekt in öffentlichen Bibliotheken (Green et<br />
al. 1993b) mit <strong>de</strong>m Anspruch an, bestehen<strong>de</strong> involvement by the participants in<br />
working on an agenda which they <strong>de</strong>fine themselves. The groups can provi<strong>de</strong> a basis<br />
for the process which Ungleichheitsstrukturen zwischen TechnikexpertInnen und<br />
NichtexpertInnen sowie zwischen Management und Arbeiten<strong>de</strong>n in Frage zu stellen.<br />
Dort wur<strong>de</strong>n keine Zukunftswerkstätten, aber ein an<strong>de</strong>res Verfahren <strong>de</strong>r Gruppenarbeit<br />
mit Nutzerinnen, die so genannten „Study Circles“, die ebenfalls zum Metho<strong>de</strong>nrepertoire<br />
<strong>de</strong>s Collective Resource Ansatzes zählen, erfolgreich eingesetzt, um die Interessen<br />
von Frauen als Bibliothekangestellten in die Systemgestaltung einzubringen und<br />
eine Kooperationsebene mit <strong>de</strong>n EntwicklerInnen zu etablieren. „In contrast with<br />
management-inspired ‚quality circles‘, study circles emphasize active feminists would<br />
call ‚consciousness-raising‘: sharing and comparing experiences in or<strong>de</strong>r to raise<br />
questions and <strong>de</strong>velop new un<strong>de</strong>rstandings.“ (Green et al. 1993b, 133). Der Einsatz<br />
von „study circles“ erschien in diesem Projekt beson<strong>de</strong>rs geeignet, da die Vorstellungen<br />
über die zukünftige Computerunterstützung von Ambivalenz und Unsicherheit<br />
geprägt waren und die Prioritäten und Anfor<strong>de</strong>rungen an das System noch festgelegt<br />
wer<strong>de</strong>n mussten. Die Metho<strong>de</strong> lud die weiblichen Bibliotheksangestellten dazu ein „to<br />
review their own working knowledge and experience, and to use it actively in assessing<br />
new library system possibilities“ (ebd.), anstatt auf die I<strong>de</strong>en und Vorschläge an<strong>de</strong>rer –<br />
etwa Vorgesetzter o<strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen – nur zu reagieren. Die ForscherInnen,<br />
die das Projekt begleiteten, betonen allerdings, dass Erfolg und Grenzen <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong><br />
stark von <strong>de</strong>n organisatorischen Rahmenbedingungen abhängen. So sollten die „study<br />
347 Das früheste Software-Projekt dieser Art ist das norwegische FLORENCE-Projekt zur Unterstützung<br />
<strong>de</strong>r Zusammenarbeit von Krankenschwestern, vgl. Bjerknes/ Bratteteig 1986, 1987 sowie <strong>de</strong>n letzten<br />
Abschnitt zum „Participatory Design“.<br />
247
circles“ während <strong>de</strong>r Arbeitszeit stattfin<strong>de</strong>n, vom Management unterstützt und die<br />
erarbeiteten Vorschläge von <strong>de</strong>n EntscheidungsträgerInnen anerkannt wer<strong>de</strong>n (vgl.<br />
ebd., 149).<br />
Auf diese Voraussetzungen für einen för<strong>de</strong>rlichen Beteiligungsprozess weisen auch<br />
die Erfahrungen in einem finnischen Projekt mit Büroangestellten (Vehviläinen 1991)<br />
hin, in <strong>de</strong>m ebenfalls Arbeitskreise („Study Circels“) eingerichtet wur<strong>de</strong>n, um die<br />
Handlungsmöglichkeiten <strong>de</strong>r Beschäftigten zu erweitern. „Hauptaufgabe <strong>de</strong>r Gruppe<br />
war die Analyse <strong>de</strong>r Arbeitsprozesse. Die Gruppe traf sich wöchentlich für zwei<br />
Stun<strong>de</strong>n. Im ersten Schritt wur<strong>de</strong>n die Möglichkeiten künftiger Informationssysteme mit<br />
Bezug zur täglichen Arbeit thematisiert. In einem zweiten Schritt begannen die Frauen<br />
technische Konzepte in ihrer eigenen Sprache zu formulieren. Im dritten Schritt<br />
diskutierten die Frauen ihre technischen Fragen und Probleme mit Experten, die nicht<br />
<strong>de</strong>r Gruppe angehörten“ (vgl. Hammel 2003, 85). Mit dieser Arbeitsweise waren die<br />
zukünftigen Anwen<strong>de</strong>rInnen zwar darin erfolgreich, konkrete Vorschläge zur IT-Unterstützung<br />
ihrer Tätigkeiten zu machen. Die (sich ausschließlich aus Männern zusammensetzen<strong>de</strong>n)<br />
Softwareentwickler ignorierten jedoch schlichtweg die von <strong>de</strong>r Gruppe<br />
erarbeiteten Verän<strong>de</strong>rungsvorschläge. Somit wur<strong>de</strong> die bestehen<strong>de</strong> geschlechtshierarchische<br />
Arbeitsteilung aufrechterhalten und <strong>de</strong>r hohe Status von SoftwareentwicklerInnen<br />
vermittelt über <strong>de</strong>n Technikentwicklungsprozess wie<strong>de</strong>rhergestellt.<br />
Vehviläinens Studie bestätigt die Relevanz <strong>de</strong>r Rahmenbedingungen für die<br />
erfolgreiche Umsetzung methodischer Konzepte in <strong>de</strong>r Praxis. In diesem Fall ist zu<br />
berücksichtigen, dass die Forscherin mit Frauen als Büroarbeitskräften zusammenarbeitete,<br />
um herauszufin<strong>de</strong>n, ob diese selbst Entwicklungsarbeit im Rahmen ihrer<br />
Tätigkeit leisten können. Dass ihre Fragestellung we<strong>de</strong>r vom Management noch von<br />
<strong>de</strong>n technischen EntwicklerInnen unterstützt wur<strong>de</strong>, erklärt <strong>de</strong>n wirksamen Wi<strong>de</strong>rstand<br />
gegen die Vorschläge <strong>de</strong>r Beschäftigten, die zu<strong>de</strong>m auf grundlegen<strong>de</strong> Verän<strong>de</strong>rungen<br />
in Organisation und Arbeitsstrukturen zielten. Verschie<strong>de</strong>ne <strong>kritisch</strong>e Studien über<br />
Software-Entwicklungsprojekte haben Probleme aufgezeigt, Partizipation in <strong>de</strong>r Praxis<br />
umzusetzen. So wür<strong>de</strong> statt <strong>de</strong>r Beschäftigten oft nur das Management in Softwareentwicklungsprozesse<br />
einbezogen, die vorgefun<strong>de</strong>ne organisatorische und hierarchische<br />
Struktur wer<strong>de</strong> nicht hinterfragt, bestehen<strong>de</strong> Normen verstärkt und Konflikte<br />
ignoriert (vgl. etwa Green et al. 1991). GeschlechterforscherInnen haben darüber<br />
hinaus darauf verwiesen, dass die Autorität und <strong>de</strong>r Status <strong>de</strong>s Wissens von Anwen<strong>de</strong>rInnen,<br />
insbeson<strong>de</strong>re von Frauen, durch technisches Expertentum, das zumeist in<br />
<strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n von Männern liegt, in <strong>de</strong>r Praxis häufig abgewertet wird (vgl. etwa<br />
Suchman/ Jordan 1989). Insofern stellt sich die Frage nach <strong>de</strong>m Zusammenhang von<br />
Beteiligungsprozessen, Geschlechterhierarchie und Geschlechter-Technik-Verhältnissen.<br />
Inwieweit kann eine Partizipation von Frauen als Beschäftigten am Softwareentwicklungsprozess,<br />
die eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen NutzerInnen<br />
und ExpertInnen anstrebt, dazu beitragen, geschlechtshierarchischen Strukturen am<br />
Arbeitsplatz entgegenzuwirken und sie technologisch zu ermächtigen?<br />
Eine jüngere Studie von Martina Hammel (2003) bestätigt das allgemeine Ergebnis,<br />
dass <strong>de</strong>r Erfolg partizipativer Maßnahmen von <strong>de</strong>n Rahmenbedingungen, insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rung durch das Management abhängt, sie lotet dabei jedoch genau die<br />
Beziehung von Beteiligung und verschie<strong>de</strong>nen Aspekten <strong>de</strong>r Geschlechterordnung<br />
aus. Sie untersuchte zwei Partizipationsprojekte mit Frauen, bei <strong>de</strong>nen eine Reihe<br />
248
mittlerweile bekannter Mängel in Beteiligungsverfahren vermie<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong>n<br />
die für das Softwareprojekt ausgewählten Benutzerinnen für die Zeit <strong>de</strong>r Projektarbeit<br />
von ihren sonstigen Aufgaben freigestellt. Sie erhielten projektbezogene Qualifizierungen<br />
sowie ein Stimmrecht im Entscheidungsgremium. 348 Darüber hinaus wur<strong>de</strong> die<br />
Position <strong>de</strong>r Benutzerinnen gegenüber <strong>de</strong>r von Männern dominierten Gruppe <strong>de</strong>r Entwickler<br />
gestärkt, in<strong>de</strong>m sie Anfor<strong>de</strong>rungen an das System in <strong>de</strong>r Gruppe – ähnlich <strong>de</strong>n<br />
„Study Circles“ – eigenständig kooperativ bzw. ohne formale Hierarchien erarbeiten<br />
konnten. Bei Verhandlungen mit <strong>de</strong>n Entwicklern wur<strong>de</strong>n sie durch Beraterinnen eines<br />
Frauensoftwarehauses darin unterstützt, ihre Interessen zu vertreten und eine aktive<br />
Rolle zu übernehmen. Hammel betont, dass die Projekte, obwohl sie „im täglichen<br />
Leben“ unter zeitlichen Restriktionen und erfolgsrelevanten Kriterien stattfan<strong>de</strong>n, in<br />
Bezug auf die Partizipation <strong>de</strong>r NutzerInnen am Softwareentwicklungsprozess einen<br />
nahezu vorbildlichen Charakter hatten (vgl. ebd., 113). Mit Hilfe <strong>de</strong>s Beteiligungsmo<strong>de</strong>lls,<br />
<strong>de</strong>s Entscheidungsgremiums und weiterer Elemente gelang es, die zentralen<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Benutzerinnen in Bezug auf Arbeitsabläufe, -organisation und<br />
Benutzungsschnittstelle adäquat zu erfassen und dabei zugleich eine gewisse Flexibilität<br />
<strong>de</strong>r Software zu gewährleisten. Nach Einschätzung <strong>de</strong>r Beteiligten wäre eine<br />
solch gute Anpassung an die realen Arbeitserfor<strong>de</strong>rnisse ohne die mittels <strong>de</strong>r<br />
genannten Maßnahmen sicher gestellte aktive Partizipation <strong>de</strong>r Benutzerinnen nicht<br />
möglich gewesen. Hammels Untersuchung geht jedoch über die Frage <strong>de</strong>r adäquaten<br />
Ermittlung von Anfor<strong>de</strong>rungen und passen<strong>de</strong>n Benutzungsschnittstellen durch Partizipation<br />
hinaus. Vielmehr arbeitet sie anhand von Interviews mit <strong>de</strong>n Benutzerinnen<br />
heraus, inwieweit, aufgrund <strong>de</strong>r eingesetzten partizipativen Maßnahmen die<br />
Geschlechterordnung aufgebrochen wer<strong>de</strong>n konnte und wo in dieser Hinsicht Grenzen<br />
<strong>de</strong>s Ansatzes bestehen. Sie zeigt damit die Vielfältigkeit <strong>de</strong>r Effekte von Technikentwicklungsprozessen<br />
auf Geschlechteraspekte auf.<br />
Bei<strong>de</strong> Fallstudien fokussierten auf <strong>de</strong>n Nutzungskontext eines traditionellen<br />
Frauenerwerbsbereiches, <strong>de</strong>r durch einen niedrigen Status und geringe Entscheidungsspielräume<br />
gekennzeichnet ist. Im Vergleich zu dieser Position in <strong>de</strong>r innerbetrieblichen<br />
Hierarchie bekamen die beteiligten Benutzerinnen innerhalb <strong>de</strong>s Softwareentwicklungsprojekts<br />
eine neue Rolle zugewiesen. Sie konnten nun selbstständig,<br />
verantwortungsvoll und konzeptionell arbeiten, Entscheidungen treffen und erhielten<br />
somit einen höheren Status – eine Arbeitsweise und Position, die die Nutzerinnen<br />
fachlich als Bereicherung und Bestärkung empfan<strong>de</strong>n und gern fortgesetzt hätten. Die<br />
betriebliche Hierarchie, die grundlegend auf <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung basiert, wur<strong>de</strong> somit während <strong>de</strong>r Entwicklungszeit ein Stück<br />
weit außer Kraft gesetzt. Jedoch zeigen die empirischen Ergebnisse, dass die Logik<br />
<strong>de</strong>r Projektorganisation mit <strong>de</strong>r Logik <strong>de</strong>r betrieblichen Organisation kollidieren kann,<br />
wenn die Vorgesetzten die neue, starke Rolle <strong>de</strong>r Benutzerinnen nicht akzeptieren.<br />
„Das Beteiligungsmo<strong>de</strong>ll löst die Benutzerinnen <strong>einer</strong>seits aus <strong>de</strong>m hierarchischen<br />
Gefüge <strong>de</strong>r betrieblichen Organisation heraus, an<strong>de</strong>rerseits wirken die festgefahrenen<br />
Strukturen, personifiziert in einigen fachlichen Vorgesetzten, weiter.“ (Hammel 2003,<br />
156). Ein herkömmlicher, hierarchischer Führungsstil behin<strong>de</strong>re <strong>de</strong>shalb nicht nur <strong>de</strong>n<br />
348 Hingegen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>n EntwicklerInnen in <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r Fallstudien lediglich ein Anhörungsrecht, eine<br />
Berichtspflicht, aber keine Stimmberechtigung zugestan<strong>de</strong>n, vgl. Hammel 2003, 167.<br />
249
Partizipationsprozess. Er stelle die Benutzerinnen vor die doppelte Herausfor<strong>de</strong>rung,<br />
neue, ungewohnte Aufgaben erfüllen zu müssen und ihre im Beteiligungsmo<strong>de</strong>ll<br />
vorgesehene Position immer wie<strong>de</strong>r neu erkämpfen zu müssen.<br />
In ähnlicher Weise kontextabhängig <strong>de</strong>utet Hammel das Aufbrechen geschlechtlich<br />
geprägter Beziehungsmuster zwischen Entwicklern und Benutzerinnen sowie das<br />
technische Empowerment von Frauen als Beschäftigten in <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Projekten. So<br />
gab das formale Beteiligungsmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>n Frauen zwar mehr Entscheidungsmacht als in<br />
herkömmlichen Verfahren und entwickelten, unterstützt durch die Beraterinnen, im<br />
Laufe <strong>de</strong>s Prozesses ein fachliches wie technisches Selbstbewusstsein. Die Benutzerinnen<br />
lernten die technischen Inhalte zu verstehen, um mit <strong>de</strong>n Entwicklern diskutieren<br />
zu können, sie gewannen ein Verständnis für die technischen Möglichkeiten, um<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen an die neue Software überzeugt zu formulieren, und entwickelten<br />
Selbstbewusstsein, um die erarbeiteten Anfor<strong>de</strong>rungen gegenüber <strong>de</strong>n Entwicklern<br />
und Vorgesetzten vertreten zu können. Auch über <strong>de</strong>n Austausch und die Arbeit in <strong>de</strong>r<br />
Gruppe entwickelten sie eine Stärke gegenüber <strong>de</strong>n Technikern.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Kommunikation mit <strong>de</strong>n Entwicklern weiterhin höchst<br />
stereotype Verhaltensmuster zwischen Frauen und Männern reproduziert. So wur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>utlich, dass die Entwickler keine verständlichen Erklärungen gaben, die eigene technische<br />
Kompetenz häufig überschätzten und die <strong>de</strong>r Benutzerinnen unterschätzten.<br />
„Während die Frauen […] Verständnis für aus ihrer Sicht unakzeptable Verhaltensweisen<br />
zeigen und sich in die ‚Welt <strong>de</strong>r Entwickler‘ einarbeiten, wird für die<br />
Benutzerinnen kein ‚Auf-sie-zukommen‘ <strong>de</strong>r Entwickler erkennbar“ (Hammel 2003,<br />
148). Einige Frauen befürchteten „dumme Fragen“ zu stellen, an<strong>de</strong>re hatten durch die<br />
technische Qualifizierung mehr Selbstsicherheit gewonnen und ließen „Besserwisser“<br />
mit dominantem Verhalten in <strong>de</strong>n Entscheidungsgremien auflaufen. Bemerkenswert<br />
erscheint, dass diese höchst geschlechtsstereotypen Verhaltensweisen von <strong>de</strong>n<br />
Interviewten als individuelle Strategien interpretiert wur<strong>de</strong>n und nicht als ein Ausdruck<br />
<strong>de</strong>s symbolischen Geschlechter-Technik-Verhältnisses. Deshalb erscheint es<br />
wesentlich, solche Vorstellungen, welche die Begegnungen im Softwareentwicklungsprozess<br />
prägen, aus <strong>einer</strong> Geschlechterperspektive gemeinsam zu reflektieren. In<br />
<strong>de</strong>n Projekten wur<strong>de</strong>n Reflektionsanteile durch die Beraterinnen eines Frauensoftwarehauses<br />
eingebracht, die sowohl während <strong>de</strong>r Qualifizierungssitzungen und bei <strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>ration <strong>de</strong>r Benutzerinnen-Workshops in <strong>de</strong>r Gruppe als auch in <strong>de</strong>r Kommunikation<br />
mit <strong>de</strong>n Entwicklern auf strukturelle und vergeschlechtlichte Aspekte aufmerksam<br />
machten. In einem <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Projekte wur<strong>de</strong> darüber hinaus eine „Qualifizierung zur<br />
Beteiligung“ durchgeführt, in <strong>de</strong>r Problematiken <strong>de</strong>r Kommunikation zwischen TechnikgestalterInnen<br />
und BenutzerInnen einschließlich ihrer geschlechtlichen Dimensionen<br />
thematisiert wer<strong>de</strong>n konnten. 349<br />
Hammels Untersuchung ver<strong>de</strong>utlicht, dass in einem Partizipationsprozess mit<br />
Benutzerinnen aus einem Bereich traditioneller Frauenerwerbsarbeit min<strong>de</strong>stens drei<br />
verschie<strong>de</strong>ne Hierarchieverhältnisse Beachtung fin<strong>de</strong>n müssen: die strukturelle Ebene<br />
349 Die Studie verweist auf zwei weitere Bedingungen von Partizipationsprojekten mit Frauen, für die keine<br />
intervenieren<strong>de</strong>n Maßnahmen angegeben wer<strong>de</strong>n. Einerseits können strukturelle Voraussetzungen wie<br />
die traditionelle Zuständigkeit für Familie und Beziehung das zeitliche Engagement <strong>de</strong>r Benutzerinnen<br />
begrenzen. An<strong>de</strong>rerseits vermin<strong>de</strong>rte das Beteiligungsprojekt nach Einschätzung betroffener Frauen die<br />
Distanz zu Vorgesetzten und ermöglichte dadurch sexuelle Belästigungen und Übergriffe.<br />
250
<strong>de</strong>s Benutzerinnen-Entwickler-Verhältnisses, Beziehungsaspekte in <strong>de</strong>r Kommunikation<br />
zwischen diesen bei<strong>de</strong>n Gruppen sowie allgemeine symbolische Ebenen <strong>de</strong>s<br />
Geschlechter-Technik-Verhältnisses. Erstens wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hierarchie zwischen technik-<br />
und anwendungsbezogenem Wissen, die mit <strong>de</strong>n Inhalten <strong>de</strong>r Tätigkeit von Entwicklern<br />
und Benutzerinnen korreliert, in <strong>de</strong>n Projekten durch strukturelle Maßnahmen (z.B.<br />
eigenständig arbeiten<strong>de</strong> Benutzerinnengruppe, Stimmrecht im Entscheidungsgremium)<br />
begegnet. 350 Diese Machtunterschie<strong>de</strong> formen jedoch zweitens die Beziehungen und<br />
die Kommunikation zwischen Benutzerinnen und Entwicklern bzw. Vorgesetzten mit.<br />
Deshalb wur<strong>de</strong>n die Benutzerinnen durch die Beraterinnen darin unterstützt, ihre<br />
eigene Rolle im Prozess wichtig zu nehmen sowie Handlungsmöglichkeiten und Stärken<br />
zu erkennen – entgegen <strong>de</strong>ren üblicher Erfahrung, eher nicht ernst genommen,<br />
angegriffen o<strong>de</strong>r ignoriert zu wer<strong>de</strong>n. Auf <strong>de</strong>r dritten Hierarchieebene, die <strong>de</strong>n<br />
Beteiligungsprozess durchdringt, <strong>de</strong>n geschlechtsstereotypen Zuschreibungen in<br />
Bezug auf Technik, intervenierten die Beraterinnen vor allem durch entsprechen<strong>de</strong><br />
Reflektionsphasen in <strong>de</strong>n Treffen <strong>de</strong>r Frauengruppe und Qualifizierung zur Beteiligung.<br />
Insgesamt zeigt die Studie Hammels auf, dass eine Qualifizierung von Benutzerinnen,<br />
die Einrichtung eigenständig arbeiten<strong>de</strong>r Benutzerinnengruppen zur Anfor<strong>de</strong>rungsermittlung,<br />
Transparenz und Sicherstellung <strong>de</strong>s Informationsflusses sowie eine<br />
Beratung <strong>de</strong>r Benutzerinnen durch ein Frauensoftwarehaus wirksame „strategische<br />
Interventionen“ 351 darstellen, um geschlechterhierarchischen Aspekten in Technikgestaltungsprozessen<br />
zu begegnen – insbeson<strong>de</strong>re, wenn Software für typische Frauenarbeitsplätze<br />
entwickelt wer<strong>de</strong>n soll. Sie vermögen <strong>de</strong>m Mo<strong>de</strong>llmonopol <strong>einer</strong> technisch<br />
orientierten Entwicklungssicht entgegenzuwirken, stellen <strong>de</strong>n Benutzerinnen ein<br />
technisches Wissen zur Verfügung, welches diesen zugleich als Grundlage für<br />
Entscheidungen dient, und ermöglichen eine strategisch bessere Verhandlungsposition<br />
in <strong>de</strong>n Sitzungen <strong>de</strong>s Entscheidungsgremiums und <strong>de</strong>r Design-Teams. Dabei sind die<br />
partizipativen Maßnahmen vor allem geeignet, um das Machtgefälle zwischen Entwicklern<br />
und Benutzerinnen auszugleichen und eine Brücke zur Kommunikation<br />
herzustellen, die für eine Anfor<strong>de</strong>rungsermittlung und Erstellung adäquater Benutzungsschnittstellen<br />
unabdingbar ist. Die betriebliche Machtkonstellation erscheint<br />
dagegen nicht in gleichem Maße durch die Vorgehensmo<strong>de</strong>lle beeinflussbar zu sein,<br />
wenngleich sie durchaus für die Beteiligten im Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung<br />
Konsequenzen haben kann. „Die strategischen Interventionen helfen zwar individuelle<br />
und kollektive Stärken und Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine Verän<strong>de</strong>rung<br />
in Status und Anerkennung bleibt jedoch aus.“ (Hammel 2003, 202).<br />
Während die von Hammel vorgeschlagenen strategischen Interventionen primär<br />
darauf zielen, eine Re-Produktion von Geschlechterhierarchie in <strong>de</strong>njenigen<br />
Technikgestaltungsprozessen zu vermei<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen die zukünftigen NutzerInnen in<br />
350 Aus <strong>einer</strong> Notsituation heraus führten die Beraterinnen in einem <strong>de</strong>r Projekte zusätzlich das umstrittene<br />
Element <strong>de</strong>r Sitzungsunterbrechung ein, um in Fällen dringen<strong>de</strong>n Klärungsbedarfs während <strong>de</strong>s Design-<br />
Workshops mit <strong>de</strong>n Entwicklern Zeit für Rücksprache und Informationsaustausch zu bieten.<br />
351 Mit <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r „strategischen Intervention“ bezieht sich Hammel auf Konzepte, die Software-<br />
Entwicklung als Intervention in die Anwendungsorganisation betrachten, vgl. Dahlbom/ Matthiasen 1993,<br />
Kuhnt 1998. Demgegenüber versteht Hammel unter strategischen Interventionen primär diejenigen<br />
„Elemente, die <strong>de</strong>n partizipativen Prozess beeinflussen, um (geschlechter)hierarchisch geprägte<br />
Strukturen, implizite Zuschreibungen und individuelle Handlungsweise aufzubrechen.“ (Hammel 2003, 91).<br />
Es geht um Maßnahmen, die geeignet sind, in hierarchische Verhältnisse zu Gunsten <strong>de</strong>r Benachteiligten<br />
einzugreifen.<br />
251
traditionellen Frauenberufen tätig sind, fokussieren an<strong>de</strong>re aktuelle Projekte „von<br />
Frauen für Frauen“ stärker auf das Geschlechter-Technik-Verhältnis. Ein überzeugen<strong>de</strong>s<br />
Beispiel dieser Art ist das Projekt <strong>de</strong>r virtuellen Frauenuniversität (vifu) (Schelhowe<br />
2001, Kreutzner et al. 2003, Guerses 2003), welches darauf zielte, Frauen Neugier und<br />
Spaß an <strong>de</strong>r Technik zu vermitteln und eine „offene Technikkultur“ herzustellen. Dieses<br />
war im Gegensatz zu <strong>de</strong>n zuvor beschriebenen nicht in einem betrieblichen, son<strong>de</strong>rn<br />
im universitären Kontext angesie<strong>de</strong>lt. Die Nutzerinnen waren Stu<strong>de</strong>ntinnen, Praktikerinnen<br />
und Forscherinnen, die aus aller Welt zu <strong>einer</strong> dreimonatigen gemeinsamen<br />
Projektarbeit zusammen kamen, welche ebenso unterstützt wer<strong>de</strong>n sollte wie nachfolgen<strong>de</strong><br />
Vernetzung und Kommunikation, wenn die Frauen in ihre Heimatlän<strong>de</strong>r zurückgekehrt<br />
waren. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass dabei ausschließlich<br />
Frauen als Entwicklerinnen tätig waren. Diese bil<strong>de</strong>ten zusammen mit einigen<br />
stu<strong>de</strong>ntischen Beraterinnen ein engagiertes Team, das die technische Entwicklung als<br />
Gestaltung sozialer Prozesse begriff und explizit feministische Zielsetzungen verfolgte.<br />
Die Arbeit im Team war selbstständig, eigenverantwortlich und durch ein hohes Maß<br />
an Entscheidungsspielräumen und Transparenz geprägt. Statt hierarchischer Struktur<br />
und Kontrolle wur<strong>de</strong> in <strong>einer</strong> Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung viel Bericht<br />
erstattet, diskutiert und ausgetauscht. Dieses Klima übertrug sich zugleich auf die<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>n Nutzerinnen.<br />
Das Gestaltungsteam hatte die Aufgabe, <strong>de</strong>n Server, die Lernumgebung und die<br />
Werkzeuge zu entwickeln sowie <strong>de</strong>n Benutzerinnen zugleich ein Betreuungs- und<br />
Schulungsangebot zur Verfügung zu stellen. Damit war <strong>de</strong>r Prozess nicht im engeren<br />
Sinne partizipativ angelegt, jedoch mit <strong>de</strong>m Prinzip <strong>de</strong>s „Learning-by-doing-and-asking“<br />
<strong>einer</strong>seits stark an <strong>de</strong>n Bedürfnissen <strong>de</strong>r Benutzerinnen orientiert, an<strong>de</strong>rerseits sollte<br />
auf diese Weise Neugier auf Technik geweckt und eine neue technische Kommunikationskultur<br />
unter Frauen etabliert wer<strong>de</strong>n: „Ein entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Prinzip war, dass<br />
Fragen nicht ‚einfach’ beantwortet wur<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn durch Rückfragen und durch<br />
Einbeziehung an<strong>de</strong>rer Teilnehmerinnen ein Klima <strong>de</strong>s Fragens und Beratens und<br />
gemeinsamen Herausfin<strong>de</strong>ns geschaffen wur<strong>de</strong>.“ (Schelhowe 2001, 17). Ein zweites<br />
Prinzip <strong>de</strong>s Projekts bestand darin, Technik für die Benutzerinnen als einen offenen<br />
und sichtbaren Prozess erfahrbar zu machen, an <strong>de</strong>m je<strong>de</strong> als „mündige“ und<br />
interessierte Nutzerin mitwirken kann. Die Nutzerinnen konnten Kritik, Ansprüche und<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen kommunizieren, schrittweise technisches Wissen erwerben und sich<br />
somit selbst an <strong>de</strong>r Produktion von Inhalten und Technologie beteiligen. Auf <strong>de</strong>r<br />
Grundlage und mit Hilfe <strong>de</strong>s Einsatzes von Open-Source-Software war es möglich<br />
gewor<strong>de</strong>n, dass die Nutzerinnen die Software nicht als ein fertiges Produkt, son<strong>de</strong>rn<br />
als Dienstleistung von konkreten Menschen verstehen. Dadurch, dass <strong>de</strong>r Herstellungsprozess<br />
sichtbar gemacht wur<strong>de</strong>, konnten Möglichkeiten <strong>de</strong>s eigenen Eingreifens<br />
<strong>de</strong>utlich und Grenzen zwischen Technikkonstruktion und Techniknutzung fließend<br />
wer<strong>de</strong>n. Eine solche technische Ermächtigung <strong>de</strong>r Nutzerinnen wirkt in zweifacher<br />
Hinsicht <strong>de</strong>n traditionellen Geschlechter-Technik-Verhältnissen entgegen. Zum einen<br />
wur<strong>de</strong>n die Frauen selbst technisch qualifiziert, zum an<strong>de</strong>ren konnte die geschlechtlich<br />
zutiefst kodierte Dichotomie von Technikgestaltung und -nutzung ein Stück weit<br />
aufgeweicht wer<strong>de</strong>n. Diese De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie konnte in <strong>de</strong>m weiteren<br />
„Sekretariat-Assistenz-Netzwerk (S-A-N)“-Projekt an <strong>de</strong>r Bremer Universität, d.h.<br />
252
wie<strong>de</strong>rum in einem traditionellen Frauenberuf, ebenso erfolgreich eingesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
(vgl. Schelhowe et al. 2005).<br />
Das vifu- und das S-A-N-Projekt beziehen sich zwar methodisch nicht auf die<br />
partizipativen Gestaltungsansätze <strong>de</strong>r skandinavischen Schule, können aber <strong>de</strong>nnoch<br />
als eine spezifische Form <strong>de</strong>r Umsetzung <strong>de</strong>s Prinzips <strong>de</strong>r engen Kooperation von<br />
EntwicklerInnen und Anwen<strong>de</strong>rInnen <strong>de</strong>s CRA verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, die für aktuelle<br />
Projekte „von Frauen für Frauen“ viel versprechend erscheint. Es erscheint spannend,<br />
die Prinzipien <strong>de</strong>s „Learning-by-doing-and-asking“ und <strong>de</strong>r Transparentmachung und<br />
Öffnung von Technikgestaltungsprozessen für die Nutzerinnen stärker mit <strong>de</strong>n <strong>kritisch</strong>partizipativen<br />
Metho<strong>de</strong>n zu verknüpfen und darin theoretisch zu begrün<strong>de</strong>n.<br />
Insgesamt steht also mit <strong>de</strong>r nutzungszentrierten und partizipativen Technikgestaltung<br />
ein umfangreiches Metho<strong>de</strong>nrepertoire zur Verfügung, um Geschlechtseinschreibungen<br />
in Software, die für spezielle NutzerInnengruppen, insbeson<strong>de</strong>re Frauen in typischen<br />
Frauenberufen, konzipiert ist, zu vermei<strong>de</strong>n. Dabei zeigte sich jedoch, dass für<br />
ein erfolgreiches De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte unterschiedliche Dimensionen<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung auszudifferenzieren und zu adressieren sind, die jeweils<br />
adäquate Metho<strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rn, welche nicht immer im gleichen Maße wirksam wer<strong>de</strong>n<br />
können. Während nutzerInnenzentrierte Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungsanalyse zu einem<br />
besseren Verständnis von Arbeit beitragen und dabei auch Aspekte als „typisch<br />
weiblich“ gelten<strong>de</strong>r, unsichtbarer Arbeit aufge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n können, die für eine adäquate<br />
technische Unterstützung traditionellen Frauentätigkeiten notwendig sind,<br />
erscheint es schwieriger, Einschreibungen geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung<br />
in die Software mit Hilfe <strong>informatischer</strong> Metho<strong>de</strong>n entgegenzuwirken. So erzielten viele<br />
Projekte „von Frauen für Frauen“, die auf partizipativen Ansätzen zur Technikgestaltung<br />
grün<strong>de</strong>n, ein Empowerment <strong>de</strong>r Betroffenen, in<strong>de</strong>m diese technisch qualifiziert<br />
wur<strong>de</strong>n und ihre Arbeitsplätze erhalten wer<strong>de</strong>n konnten, die durch <strong>de</strong>n Einsatz von<br />
Softwaresystemen bedroht waren. Die prinzipielle Chance dagegen, Arbeit über <strong>de</strong>n<br />
Gestaltungsprozess bewusst so zu re-organisieren, dass eine bestehen<strong>de</strong> betrieblichorganisatorische<br />
Geschlechterhierachie durch <strong>de</strong>n Technikeinsatz ausgehebelt wird,<br />
ließ sich empirisch nicht bestätigen, wenngleich die betriebliche Hierarchie zumin<strong>de</strong>st<br />
während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Entwicklungsprozesses abgeschwächt wer<strong>de</strong>n konnte. Ein<br />
weiterer Aspekt betrifft das symbolische Geschlechter-Technik-Verhältnis und das<br />
zweigeschlechtlich geprägte Gefälle von EntwickerInnen und NutzerInnen. Diesen lässt<br />
sich insbeson<strong>de</strong>re durch Partizipation, „<strong>de</strong>sign-by-doing-and-asking“ sowie durch eine<br />
offene Technikkultur begegnen, durch die NutzerInnen (z.B. abhängig beschäftigte<br />
Frauen) Mitverantwortung für <strong>de</strong>n Softwareentwicklungsprozess erhalten und Technik<br />
als gestaltbar wahrgenommen wer<strong>de</strong>n kann – und nicht wie so oft üblich als „gegeben“.<br />
Der Erfolg dieser De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien hängt jedoch, wie verschie<strong>de</strong>ne Projekte<br />
„von Frauen für Frauen“ ver<strong>de</strong>utlichen, häufig weniger von <strong>de</strong>n eingesetzten Metho<strong>de</strong>n<br />
als von <strong>de</strong>n Rahmenbedingungen <strong>de</strong>s jeweiligen Projekts (z.B. Unterstützung durch<br />
das Management, Frauen als Technikentwicklerinnen und Beraterinnen, kooperative<br />
Beziehung zwischen NutzerInnen und EntwicklerInnen etc.) ab.<br />
253
5.4. „Design for Experience and Reflection“: Geschlecht durch Technologie<br />
<strong>de</strong>konstruieren<br />
Die dritte Klasse <strong>informatischer</strong> Artefakte, <strong>de</strong>ren De-Gen<strong>de</strong>ring ich in diesem Kapitel<br />
genauer betrachten möchte, umfasst diejenigen, die sich als Technologien <strong>de</strong>r Selbstgestaltung<br />
lesen lassen, da sie – insbeson<strong>de</strong>re durch Verkörperung – zur Subjektkonstitution<br />
und Konstruktion von (Geschlechts-)I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r NutzerInnen beitragen. Zu<br />
dieser Klasse gehören inbeson<strong>de</strong>re menschenähnliche virtuelle Figuren, die entwe<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n NutzerInnen als virtuelle StellvertreterInnen dienen o<strong>de</strong>r diesen als eigenständig<br />
o<strong>de</strong>r semi-autonom „han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>“ Entitäten gegenüber treten. Die einen fin<strong>de</strong>n sich als<br />
Avatare in Online-Gemeinschaften o<strong>de</strong>r als Spielfiguren in Computerspielen, die primär<br />
zur Unterhaltung gedacht sind. Die an<strong>de</strong>ren sind als „soziale“ Roboter bzw. Softwareagenten<br />
konzipiert, die <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen physisch o<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m Bildschirm<br />
repräsentiert gegenübertreten. Besteht bei <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n NutzerInnen selbst gesuchten<br />
bzw. zusammengestellten StellvertreterInnen, das Problem darin, dass ihnen nur eine<br />
eingeschränkte, meist höchst geschlechterstereotype Auswahl bei <strong>de</strong>r Kreation <strong>de</strong>r<br />
Figuren zur Verfügung steht (vgl. Kapitel 4.1.1., 4.1.2. und 4.2.5.), so zeigen die bereits<br />
fest kodierten menschen-ähnlichen Maschinen in <strong>de</strong>r Regel überzogen inszenierte<br />
virtuelle Frauen- o<strong>de</strong>r Männerkörper und ein entsprechen<strong>de</strong>s Blickverhalten. Ferner<br />
interagieren sie zweigeschlechtlich ausdifferenziert, z.T. auch höchst sexualisiert, mit<br />
<strong>de</strong>n NutzerInnen (vgl. Kapitel 4.2.5.). In sämtlichen Fällen wird eine materiell o<strong>de</strong>r<br />
virtuell verkörperte Figur repräsentiert, <strong>de</strong>ren Aussehen, Auftreten und Verhalten als<br />
allgemein menschliches gilt, <strong>de</strong>r jedoch tatsächlich auf massive Weise Geschlechtsstereotype<br />
eingeschrieben sind. Dabei besteht die Problematik darin, dass die<br />
Anwen<strong>de</strong>rInnen in die Interaktion mit solchen Maschinen immersiv hineingezogen<br />
wer<strong>de</strong>n sollen, die z.T stärker geschlechtsstereotypisierte o<strong>de</strong>r gar sexistische Erfahrungen<br />
bereit hält als realweltliche Darstellungen und Interaktionen. Da diese Figuren<br />
entwe<strong>de</strong>r für die Selbstrepräsentation <strong>de</strong>r NutzerInnen konzipiert sind o<strong>de</strong>r die Interaktionserfahrungen<br />
subtil zur I<strong>de</strong>ntitätskonzeption <strong>de</strong>r NutzerInnen beitragen, wirken<br />
solche Geschlechtseinschreibungen in <strong>de</strong>n Artefakten – womöglich stärker noch als die<br />
traditionellen Medien – an <strong>de</strong>r Normalisierung von Geschlecht mit.<br />
Sollte es sich um beson<strong>de</strong>rs krasse Fälle <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung virtueller<br />
Figuren han<strong>de</strong>ln, wie in Kapitel 4.2.5. dargestellt, kann ein erster Schritt in Richtung<br />
eines De-Gen<strong>de</strong>ring sein, die Technologie stärker an <strong>einer</strong> heterogenen, vielfältigen<br />
und konträren Zielgruppe zu orientieren. Denn um <strong>de</strong>n auf die Spitze getriebenen<br />
Geschlechterstereotypen bei Avataren, Spielfiguren und menschenähnlichen Softwareagenten<br />
zu begegnen, die mit <strong>de</strong>m Aufkommen besserer Grafik und größerer<br />
Bandbreiten <strong>de</strong>r Übertragung möglich gewor<strong>de</strong>n sind, wäre im Sinne eines De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
bereits viel gewonnen, wenn die repräsentierten Körperbil<strong>de</strong>r stärker <strong>de</strong>n realen<br />
Körpern von Frauen, Männern und Transgen<strong>de</strong>r-Personen entsprächen, auch wenn<br />
hier noch an<strong>de</strong>re Möglichkeiten <strong>de</strong>nkbar wären. Zu diesem Zweck lassen sich die<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r nutzungszentrierten Gestaltung und die Partizipation <strong>de</strong>r NutzerInnen<br />
am Gestaltungsprozess einsetzen, die in <strong>de</strong>n letzten bei<strong>de</strong>n Kapiteln 5.2. und 5.3.<br />
beschrieben wur<strong>de</strong>n.<br />
Eine grundlegen<strong>de</strong> De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie für Technologien, die an <strong>de</strong>r<br />
Konstruktion <strong>de</strong>s Selbst mitwirken, erfor<strong>de</strong>rt jedoch mehr als nur <strong>de</strong>n Rückgriff auf<br />
254
potentielle und reale NutzerInnen, da diese in <strong>de</strong>r Regel selbst im Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
und vorherrschen<strong>de</strong>n binarisieren<strong>de</strong>n Stereotypen befangen sind. So<br />
zeigten etwa Studien zu Avataren, dass die Anwen<strong>de</strong>rInnen häufig selbst eine stereotype<br />
Repräsentation ihrer Selbst kreierten und ein binäres Geschlechtermo<strong>de</strong>ll<br />
bevorzugten (vgl. hierzu Kap 4.2.5.). Eine <strong>kritisch</strong>-feministische Gestaltung sollte<br />
<strong>de</strong>shalb in diesen Fällen das Ziel haben, über die bislang vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n<br />
hinauszugehen und sich gegen vorherrschen<strong>de</strong> Geschlechternormen zu richten, <strong>de</strong>ren<br />
technische Wie<strong>de</strong>rholung es zu durchkreuzen und zu unterbrechen gilt. Für ein alternatives<br />
Design solcher Technologien ginge es darum, das vorherrschen<strong>de</strong> Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
grundlegen<strong>de</strong>r als bislang zu <strong>de</strong>konstruieren, beispielsweise<br />
im Sinne <strong>einer</strong> Vervielfältigung und Verunein<strong>de</strong>utigung von Geschlecht, s<strong>einer</strong> Parodie<br />
o<strong>de</strong>r mittels <strong>einer</strong> Option zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Geschlechtlichkeit (vgl. Engel 2002,<br />
Butler 1991 [1990], 1995 [1993]). Die Herausfor<strong>de</strong>rung besteht nun darin, solche<br />
Strategien <strong>de</strong>r De-Konstruktion, die in Bezug auf <strong>de</strong>n Geschlechtskörper innerhalb <strong>de</strong>s<br />
feministischen Diskurses vorgeschlagen wor<strong>de</strong>n sind, auf die Technologiegestaltung<br />
zu übertragen.<br />
Gefragt sind damit Ansätze, die <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen einen eher spielerischen<br />
Zugang ermöglichen statt einen pragmatischen Zweck zu verfolgen, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Regel<br />
über einen zwar variablen, aber schrittweisen Ablauf erreichbar ist und getestet wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Im Gegensatz zu <strong>de</strong>n zuvor in diesem Kapitel betrachteten vergeschlechtlichten<br />
Artefakten, die Arbeitshandlungen, zielgerichtete Aufgaben bzw. die Informationssuche<br />
unterstützen sollen, liegen bislang erst wenige methodische Ansätze zur Technikgestaltung<br />
vor, die für eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie, die auf eine alternative Repräsentation<br />
zu vergeschlechtlichen Körpern und Verhaltensweisen zielt, vielversprechend<br />
erscheinen. In diesem Kapitel stelle ich drei Ansätze vor, welche die Subjektivität <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen ins Zentrum rücken und damit auf die Gestaltung von Technologien <strong>de</strong>s<br />
Selbst zielen: die Gestaltungsphilosophie <strong>de</strong>s „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ (Cassell<br />
1998, 2003), die Justine Cassell aus <strong>einer</strong> explizit geschlechter<strong>kritisch</strong>en Perspektive<br />
für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Computer- und Vi<strong>de</strong>ospiele für Kin<strong>de</strong>r vorgeschlagen hat, sowie<br />
die Ansätze <strong>de</strong>s „Design for Experience“ (Sengers et al. 2004, Wright/ McCarthy 2004)<br />
und <strong>de</strong>s „Reflective Design“ (Sengers et al. 2005), die im Bereich <strong>de</strong>s HCI entstan<strong>de</strong>n<br />
sind und für <strong>de</strong>n Zweck eines De-Gen<strong>de</strong>ring noch adaptiert wer<strong>de</strong>n müssen. Dabei<br />
diskutiere ich, inwieweit diese Metho<strong>de</strong>n aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive<br />
genutzt o<strong>de</strong>r auch angepasst wer<strong>de</strong>n können, um das bestehen<strong>de</strong> Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
in Frage zu stellen.<br />
5.4.1. „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“: Vervielfältigung „weiblicher“ und<br />
„männlicher“ I<strong>de</strong>ntitäten in einem spezifischen Kontext<br />
„Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ strebt zum einen danach, Ausschlüsse von Frauen als<br />
NutzerInnen zu vermei<strong>de</strong>n, die – wie in Kapitel 4.1.1. dargelegt – durch ein implizites<br />
Design von Computerspielen für Jungen entstehen können. Es wen<strong>de</strong>t sich jedoch<br />
zugleich <strong>de</strong>zidiert gegen ein „Design for the girl“ (vgl. 4.1.2.), das auf <strong>de</strong>r Annahme<br />
beruht, dass Frauen eine beson<strong>de</strong>re För<strong>de</strong>rung im technischen Bereich benötigen, d.h.<br />
ein Defizitmo<strong>de</strong>ll zugrun<strong>de</strong> legt. „The problem is that both si<strong>de</strong>s, ultimately, start from<br />
the assumption that computers are boys’ own toys, and thus both scenarios can result<br />
255
in a pejorativization of girl’s interests“ (Cassell 2003, 410). Im Gegensatz dazu<br />
ermutige „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ Jungen wie Mädchen dazu, selbst zu entschei<strong>de</strong>n,<br />
welche (Geschlechts-)I<strong>de</strong>ntität sie im Computerspiele darstellen möchten: „That is,<br />
<strong>de</strong>sign that allows users to engen<strong>de</strong>r themselves, to attribute to themselves an i<strong>de</strong>ntity<br />
of any one of a number of sorts, to create or perform themselves through using<br />
technology“ (ebd., 407).<br />
Der Ansatz greift primär auf Konzepte aus <strong>de</strong>r feministischen Pädagogik zurück, in<br />
<strong>de</strong>r die Lernen<strong>de</strong>n selbst verantwortlich sind, subjektive Erfahrungen einen hohen Wert<br />
haben, eine Vielfalt von Standpunkten zugelassen ist, <strong>de</strong>n Lernen<strong>de</strong>n eine „Stimme“<br />
gegeben wird und sie zu Zusammenarbeit ermutigt wer<strong>de</strong>n. Daraus leitet Cassell fünf<br />
Prinzipien feministischer Softwaregestaltung ab: „1. Transfer <strong>de</strong>sign authority to the<br />
user. 2. Value subjective and experiential knowledge in the context of computer use, 3.<br />
Allow use by many different kinds of users in different contexts. 4. Give the user a tool<br />
to express her voice and the truth of her existence. 5. Encourage collaboration among<br />
users“ (Cassell 1998, 305). Das erste Prinzip teile „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ mit<br />
nutzungszentrierten und partizipativen Ansätzen <strong>de</strong>r Technikgestaltung. 352 „Participatory<br />
Design“ beteilige die NutzerInnen allerdings nur früh am Software-Entwicklungsprozess.<br />
Das Produkt selbst wer<strong>de</strong> jedoch als ein statisches verstan<strong>de</strong>n, an <strong>de</strong>m die<br />
NutzerInnen keinen Konstruktionsanteil mehr hätten. „Feminist software <strong>de</strong>sign, on the<br />
other hand, makes the system about <strong>de</strong>sign, so that the <strong>de</strong>sign and construction cycle<br />
continues into the use of the system itself“ (Cassell 1998, 322). Cassell ignoriert hier<br />
zwar diejenigen Zweige <strong>de</strong>r partizipativen Gestaltung, die gera<strong>de</strong> ein kollaboratives<br />
Design von EntwicklerInnen und Anwen<strong>de</strong>rInnen anstreben und <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess<br />
als einen offenen, unabgeschlossenen verstehen. Für die Fragestellung<br />
dieses Kapitels wesentlich erscheint dagegen, dass sie eine Verschiebung zu<br />
Systemen, die eine Konstruktion durch die Anwen<strong>de</strong>rInnen während <strong>de</strong>r Nutzung<br />
erlauben, als Grundlage feministischer Softwaregestaltung begreift. Denn eine solche<br />
Verlagerung be<strong>de</strong>utet die Überwindung <strong>de</strong>r geschlechtskodierten Dichotomie von<br />
Design und Nutzung. Ferner gibt ihr Ansatz <strong>de</strong>n subjektiven Erfahrungen <strong>de</strong>r NutzerInnen<br />
ein starkes Gewicht – ein Aspekt, <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r feministischen Kritik an <strong>de</strong>n objektivistischen<br />
Zugängen in Natur- und Technikwissenschaften seit langem gefor<strong>de</strong>rt wird.<br />
Eine Möglichkeit, Subjektivität technologisch zu för<strong>de</strong>rn und zu unterstützen, sieht<br />
Cassell darin, Werkzeuge zum Geschichten Erzählen (so genannte „story telling tools“)<br />
zu konstruieren.<br />
Das ROSEBUD-System (Glos/ Cassell 1997), ein Computerspiel für Kin<strong>de</strong>r, arbeitet<br />
mit Stofftieren, die durch einen integrierten Infrarotstrahler vom Computer erkannt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Das System speichert <strong>de</strong>n Namen sowie Hintergrundinformation über<br />
das Stofftier und fragt das Kind danach, eine Geschichte über das Stofftier zu erzählen.<br />
Dabei soll es zugleich eine gute „Zuhörerin“ und „Lehrerin“ darstellen, die das Kind<br />
ermutigt, zu schreiben, weiter zu schreiben, zu bearbeiten und zu verbessern. Am<br />
En<strong>de</strong> kann das Kind die selbst kreierte Geschichte sprechen und aufnehmen. Dabei<br />
bietet das System die Möglichkeit, dass das Stofftier die Geschichte „erinnert“ und<br />
wie<strong>de</strong>rholt. Es unterstützt darüber hinaus ein kollaboratives Lernen, da mehrere<br />
352 Eine weitere Gemeinsamkeit bestehe in <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n politischen Orientierung auf eine Demokratisierung,<br />
welche mit <strong>de</strong>m Infragestellen von Macht und Kontrolle zusammengeht.<br />
256
Stofftiere und mehrere SpielerInnen zugelassen sind, so dass Geschichten und Tiere<br />
gegenseitig ausgeliehen wer<strong>de</strong>n können. Letztendlich sei jedoch das Kind für die<br />
Interaktion zuständig, in<strong>de</strong>m es entschei<strong>de</strong>t, mit welchem Stofftier es spielt und welche<br />
Geschichte es erzählen will.<br />
Cassell betont, dass das Spiel geschlechtsneutral sei, da <strong>de</strong>n Stofftieren von<br />
vorpubertären Kin<strong>de</strong>rn kein Geschlecht zugewiesen wer<strong>de</strong>. Ihre empirischen Untersuchungen<br />
bestätigten, dass Mädchen und Jungen gleich viel Spaß mit <strong>de</strong>n technisch<br />
erweiterten Spielzeugen hätten. Dies sei ihres Erachtens vor allem auf die erzählerischen<br />
Aktivitäten zurückzuführen, die eine Vervielfältigung „weiblicher“ und „männlicher“<br />
I<strong>de</strong>ntitäten ermöglichten: „I believe that these activities allow a range of girlhoods<br />
(and boyhoods) to coexist, ultimatively extending the notion of what ‚girl‘ is to a more<br />
dynamic, context-<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt, performative notion.“ (Cassell 1998, 321).<br />
Dass das ROSEBUD-System prinzipiell eine Vervielfältigung von I<strong>de</strong>ntitäten jenseits<br />
binärer Geschlechtszuweisungen ermöglicht, ist für <strong>de</strong>n spezifischen dargestellten<br />
Kontext durchaus nachzuvollziehen. Fragwürdig ist <strong>de</strong>mgegenüber allerdings, inwieweit<br />
damit Cassells Anspruch eingelöst wird, dass Jungen und Mädchen dadurch Aspekten<br />
ihrer eigenen I<strong>de</strong>ntität Ausdruck verleihen, welche die stereotypen Geschlechtskategorien<br />
tatsächlich transzendieren (vgl. Cassell 2003, 402). 353 Denn viele Studien<br />
aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r computergestützten Kommunikation und Onlinespiele, die von<br />
älteren Kin<strong>de</strong>rn, Jugendlichen o<strong>de</strong>r Erwachsenen genutzt wer<strong>de</strong>n, berichten eher von<br />
gegenteiligen Effekten: Dort, wo die Technologie Unsicherheiten zulässt – sowohl an<br />
<strong>de</strong>r Grenze zwischen Mensch und Maschine als auch an <strong>de</strong>n vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
Trennlinien von Geschlecht –, besteht gera<strong>de</strong> die Ten<strong>de</strong>nz, Geschlechtlichkeit in ihrer<br />
binären Form und stereotypen Überspitzung wie<strong>de</strong>rherzustellen (vgl. hierzu etwa<br />
Kapitel 2 sowie Kapitel 4.2.5.). Insofern hat Cassell mit <strong>de</strong>n Stofftieren nur eine sehr<br />
spezifische Repräsentation virtuell-materieller Figuren gewählt, die bei Kin<strong>de</strong>rn in<br />
einem gewissen Alter noch nicht geschlechtlich besetzt zu sein scheint. Das erzielte<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring bezieht sich <strong>de</strong>mnach eher auf diese Einschränkung <strong>de</strong>r Zielgruppe und<br />
<strong>de</strong>s Nutzungskontexts als dass es an <strong>de</strong>r technischen Realisierung festzumachen ist<br />
o<strong>de</strong>r gar an <strong>de</strong>r Designphilosophie <strong>de</strong>s „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“.<br />
Ebenso wenig überzeugend scheint das ROSEBUD-System als ein Beleg für<br />
Cassells feministische Vision <strong>einer</strong> Game Software-Entwicklung gelten zu können, in<br />
<strong>de</strong>r die geschlechtlich markierte Trennlinie zwischen Design und Nutzung aufgebrochen<br />
wird: „a space in which authority can be distributed to users, by allowing most of<br />
the <strong>de</strong>sign and construction to be carried out by the user rather than by the <strong>de</strong>signer“<br />
(Cassell 1998, 302). Denn die NutzerInnen vermögen zwar das Spiel und seine Inhalte<br />
ein Stück weit zu gestalten, ohne auf einschränken<strong>de</strong> Regeln festgelegt zu sein.<br />
Dagegen bleibt allerdings die grundlegen<strong>de</strong> Konstruktion <strong>de</strong>s Spiels als eines, das auf<br />
<strong>de</strong>r partnerschaftlichen Interaktion mit Stofftieren und <strong>de</strong>r narrativen Aktivität <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r<br />
basiert, unverän<strong>de</strong>rbar. So gesehen wird die geschlechtskodierte Dichotomie von<br />
Design und Nutzung hier zwar angekratzt, letztendlich jedoch nicht unterlaufen.<br />
Trotz dieser Einschränkungen zeigt „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ insgesamt eine viel<br />
versprechen<strong>de</strong> Richtung auf, wie insbeson<strong>de</strong>re im Fall <strong>de</strong>r Entwicklung von Computer-<br />
353 Dies ist umso unklarer, da sie sich in ihrem Geschlechterverständnis auf feministische Theoretikerinnen<br />
wie Joan Scott, Nancy Fraser und Judith Butler beruft.<br />
257
spielen für Kin<strong>de</strong>r jenen Vergeschlechtlichungen, die aus <strong>de</strong>m impliziten Design „für<br />
Jungen“ o<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r expliziten Zielgruppenbestimmung „für Frauen“ resultieren (vgl.<br />
Kapitel 4.1.1 und 4.1.2), begegnet wer<strong>de</strong>n kann. So wird hier durch die Eingrenzung<br />
<strong>de</strong>s Kontexts bewusst versucht, Geschlechtszuschreibungen an die „Spielfiguren“ zu<br />
vermei<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n NutzerInnen vielfältige Wege zur eigenen Konstruktion von<br />
I<strong>de</strong>ntität zu eröffnen. „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ vermag jedoch – entgegen <strong>de</strong>n Versprechen<br />
<strong>de</strong>r Autorin – die Design-Nutzungs-Dichotomie nicht aufzulösen. Der Ansatz<br />
enthält somit zwar theoretisch inspirieren<strong>de</strong> Elemente für eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie,<br />
es bleibt jedoch unklar, wie die von Cassell vorgeschlagenen Prinzipien feministischen<br />
Spiel<strong>de</strong>signs generell in Softwaresysteme übersetzt wer<strong>de</strong>n können. Das ist sicherlich<br />
auch darauf zurückzuführen, dass sie zu <strong>de</strong>r Gestaltungsphilosophie <strong>de</strong>s „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined<br />
Design“ keine methodischen Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Umsetzung mitliefert.<br />
5.4.2. „Design for Experience“: Den NutzerInnen viel<strong>de</strong>utige und provokante<br />
Geschlechtererfahrungen ermöglichen<br />
„Design for Experience“ führt die I<strong>de</strong>e, subjektive Erfahrungen von NutzerInnen durch<br />
eine entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung technisch zu unterstützen, weiter. Dabei rekurriert<br />
dieser Ansatz stärker auf philosophische, primär phänomenologische, Theorien als auf<br />
pädagogische wie das „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ Justine Cassells. Unter „Design for<br />
Experience“ fasse ich vor allem diejenigen Ansätze aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r HCI<br />
zusammen, die sich auf „Technology as Experience“ von John McCarthy und Peter<br />
Wright (2004) berufen o<strong>de</strong>r ähnliche Anleihen machen. 354 Dieser Zugang wur<strong>de</strong> bereits<br />
in Kapitel 4.3.3. im Hinblick auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring jener Technologien diskutiert, die auf<br />
<strong>de</strong>r in westlichen Denktraditionen zutiefst vergeschlechtlichten Dichotomie von Vernunft<br />
und Gefühl basieren. Dort wur<strong>de</strong> gezeigt, dass <strong>de</strong>r „Technology as Experience“-<br />
Ansatz für diese Technologien eine Auflösung <strong>de</strong>r genannten Dichotomie in Aussicht<br />
stellt. Dagegen soll er hier mit Bezug auf seine theoretischen Grundlagen ausführlicher<br />
vorgestellt wer<strong>de</strong>n, um sein Potential für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r konstatierten stereotypen<br />
bzw. zweigeschlechtlichen Performanz menschenähnlicher Repräsentationen<br />
auszuloten.<br />
„Technology as Experience“ bezieht sich auf erlebte bzw. empfun<strong>de</strong>ne Erfahrungen:<br />
„‚Experience‘ is the word that is most likely to express something of the felt life. It is a<br />
very rich word, discursively open and complex, and redolent of life as lived, not just as<br />
theorized“ (McCarthy/ Wright 2004, 49). Um Handlungen in Praxis und Erfahrungen im<br />
Umgang mit Technologien als ästhetische theoretisch zu begrün<strong>de</strong>n, greifen die bei<strong>de</strong>n<br />
Autoren auf Strömungen <strong>de</strong>s Pragmatismus (vor allem John Dewey und Michail Bachtin)<br />
zurück, ergänzt um Anleihen bei <strong>de</strong>r Phänomenologie. „[P]ragmatism is the operative<br />
philosophy of the computer world, and that <strong>de</strong>signers and <strong>de</strong>velopers are more<br />
likely to be influenced by Marshall McLuhan and John Dewey than by Bertrand Russell<br />
and A.J.Ayer. They are more likely to talk about freedom, community and engagement<br />
(the language of pragmatism) than about formality, hierarchy and rule (the language of<br />
analytic philosophy)“ (McCarthy/ Wright 2004, 17), argumentieren sie mit Richard<br />
354 Dabei ist vor allem das 1983 veröffentlichte Buch von Donald Schön „The reflective practitioner: How<br />
professionals think in action“ zu nennen.<br />
258
Coyne (1995). Auf dieser Grundlage i<strong>de</strong>ntifizieren sie vier für die Beziehung zu<br />
Technologie relevante Arten von Erfahrungen: a) durch Sinneseindrücke gewonnene,<br />
b) emotionale Erfahrungen, die bei <strong>de</strong>r Konstruktion von Sinn und Be<strong>de</strong>utung eine<br />
wesentliche Rolle spielen, c) solche, die zwischen Teil und Ganzem vermitteln<strong>de</strong>n<br />
(‚compositional‘) 355 sowie d) auf Raum und Zeit bezogene. Ferner bestimmen sie sechs<br />
Formen wie Menschen durch Erfahrungen, die sie mit und durch Technologien<br />
machen, Sinn herstellen: 1. Antizipation, bei <strong>de</strong>r die gegenwärtige Erfahrung von<br />
Erwartungen, die aus früheren Erfahrungen resultieren, geprägt ist, 2. Verbindungen<br />
(‚connecting‘), die als unmittelbare, vor-konzeptuelle und vor-begriffliche Wahrnehmung<br />
<strong>einer</strong> Situation charakterisiert wer<strong>de</strong>n, 3. Interpretation, während Erfahrungen<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n. Diese erfor<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Bezug auf narrative Strukturen, AkteurInnen und<br />
Handlungsmöglichkeiten im Rahmen <strong>de</strong>ssen, was passiert ist und sich wahrscheinlich<br />
noch ereignen wird, 4. Reflektion, bei <strong>de</strong>r zusätzlich Urteile über die gemachten<br />
Erfahrungen ins Spiel kommen, 5. Aneignung, d.h. die Erfahrung wird in Beziehung zu<br />
sich selbst, <strong>de</strong>r eigenen persönlichen Geschichte und <strong>de</strong>r erwarteten Zukunft gesetzt<br />
sowie 6. Nacherzählung, bei <strong>de</strong>r die Erfahrung sich selbst erzählt o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
berichtet wird. 356<br />
Mit Bezug auf diese theoretische Grundlage o<strong>de</strong>r ähnliche Anleihen hat sich in <strong>de</strong>n<br />
letzten Jahren ein Bereich <strong>de</strong>r HCI-Forschung formiert, <strong>de</strong>r darauf zielt, <strong>de</strong>n NutzerInnen<br />
einen spielerischen Zugang sowie umfassen<strong>de</strong> Erfahrungen zu ermöglichen<br />
(vgl. u.a. Dourish 2001, Dunne/ Raby 2001, Sengers et al. 2004, Norman 2004, Blythe<br />
et al. 2003). Mit <strong>de</strong>r Fokussierung auf die kulturell und historisch situierte Erfahrung <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen stellen diese VertreterInnen subjektive Aspekte <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-<br />
Kommunikation in <strong>de</strong>n Mittelpunkt <strong>de</strong>r Gestaltung von Technologie. Technologien<br />
sollen so konzipiert wer<strong>de</strong>n, dass sie die NutzerInnen emotional in die Interaktion involvieren.<br />
„Immersion“, „Funology“ und „Enjoyment“ dienen hier als neue Schlagworte,<br />
welche die Forschung und Entwicklung leiten. 357 Die neue Ausrichtung wirft neue<br />
Forschungsfragen auf. So gerät nun beispielsweise ins Blickfeld, ob NutzerInnen ein<br />
System als „sympathisch“ empfin<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r es als moralisch akzeptabel ansehen.<br />
Ferner wer<strong>de</strong>n damit Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Systementwicklung ebenso wie die <strong>de</strong>r Evaluation<br />
erfor<strong>de</strong>rlich, die NutzerInnen Spaß an <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Technologie ermöglichen, sie in die<br />
Interaktion verwickeln und hineinziehen o<strong>de</strong>r zu eruieren vermögen, ob die angestrebte<br />
Immersion tatsächlich erreicht wor<strong>de</strong>n ist (vgl. etwa Höök et al. 2003, Ruttkay/<br />
Pelachaud 2004). 358<br />
„Design for Experience“ positioniert sich gegenwärtig als ein innovativer Ansatz, <strong>de</strong>r<br />
sich von herkömmlichen Usability-Metho<strong>de</strong>n ebenso <strong>de</strong>zidiert abgrenzt wie von <strong>de</strong>n in<br />
<strong>de</strong>r Informatik verbreiteten Objektivitätsauffassungen. Statt<strong>de</strong>ssen schließt er an parti-<br />
355 „If one is looking at a painting, ‚compositional‘ refers to the relations between elements of the painting<br />
and their implied agency, and between viewer, painting, and setting. In an unfolding interaction, involving<br />
self and other, in a novel, play, or technologically mediated communication, it refers to the narrative<br />
structure, action possibility, consequences and explanations of actions“ (McCarthy/ Wright 2004, 87).<br />
356 An diesen Formen möglichen In-Beziehung-Setzens zu Technologie wird <strong>de</strong>utlich, dass sich das<br />
ROSEBUD-System und damit Cassells „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ ebenfalls als Umsetzung <strong>de</strong>s<br />
„Technology as Experience“-Ansatzes re-interpretieren ließe.<br />
357 Die renommierte Zeitschrift Interactions widmete <strong>de</strong>m Thema „Funology“ 2003 eine gesamte Ausgabe,<br />
zeitgleich erschien auch ein Sammelband unter diesem Titel (Blythe et al. 2003).<br />
358 Siehe auch: Proceedings of the Workshop „Innovative Approaches for building affective systems“,<br />
Januar 2006 in Stockholm, http://emotion-research.net/ws/wp9/d9e.pdf.<br />
259
zipative Technikgestaltungsansätze sowie <strong>kritisch</strong>e Theoriebezüge an. Differenzen<br />
gegenüber herkömmlichen HCI-Metho<strong>de</strong>n lassen sich anhand <strong>de</strong>r <strong>de</strong>klarierten Ziele<br />
erkennen, die von Kristina Höök und ihren KollegInnen auf <strong>de</strong>n Punkt gebracht wur<strong>de</strong>n:<br />
„Usability traditionally focuses on goals such as effectiveness, efficiency, safety, utility,<br />
learnability, and memorability. These objective usability goals contrast with user experience<br />
goals, which cover subjective qualities such as being fun, rewarding, motivating,<br />
satisfying, enjoyable, and helpful. Usability goals and user experience goals often<br />
stand in complex relationships, involving tra<strong>de</strong>offs like safety vs. fun or efficiency vs.<br />
enjoyability“ (Höök et al. 2004, 6). VertreterInnen <strong>de</strong>s „Design for experience“<br />
behaupten, dass diese Ziele kein Gegenstand <strong>de</strong>r freien Wahl, son<strong>de</strong>rn von <strong>de</strong>r<br />
Technologien abhängig seien. Denn traditionelle Usability-Metho<strong>de</strong>n versagten, wenn<br />
es beispielsweise darum ginge, die Glaubwürdigkeit von menschenähnlichen<br />
Repräsentationen zu überprüfen o<strong>de</strong>r emotionale Reaktionen von NutzerInnen zu<br />
untersuchen. 359<br />
In<strong>de</strong>m subjektive Nutzungserfahrungen betont wer<strong>de</strong>n, geht „Design for Experience“<br />
zugleich über das Verständnis objektivierbarer empirischer Forschung hinaus, das<br />
sowohl in <strong>de</strong>r herkömmlichen Softwareentwicklung als auch in <strong>de</strong>r herkömmlichen<br />
Usability-Forschung vorherrscht. So wen<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Ansatz etwa gegen die<br />
Vorstellung <strong>einer</strong>/s „NormalnutzerIn“ die/<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n herkömmlichen Metho<strong>de</strong>n häufig<br />
zugrun<strong>de</strong> liegt und als Maßstab <strong>de</strong>r Systemevaluation herangezogen wird: „[T]he<br />
statistical averaging and laboratory simplifications necessary for reliable scientific<br />
statements may wash out all the <strong>de</strong>tails that interest us“ (Höök 2004, 135). Ferner wird<br />
<strong>de</strong>n Annahmen herkömmlicher Ansätze, dass die Erfahrungen <strong>de</strong>r NutzerInnen eine<br />
Eigenschaft <strong>de</strong>s Systems selbst seien, die von <strong>de</strong>n AutorInnen <strong>de</strong>r Systeme direkt<br />
gesteuert und kontrolliert wer<strong>de</strong>n könnten und von passiven NutzerInnen „empfangen“<br />
wür<strong>de</strong>n (Sengers et al. 2004, 1), die Komplexität und Vielfalt gelebter Erfahrung<br />
entgegengestellt. „Design for Experience“ beteiligt die NutzerInnen an <strong>de</strong>n<br />
Systementwicklungs- und Bewertungsprozessen. 360 Dabei ist das Partizipationsverständnis<br />
– ganz im Sinne partizipativer Gestaltungsansätze <strong>de</strong>r skandinavischen<br />
Schule – von <strong>einer</strong> politisch reflektierten und gesellschafts<strong>kritisch</strong>en und zugleich auch<br />
wissenschafts<strong>kritisch</strong>en Grundhaltung getragen. Die VertreterInnen <strong>de</strong>s Ansatzes<br />
verstehen sich als Teil <strong>einer</strong> „Critical Design Community“, die Fragen stellt wie: „[W]hat<br />
messages are implicit in our <strong>de</strong>signs? How do users reappropriate and alter the<br />
meaning of technologies? What are our social responsibilities as <strong>de</strong>signers with<br />
respect to how users come to interpret and respond to our <strong>de</strong>signs?“ (Sengers et al.<br />
2004, 2). Sie greifen dabei theoretisch-methodisch sowohl auf <strong>kritisch</strong>e Ansätze aus<br />
Informatik und Design wie auch auf Erkenntnisse <strong>de</strong>r Wissenschafts- und<br />
359 Dies bestätigte auch eine InterviewpartnerIn in Jutta Webers und m<strong>einer</strong> Laborstudie im Forschungsbereich<br />
sozioemotionaler Softwareagenten (vgl. Bath/ Weber 2006). Sie beschrieb, dass sie das Design<br />
von virtuellen Figuren in einem früheren Projekt durch ein professionelles Usability-Labor unterstützen<br />
lassen wollte. Dabei seien jedoch „die falschen Fragen“ gestellt wor<strong>de</strong>n, um Aussagen über die emotionale<br />
Involviertheit <strong>de</strong>r User zu erhalten. Die klassischen Metho<strong>de</strong>n wären nicht in <strong>de</strong>r Lage, emotionale<br />
Ebenen <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Interaktion zu erfassen (vgl. ebd., 122).<br />
360 „[W]e believe that evaluation of affective systems is vital not just at the end of the <strong>de</strong>sign process, but<br />
as an integral part of the <strong>de</strong>sign process from the beginning. Having the ability to bounce early intuitions<br />
and <strong>de</strong>sign sketches off of real users can make key contributions to the evolution of a truly engaging end<br />
application, and may even inform the affective theory that led to the application itself“ (Höök et al. 2004, 7;<br />
Hervorhebung im Original).<br />
260
Technikforschung zurück, in<strong>de</strong>m sie beispielsweise die „interpretative Flexibilität“<br />
technologischer Artefakte, 361 ein Kernkonzept <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung,<br />
als ein Erklärungs- und Gestaltungsmo<strong>de</strong>ll für die Interaktion mit <strong>de</strong>n<br />
Artefakten heranziehen (vgl. ebd., 3).<br />
„Design for experience“ fokussiert somit nicht nur auf Nutzungserfahrungen,<br />
son<strong>de</strong>rn betont zugleich die Interpretationsleistungen, die die NutzerInnen in <strong>de</strong>r<br />
Interaktion mit <strong>de</strong>m Computer erbringen. Systeme sollen <strong>de</strong>m Ansatz nach so gestaltet<br />
sein, dass sie offen sind für verschie<strong>de</strong>ne mögliche Interpretationen. Damit wird ein<br />
konstruktivistischer Ansatz vertreten, <strong>de</strong>mzufolge NutzerInnen selbst <strong>de</strong>n Sinn <strong>de</strong>r<br />
Interaktion mit <strong>de</strong>m Computer herstellen und Be<strong>de</strong>utungen produzieren.<br />
In<strong>de</strong>m Interpretationen durch die NutzerInnen ins Zentrum gerückt wer<strong>de</strong>n, ergäben<br />
sich neue Möglichkeiten, literarische Strategien für die Technikgestaltung anzupassen,<br />
um neue Interpretationen von und Erfahrungen mit Technologien anzuregen (Sengers<br />
et al. 2004, 3). Gaver, Beaver und Benford (2003) schlagen etwa vor, Ambiguität<br />
explizit in die Systeme hineinzukonzipieren, um für die NutzerInnen verschie<strong>de</strong>ne<br />
Deutungen offen zu halten. Ein Beispiel für diesen Zugang stellt das PRESENCE<br />
PROJECT (Gaver/ Dunne 1999) dar, das darauf zielt, die Präsenz älterer Menschen in<br />
größeren nie<strong>de</strong>rländischen Wohngegen<strong>de</strong>n zu erhöhen. Dazu wur<strong>de</strong>n Stimmen, Bil<strong>de</strong>r<br />
und Filme, welche die Interessen und Be<strong>de</strong>nken von SeniorInnen, aber auch ihren<br />
Stolz über ihre Wohngegend <strong>de</strong>utlich machen, in die Rückenlehnen von Parkbänken<br />
im öffentlichen Raum projiziert. Diese „Sloganbenches“ zeigten handgeschriebene<br />
Sprüche, <strong>de</strong>ren Inhalte mit <strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>rn <strong>einer</strong> so genannten „Imagebank“ verbun<strong>de</strong>n<br />
waren, auf <strong>de</strong>nen die SeniorInnen in Vi<strong>de</strong>os Aspekte ihres eigenen Lebens vorstellten.<br />
Das System erzeugte auf verschie<strong>de</strong>ne Weise eine Ambiguität und Offenheit. Zum<br />
einen waren die dargestellten Sprüche aus ihrem Kontext herausgegriffen, so dass die<br />
LeserInnen die darin gespiegelten Einstellungen interpretieren mussten. Ferner war die<br />
Verknüpfung zwischen <strong>de</strong>n Slogans und <strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>rn nicht immer offensichtlich, teils<br />
sogar wi<strong>de</strong>rsprüchlich. Die größte Unein<strong>de</strong>utigkeit bestand jedoch im Design <strong>de</strong>r<br />
Objekte selbst. So wur<strong>de</strong> durch die Parkbänke eine Spannung zwischen Sehen und<br />
Sitzen hergestellt, da ein Hinsetzen auf die Bank be<strong>de</strong>utet hätte, die Sprüche und<br />
Bil<strong>de</strong>r zu ver<strong>de</strong>cken: „they balanced the familiar with the strange“ (Gaver et al. 2003,<br />
2).<br />
Die Gestaltungsphilosophie <strong>de</strong>s „Design for Experience“ bietet auf min<strong>de</strong>stens zwei<br />
Ebenen Anschlüsse an Grundverständnisse <strong>de</strong>r Geschlechterforschung. Zum einen<br />
wer<strong>de</strong>n Erfahrungen, Körper und Emotionen, die dort lange Zeit ignoriert wur<strong>de</strong>n, nun<br />
zum Gegenstand von Technikgestaltung. Dies wur<strong>de</strong> am Beispiel von Emotionen<br />
bereits im Kapitel 4.3.3. <strong>de</strong>monstriert. In diesem Kontext versteht sich „Design for<br />
Experience“ als eine Gegenposition zu <strong>de</strong>m Ansatz, <strong>de</strong>n Maschinen Emotionen einzuschreiben<br />
– ein Vorgehen, das Gefühl auf Informationsflüsse bzw. auf soziobiologisch<br />
begrün<strong>de</strong>te Ökonomie reduziert. „Design for Experience“ beabsichtigt dagegen nicht,<br />
Erfahrung, Körperlichkeit o<strong>de</strong>r Emotionen – wie oft üblich – reduktionistisch zu<br />
integrieren, in<strong>de</strong>m die Konzepte möglichst vollständig formalisiert in das System<br />
eingeschrieben wer<strong>de</strong>n. Vielmehr bietet dieser Ansatz die Chance, eine Essentialisierung<br />
und Verdinglichung von Erfahrung, Verkörperung und Emotionen zu<br />
361 Vgl. Kapitel 3.3. für eine Erläuterung dieses Begriffs.<br />
261
vermei<strong>de</strong>n. Denn „<strong>de</strong>signing for experience“ versteht sich als Gegenbewegung zu<br />
„<strong>de</strong>signing experience into an interface or system“ (Sengers et al. 2005, 52, Hervorhebung<br />
im Orig.). Damit wird <strong>de</strong>r langjährige Anspruch feministischer Technikkritiken,<br />
ausgeschlossene, verkörperte und emotionale Erfahrungen bei <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
zu berücksichtigen, auf eine <strong>kritisch</strong>e (statt wie insbeson<strong>de</strong>re mit <strong>de</strong>n kognitivistischen<br />
Ansätzen simplifizieren<strong>de</strong>) Weise eingelöst.<br />
Zum zweiten – und für das hier verfolgte Ziel eines De-Gen<strong>de</strong>ring von Technologien<br />
<strong>de</strong>r Selbstgestaltung viel grundlegen<strong>de</strong>r – eröffnet sich die Möglichkeit, das Design<br />
speziell auf die Erfahrung <strong>de</strong>r Geschlechtlichkeit selbst auszurichten statt einen<br />
allgemein umfassen<strong>de</strong> Erfahrungsraum für die NutzerInnen im Sinne phänomenologischer<br />
Ansätze zu kreieren. Wird „Design for Experience“ auf diese Weise um die<br />
Kategorie Geschlecht erweitert und zugespitzt gedacht, lässt sich die Herstellung von<br />
Geschlechtszugehörigkeit auf <strong>de</strong>r Mikroebene als ein konstruktiver Prozess verstehen,<br />
<strong>de</strong>r zwischen System, TechnikgestalterInnen und NutzerInnen entsteht. Eine solche<br />
Auffassung korreliert mit <strong>de</strong>m Konzept <strong>de</strong>s „Doing Gen<strong>de</strong>r“ aus <strong>de</strong>r Geschlechtersoziologie<br />
(vgl. West/ Zimmerman 1987, West/ Fenstermaker 1995), <strong>de</strong>mzufolge<br />
Geschlecht in <strong>de</strong>r Interaktion von Wahrnehmung und Darstellung hervorgebracht wird,<br />
ergänzt diesen jedoch um eine Mitbeteiligung technologischer Artefakte an <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterkonstruktion. Auf <strong>de</strong>r Folie feministischer Ansätze gelesen bietet „Design<br />
for Experience“ insgesamt die Möglichkeit, eine Gestaltung von Systemen zu <strong>de</strong>nken,<br />
die <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen mittels Technologie die Erfahrung ermöglicht, Geschlecht als<br />
einen Prozess <strong>de</strong>s „Doing Gen<strong>de</strong>r“, als eine soziale Konstruktion, mithin als Performanz<br />
zu begreifen, die sich par excellence in <strong>de</strong>n vorgeschlagenen Theorierahmen<br />
einbetten lässt. Technikgestaltung auf dieser Basis erlaubt ein Erproben, Erfahren und<br />
Begreifen <strong>de</strong>s konstruktiven und performativen Charakters von „Weiblichkeiten“ und<br />
„Männlichkeiten“, die angewandt auf die bei<strong>de</strong>n Formen <strong>de</strong>r informatischen<br />
Repräsentation <strong>de</strong>s Selbst, virtuelle StellvertreterInnen <strong>de</strong>r NutzerInnen und virtuelle<br />
Menschen, eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie darstellt. Dies ließe sich meines Erachtens<br />
auf wenigstens drei verschie<strong>de</strong>ne Weisen umsetzen:<br />
Erstens legt die Verknüpfung von „Doing Gen<strong>de</strong>r“ mit „Design for Experience“ eine<br />
Gestaltung nahe, die zum virtuellen Geschlechtsrollentausch ermuntert, <strong>de</strong>ssen Potential,<br />
das Zweigeschlechtlichkeitssystem zu hinterfragen, seit <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>s Internet<br />
immer wie<strong>de</strong>r beschworen wor<strong>de</strong>n ist (vgl. Kapitel 4.2.5.). Diese Möglichkeit <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen, virtuelle Erfahrungen in einem an<strong>de</strong>ren Geschlecht zu machen, hatte<br />
jedoch mit <strong>de</strong>r Verschiebung von textbasierten hin zu grafisch stark ausgeprägten<br />
Onlinesysteme einen die Kategorie Geschlecht eher verfestigen<strong>de</strong>n als auflösen<strong>de</strong>n<br />
Charakter erhalten. Insofern gilt es das Problem zu lösen, Verkörperungen grafisch so<br />
darzustellen und zu animieren, dass sie das bestehen<strong>de</strong> Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
zu unterlaufen vermögen und nicht erneut bestätigen. Die im Kontext <strong>de</strong>s „Design<br />
for Experience“ skizzierte Technik, Ambiguität herzustellen, verspricht hier zweitens<br />
neue Gestaltungsmöglichkeiten, die jenseits <strong>einer</strong> Vervielfältigung von bisher stereotypisierten<br />
„Weiblichkeiten“ und „Männlichkeiten“ liegen, wie sie mit <strong>de</strong>r Anpassung an<br />
real existieren<strong>de</strong> Körper erreicht wür<strong>de</strong>. Statt<strong>de</strong>ssen ginge dieses Design über <strong>de</strong>n<br />
Rahmen <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n binären Geschlechtersystems hinaus. Denn <strong>de</strong>r<br />
Ambiguitätsgedanke, übertragen auf die Vergeschlechtlichung virtueller Charaktere,<br />
kann als eine Strategie <strong>de</strong>r Verunein<strong>de</strong>utigung <strong>de</strong>s jeweils konzipierten Geschlechts<br />
262
verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. So ließen sich die virtuellen Figuren zur Selbstrepräsentation und<br />
Repräsentation von Organisationen androgyn gestalten o<strong>de</strong>r Merkmale, die für Formen<br />
von „Männlichkeit „stehen, mit solchen kombinieren, die Formen von „Weiblichkeit“<br />
anzeigen bzw. umgekehrt. Beispielsweise könnten Männerkörper mit <strong>einer</strong> Frauenstimme<br />
versehen, Gesichter von Frauen mit Bärten dargestellt und an<strong>de</strong>re gegen die<br />
jeweilig vorherrschen<strong>de</strong> Geschlechternorm verstoßen<strong>de</strong> Aspekte gezeigt bzw.<br />
zusammengebracht wer<strong>de</strong>n. Drittens bietet das genannte Morphing, das <strong>de</strong>n<br />
fließen<strong>de</strong>n Übergang von <strong>einer</strong> Grafik eines Gesichtes bzw. Körpers zu einem an<strong>de</strong>ren<br />
herstellt, eine weitere technische Gestaltungsmöglichkeit. Es eröffnet die Option, dass<br />
virtuelle Menschen ihr Geschlecht in gewissen zeitlichen Abstän<strong>de</strong>n automatisch<br />
wechseln. Die drei Vorschläge <strong>de</strong>r Verunein<strong>de</strong>utigung von Geschlecht unterlaufen<br />
Grundannahmen <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Zweigeschlechtlichkeitssystems, nach <strong>de</strong>nen je<strong>de</strong><br />
Person ein und nur eines von zwei Geschlechtern hat und dieses zugleich unverän<strong>de</strong>rbar<br />
ist (vgl. hierzu auch Bath 2001a). In diesem Sinne könnten sie als eine De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Strategie für virtuelle RepräsentantInnen, aber auch im Fall <strong>de</strong>r menschenähnlichen<br />
Maschinen eingesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Jedoch liegen meines Wissens bislang noch keine Versuche <strong>de</strong>r technischen<br />
Umsetzung <strong>de</strong>rartiger <strong>de</strong>konstruktiver I<strong>de</strong>en vor. Allein im Bereich <strong>de</strong>r Kunst fin<strong>de</strong>n<br />
sich Beispiele, die auf ähnliche Weise versuchen, die binäre Geschlechterordnung zu<br />
unterlaufen. 362 Dieses Fehlen von feministischen Umsetzungsversuchen für Technologien<br />
<strong>de</strong>r Selbstgestaltung kann im Fall <strong>de</strong>r virtuellen Menschen zum Teil darauf<br />
zurückgeführt wer<strong>de</strong>n, dass die ForscherInnen und EntwicklerInnen dieses Bereichs<br />
danach streben, möglichst konsistente virtuelle Persönlichkeiten zu konstruieren (vgl.<br />
Bath/ Weber 2006). Ihr selbst erklärtes Ziel, artifizielle Charaktere als „glaubwürdige“<br />
zu kreieren, geht gera<strong>de</strong> nicht mit einem postmo<strong>de</strong>rnen Konzept vielfältiger und instabiler<br />
Subjektivität sowie turbulent-flexibler Körper (vgl. Weber/ Bath 2003) einher,<br />
welches für die vorgeschlagene De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie vorauszusetzen wäre, son<strong>de</strong>rn<br />
grün<strong>de</strong>t vielmehr auf einem in <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne wurzeln<strong>de</strong>n Verständnis einheitlicher<br />
I<strong>de</strong>ntität und Körperlichkeit.<br />
Dies erklärt jedoch nicht, warum <strong>de</strong>r Bereich <strong>de</strong>r Vi<strong>de</strong>o- und Computerspiele solche<br />
<strong>de</strong>konstruktiven Techniken bisher nicht stärker einsetzt, gilt dieser doch gemeinhin als<br />
kreativer, mutiger und provokativer als die Künstliche Intelligenz, die sich oft auf ein<br />
kognitivistisches und positivistisches Menschenbild bezieht. Diese Frage stellt sich<br />
insbeson<strong>de</strong>re für pädagogisch motivierte Spiele, die vereinzelt bereits darauf abzielen<br />
<strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen zu ermöglichen, neue Rollen virtuell zu erproben o<strong>de</strong>r Herstellungs-<br />
und Zuweisungsprozesse von Geschlechtlichkeit <strong>kritisch</strong> zu reflektieren (vgl.<br />
etwa Hanappi-Egger 2007). Die prinzipiell <strong>de</strong>nk- und realisierbaren Techniken <strong>de</strong>r<br />
Vervielfältigung und Verunein<strong>de</strong>utigung von Geschlecht könnten gera<strong>de</strong> dort<br />
beson<strong>de</strong>rs wirkungsvoll für die Kreation alternativer virtueller StellvertreterInnen und<br />
Spielfiguren angewandt wer<strong>de</strong>n.<br />
362 Am bekanntesten sind das 1997 in <strong>de</strong>r Digitalen Stadt Amsterdam (www.dds.nl) veröffentlichte Kalen<strong>de</strong>r-Projekt<br />
„Women with Beards“, das lei<strong>de</strong>r nicht mehr zugänglich ist (vgl. hierzu etwa Weber 2001),<br />
sowie die changieren<strong>de</strong>n Toilettenpiktogramme, die She Lea Cheang in Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n 1993<br />
ermor<strong>de</strong>ten Transgen<strong>de</strong>r Brandon Teena kreierte (http://brandon.guggenheim.org/, letzter Zugriff am<br />
13.12.08).<br />
263
Für bei<strong>de</strong> Bereiche kann vermutet wer<strong>de</strong>n, dass das Zweigeschlechtlichkeitssystem<br />
so tief und selbstverständlich verankert ist, dass es <strong>de</strong>n GestalterInnen schwer fällt,<br />
Vorschläge <strong>de</strong>r Verunein<strong>de</strong>utigung von Geschlecht bei <strong>de</strong>n Spielfiguren technisch<br />
umzusetzen, zu testen und die Reaktion von NutzerInnen zu evaluieren. Es ist jedoch<br />
auch möglich, dass <strong>de</strong>r vom „Design for Experience“-Ansatz adaptierte Weg für ein De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring virtueller Figuren scheitern wird, da Produkte solch provokativen Designs,<br />
welche die vorherrschen<strong>de</strong>n Sichtweisen durchkreuzen, von <strong>de</strong>n NutzerInnen nicht<br />
notwendigerweise angenommen wer<strong>de</strong>n. Darauf <strong>de</strong>uten etwa die Einschätzungen von<br />
Sengers und ihren KollegInnen zu einem Gestaltungsansatz, <strong>de</strong>r zwar nicht auf eine<br />
De-Konstruktion von Geschlecht zielt, aber Kritik an <strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n Konsumkultur<br />
übt und versucht, <strong>de</strong>ren Werte subversiv zu untergraben: „[T]he provocative<br />
nature of critical <strong>de</strong>sign can backfire if people miss the ironic or subtle commentary. On<br />
the other hand, this may result in simply discounting the <strong>de</strong>sign as ridiculous or<br />
extreme without examining why“ (Sengers et al. 2005, 51).<br />
Sie selbst schlagen <strong>de</strong>shalb vor, durch eine entsprechen<strong>de</strong> Technologiegestaltung<br />
Reflektionen über <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Kritik stehen<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r fragwürdigen Gegenstand direkt<br />
hervorzurufen und nicht nur zu versuchen, Irritationen und Überraschungsmomente bei<br />
<strong>de</strong>n BetrachterInnen zu erzeugen, wie es etwa die politische Kunst o<strong>de</strong>r das „Design<br />
for Experience“ anstrebt. Sengers, Boehner, David und Kaye bezeichnen einen<br />
solchen Gestaltungsanspruch konsequenterweise als „Reflective Design“.<br />
5.4.3. „Reflective Design“: Prozesse <strong>de</strong>r Reflektion <strong>de</strong>s Zweigeschlechtlichkeitssystems<br />
bei GestalterInnen und NutzerInnen mit offenem Ausgang<br />
„Reflective Design“ (Sengers et al. 2005) zielt primär darauf, kulturell verankerte Werte<br />
und unbewusste Annahmen, die technischen Artefakten o<strong>de</strong>r bereits <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n<br />
und Praktiken zu ihrer Konstruktion eingeschrieben sind, bewusst zu machen, um auf<br />
dieser Grundlage alternative Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln und auszuprobieren.<br />
Die zu entwickeln<strong>de</strong>n Artefakte sollen damit nicht nur umfassen<strong>de</strong> Erfahrungen,<br />
son<strong>de</strong>rn zugleich eine Reflektion gesellschaftlich-kultureller Selbstverständnisse<br />
ermöglichen: „reflection itself should be a core technology <strong>de</strong>sign outcome of HCI“<br />
(Sengers et al. 2005, 50).<br />
Dazu kombiniert „Reflective Design“ <strong>kritisch</strong>e Theorien – d.h. Reflektion – mit <strong>kritisch</strong>en<br />
Technikgestaltungsansätzen. Reflektion wird dabei als <strong>kritisch</strong>e Reflektion im<br />
Sinne von Gesellschaftskritik bzw. -theorie verstan<strong>de</strong>n. So nimmt „Reflective Design“<br />
theoretische Anleihen bei marxistischen, feministischen und postkolonialen Ansätzen,<br />
Kultur- und Medienwissenschaften sowie Psychoanalyse. Auf dieser Grundlage sollen<br />
Selbstverständnisse und unbewusste Aspekte bei <strong>de</strong>r Technikgestaltung offen gelegt<br />
und somit – als ein erster Schritt möglicher Verän<strong>de</strong>rung – <strong>de</strong>r bewussten Entscheidung<br />
zugänglich gemacht wer<strong>de</strong>n. „Critical theory argues that our everyday value,<br />
practices, perspectives, and sense of agency and self are strongly shaped by forces<br />
and agendas of which we are normally unaware such as the politics of race, gen<strong>de</strong>r<br />
and economics.“ (Sengers et al. 2005, 50).<br />
Der Ansatz bleibt jedoch nicht bei <strong>einer</strong> <strong>kritisch</strong>en Bewusstmachung impliziter<br />
Vorannahmen stehen, son<strong>de</strong>rn setzt diese Erkenntnisse in die Praxis <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
um. „Reflective Design“ arbeitet mit verschie<strong>de</strong>nen Metho<strong>de</strong>n <strong>kritisch</strong>er<br />
264
Technologiegestaltung in <strong>de</strong>r Informatik. Er umfasst vor allem Elemente aus <strong>de</strong>m<br />
Particapatory Design, Value Sensitive Design, Critical Technical Practice sowie<br />
„Design for Experience“, 363 die geeignet ausgewählt und kombiniert wer<strong>de</strong>n, so dass<br />
sowohl <strong>de</strong>r Prozess als auch das Produkt Reflektionen bei <strong>de</strong>n DesignerInnen und<br />
NutzerInnen anzustoßen vermag. Ziel ist es, die Artefakte selbst als Akteure <strong>kritisch</strong>er<br />
Positionen zu konzipieren: „reflective <strong>de</strong>sign is about building technologies that<br />
embody a critical perspective“ (Sengers 2005, o.S.).<br />
In<strong>de</strong>m Reflektion dabei nicht als eine rein kognitive Tätigkeit verstan<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn<br />
als verwoben mit je<strong>de</strong>r Wahrnehmung und Erfahrung <strong>de</strong>r Welt aufgefasst wird, baut<br />
<strong>de</strong>r Ansatz auf <strong>de</strong>n Konzepten <strong>de</strong>s „Design for Experience“ auf. Im Gegensatz zu<br />
letzterem zielt „Reflective Design“ jedoch nicht nur auf Reflektionsprozesse bei <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen, son<strong>de</strong>rn zugleich auf <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess <strong>de</strong>r DesignerInnen.<br />
Dies korrespondiert mit <strong>de</strong>r Verschiebung, nicht mehr nur auf Erfahrung zu fokussieren,<br />
son<strong>de</strong>rn tief greifen<strong>de</strong> Voraussetzungen und grundlegen<strong>de</strong> Annahmen <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung eines Artefaktes herauszuarbeiten und ggf. zu verän<strong>de</strong>rn. Damit bietet <strong>de</strong>r<br />
Ansatz prinzipiell die Möglichkeit, auch solchen Vergeschlechtlichungsprozessen zu<br />
begegen, die aus <strong>de</strong>n impliziten Geschlechter-Vorstellungen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen<br />
resultieren. Insbeson<strong>de</strong>re aufgrund seines expliziten Bezugs auf Geschlechtertheorien,<br />
durch <strong>de</strong>n er sich vom „Design for Experience“ unterschei<strong>de</strong>t, birgt er das Potential,<br />
vorherrschen<strong>de</strong> gesellschaftliche Selbstverständnisse von Geschlecht zu überwin<strong>de</strong>n.<br />
Solche Selbstverständnisse – wie das Zweigeschlechtlichkeitsmo<strong>de</strong>ll – hatten sich speziell<br />
bei <strong>de</strong>r Konstruktion menschenähnlicher Maschinen und virtueller StellvertreterInnen<br />
als Barrieren für die Gestaltung geschlechtlich unein<strong>de</strong>utiger Charaktere erwiesen.<br />
Der Ansatz erscheint nicht nur konzeptuell geeignet für ein De-Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Technologien <strong>de</strong>r Selbstgestaltung, son<strong>de</strong>rn umfasst – im Vergleich zu <strong>de</strong>m vorangehend<br />
beschriebenen „Design for Experience“ – konkret ausformulierte Prinzipien und<br />
Strategien. Den Gestaltungsprinzipien zufolge soll die Reflektion auf vier Ebenen<br />
zielen: 1. auf die impliziten Annahmen und Selbstverständnisse im Technikgestaltungsprozess,<br />
2. auf eine Selbstreflektion <strong>de</strong>r DesignerInnen, die sich ihrer eigenen Rolle im<br />
Gestaltungsprozess bewusst wer<strong>de</strong>n sollen, 3. sollen die NutzerInnen durch das<br />
System darin unterstützt wer<strong>de</strong>n, über ihr eigenes Leben zu reflektieren und 4. soll die<br />
Technologie, d.h. das Produkt, die Anwen<strong>de</strong>rInnen dazu anregen, <strong>de</strong>ssen Funktion zu<br />
hinterfragen und Re-Interpretationen vorzunehmen. Dabei wird davon ausgegangen,<br />
dass gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r intensive Austausch und die intensive Zusammenarbeit zwischen<br />
NutzerInnen und DesignerInnen eine Reflektion auf diesen verschie<strong>de</strong>nen Ebenen<br />
beför<strong>de</strong>rn und vertiefen können. Ferner grün<strong>de</strong>t „Reflective Design“ auf <strong>de</strong>r Annahme,<br />
dass diese <strong>kritisch</strong>e Reflektion einen direkten Einfluss auf Handlungen und Praxen <strong>de</strong>r<br />
Subjekte hat.<br />
Zur Umsetzung dieser Ziele schlägt <strong>de</strong>r Ansatz eine Reihe von Strategien vor, die<br />
auf Reflektionen bei <strong>de</strong>n NutzerInnen und <strong>de</strong>n DesignerInnen zielen, und aufgrund<br />
363 „Participatory Design“ wur<strong>de</strong> im letzten Kapitel 5.3. beschrieben, „Value Sensitive Design“ und „Critical<br />
Technical Practice“ im nachfolgen<strong>de</strong>n Kapitel 5.5. erklärt. Ferner grün<strong>de</strong>t „Reflective Design“ im „Critical<br />
Design“, „Ludic Design“ und <strong>de</strong>m „Reflection-in-Action“-Ansatz, die ich hier grob unter „Design for<br />
Experience“ subsumiere. Sengers selbst bezeichnet <strong>de</strong>n letzteren Ansatz als „Reflective HCI“, betrieben<br />
von „people who are interested in bringing this kind of self reflexive mo<strong>de</strong> into HCI – in the same way that<br />
self-reflexivity is integral to e.g. anthropology, cultural studies or humanistic or artistic disciplines“ (Sengers<br />
2005, o.S.).<br />
265
laufen<strong>de</strong>r Erfahrung erweitert und ergänzt wer<strong>de</strong>n sollen. Dazu gehört es, die Artefakte<br />
so zu konzipieren, dass die NutzerInnen selbst <strong>de</strong>n Sinn und die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r<br />
Technologie herstellen. Die „interpretative Flexibilität“ 364 impliziert, dass sie an <strong>de</strong>r<br />
Be<strong>de</strong>utungskonstruktion grundlegend partizipieren und dafür mitverantwortlich sind.<br />
Die NutzerInnen sollen jedoch darüber hinaus aktiv zum System beitragen, etwa zu<br />
<strong>de</strong>ssen Inhalten, aber auch durch ein dynamisches Feedback während <strong>de</strong>r Gestaltung<br />
und Nutzung. Aufgabe <strong>de</strong>r DesignerInnen sei es, ein wertvolles und umfassen<strong>de</strong>s<br />
Feedback von <strong>de</strong>n Anwen<strong>de</strong>rInnen zu ermöglichen und zu beför<strong>de</strong>rn. Technologische<br />
Produkte sollen als Experimente verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, mit <strong>de</strong>nen nicht nur ein besseres<br />
Verständnis <strong>de</strong>r NutzerInnen und <strong>de</strong>r Effekte von Technologien-im-Gebrauch erzielt<br />
wer<strong>de</strong>n soll. Vielmehr seien diese Experimente zugleich ein Spiegel für die Praktiken<br />
<strong>de</strong>r Technikgestaltung und -evaluation, <strong>de</strong>r dazu dienen kann, die Herstellungsweise<br />
zu reflektieren.<br />
Als konkrete Metho<strong>de</strong>n bzw. Techniken <strong>de</strong>s „Reflective Design“ wird vorgeschlagen,<br />
Ambiguität und Verfremdung herzustellen sowie Metaphern zu invertieren. Sind die<br />
Systeme unein<strong>de</strong>utig, so for<strong>de</strong>re dies die NutzerInnen und GestalterInnen heraus, <strong>de</strong>n<br />
Sinn <strong>de</strong>r Technologie selbst herzustellen. Einen ähnlichen Effekt hätten Systeme, die<br />
das gemeinhin Bekannte etwa durch Verschiebung <strong>de</strong>s Kontextes befremdlich<br />
machen. Ferner könne es eine reichhaltige Inspirationsquelle für das Design darstellen,<br />
traditionelle Metaphern <strong>de</strong>r Technikgestaltung zu hinterfragen und ggf. umzukehren.<br />
Während <strong>de</strong>r Verunein<strong>de</strong>utigungsansatz bereits im Kontext <strong>de</strong>s „Design for<br />
Experience“ vorgestellt wur<strong>de</strong>, gehört die Invertierung von Metaphern zum Kern <strong>de</strong>s<br />
„Critical Technical Practice“-Ansatzes, <strong>de</strong>r im nächsten Kapitel 5.5 ausführlicher<br />
beschrieben wird. Deshalb wer<strong>de</strong> ich an dieser Stelle nur auf die aus Literatur und<br />
Theater entlehnte Strategie <strong>de</strong>r Verfremdung näher eingehen, die im Gegensatz zur<br />
Herstellung von Ambiguität auf die DesignerInnen zielt.<br />
Verfremdung als ein Mittel <strong>de</strong>r Technologiegestaltung wur<strong>de</strong> erstmals explizit auf<br />
einem Workshop <strong>de</strong>r CHI 2003 vorgeschlagen (Bell et al. 2003), um neue<br />
Gestaltungsräume zu eröffnen, die ansonsten aufgrund nicht reflektierter Vorannahmen<br />
verschlossen blieben. Doch lassen sich ältere Ansätze darunter ebenso subsumieren,<br />
wie etwa <strong>de</strong>r Einsatz von extremen Charakteren 365 statt <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r HCI üblichen<br />
„prototypischen NutzerIn“ zur Repräsentation <strong>de</strong>r Zielgruppe, für die eine Technologie<br />
gestaltet wer<strong>de</strong>n soll (Djajadiningrat et al. 2000). Ziel <strong>de</strong>r Verfremdungstechnik ist es,<br />
implizite Annahmen über NutzerInnen, kulturelle Selbstverständnisse und an<strong>de</strong>re alltagsübliche<br />
Interpretationen, die Technologien zugrun<strong>de</strong> liegen, zu entlarven, um Alternativen<br />
zur herkömmlichen Gestaltung vorschlagen zu können. Dabei wird davon<br />
ausgegangen, dass die mittels Verfremdung erzielten Entwürfe auch für die „normalen“<br />
NutzerInnen interessant und brauchbar sein können. Es wird betont, dass Verfremdung<br />
keine wissenschaftliche Metho<strong>de</strong> sei o<strong>de</strong>r auf ein besseres Verständnis <strong>de</strong>r NutzerInnen<br />
ziele, son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen eine Brille zur Verfügung stelle, die es<br />
ermögliche, ihre eigenen Praktiken in einem an<strong>de</strong>ren und neuen Licht zu sehen (vgl.<br />
364 Das Konzept <strong>de</strong>r „interpretativen Flexibilität“, welches <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung entlehnt<br />
ist, teilt <strong>de</strong>r Ansatz mit <strong>de</strong>m „Design for Experience“, vgl. hierzu auch Kapitel 3.3.<br />
365 Djajadiningrat et al. 2000 etwa nutzten Profile eines Drogen<strong>de</strong>alers, <strong>de</strong>s Papstes und <strong>einer</strong> 20-jährigen,<br />
die gleichzeitig mehrere sexuelle Kontakte pflegt, um einen elektronischen Terminplaner für PDAs zu<br />
entwerfen.<br />
266
Bell et al. 2005, 169). Verfremdung sei primär eine literarische Strategie „De-familiarization<br />
is first and foremost a literary <strong>de</strong>vice, a style of writing“ (ebd.).<br />
Als Beispiel für ein „Making by making strange“ (Bell et al. 2005) nutzen die AutorInnen<br />
kulturelle Unterschie<strong>de</strong>, die innovative Designi<strong>de</strong>en in Bezug auf im häuslichen<br />
Bereich eingesetzte Technologien generieren sollen. Dabei wird die Verfremdung<br />
darüber hergestellt, dass sie die politische Geschichte US-amerikanischer Küchen mit<br />
ethnographischen Studien über Familienleben in Großbritannien und Asien kontrastieren.<br />
Dieser Kulturvergleich ver<strong>de</strong>utliche, dass es genügt, in Gedanken zu reisen.<br />
Dennoch sei – ebenso wie bei traditionellen Formen <strong>de</strong>r Aufgabenanalyse in HCI –<br />
eine gewisse Strenge in <strong>de</strong>r Durchführung notwendig, sowie eine Aufmerksamkeit für<br />
Details, die als selbstverständlich gelten. Eine breite Kenntnis von historischen, politischen<br />
o<strong>de</strong>r anthropologischen Studien könne dazu äußerst hilfreich sein. Auf dieser<br />
Grundlage arbeiteten Bell, Blythe und Sengers eine Reihe gängiger Annahmen über<br />
die im Haushalt eingesetzten Technologien heraus, die von <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen<br />
häufig unhinterfragt übernommen und in das Design <strong>de</strong>r Artefakte eingeschrieben<br />
wür<strong>de</strong>n. So wer<strong>de</strong> (Haushalts-)Technologie zumeist mit Effizienz gleichgesetzt, was<br />
sich jedoch technikhistorischen und darunter insbeson<strong>de</strong>re feministischen Studien<br />
zufolge als Mythos erwiesen hat. 366 Eine weitere Annahme läge darin, Haushalte als in<br />
sich geschlossen zu unterstellen. Dagegen hätte <strong>de</strong>r Kulturvergleich gezeigt, dass jene<br />
nur in ihrer Verbindung zu an<strong>de</strong>ren Haushalten und ihrer Einbettung in Gemeinschaften<br />
zu verstehen sind. Feministisch-gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Untersuchungen<br />
dienen dabei nicht nur als theoretischer Hintergrund, um mittels Verfremdung gängige<br />
Selbstverständnisse zu entlarven. Vielmehr nehmen die AutorInnen sogar explizit auf<br />
in Technologien eingeschriebene Geschlechterannahmen Bezug. „Gen<strong>de</strong>r assumptions<br />
about labor [...] built into technology and reinforce stereotypes about who in the<br />
home should do what“ (Bell et al. 2005, 168). TechnikgestalterInnen hätten dagegen<br />
jedoch die Möglichkeit, diese eingebauten Geschlechtsvorstellungen zu verän<strong>de</strong>rn und<br />
neue Verhaltensmuster zu unterstützen. Die AutorInnen betonen, dass eine solche<br />
Gestaltungsstrategie mittels <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ (vgl. Kapitel<br />
5.2.) nicht bewerkstelligt wer<strong>de</strong>n könne, da die Verfremdungstechnik darauf zielt,<br />
alternative Wünsche, Bedürfnisse und Verhaltensweisen zu formen statt bei <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen bereits vorliegen<strong>de</strong> Wünsche und Bedürfnisse zu unterstützen.<br />
Insgesamt erscheint „Reflective Design“ aufgrund <strong>de</strong>s theoretischen Ansatzes wie<br />
auch <strong>de</strong>r praktischen Strategien <strong>de</strong>r Gestaltung noch besser als das „Design for<br />
Experience“ dazu geeignet, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Technologien <strong>de</strong>s Selbst<br />
entgegen zu wirken. Es zielt auf eine umfassen<strong>de</strong>re Kritik, in<strong>de</strong>m hier nicht nur bei <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen mittels künstlerisch-provokativer Strategien Wirkungen evoziert, son<strong>de</strong>rn<br />
auch bei <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen Reflektionsprozesse in Gang gesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
sollen. Ferner wird auf einen breiten Hintergrund <strong>kritisch</strong>er Gesellschaftsanalysen<br />
zurückgegriffen, innerhalb <strong>de</strong>ssen die Ergebnisse <strong>de</strong>r Geschlechterforschung einen<br />
zentralen Stellenwert haben. Diese theoretischen Bezüge ermöglichen zugleich, <strong>de</strong>r<br />
Einschreibung geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung in Software o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r stereo-<br />
366 „Domestic technologies often tra<strong>de</strong> one kind of task for another (cleaning for shopping in the case of<br />
the food processor), create work by raising standards, or make a variety of zero-sum tra<strong>de</strong>offs between<br />
saving time and saving labor“ (Bell et al. 2003, 166) fassen die AutorInnen einige Gegenargumente<br />
feministischer Studien (z.B. Cowan 1983) zusammen.<br />
267
typen Markierung von Kompetenzen zu begegnen, wie das Beispiel <strong>de</strong>r Verfremdung<br />
von Haushaltstechnologien ver<strong>de</strong>utlicht. „Reflective Design“ stellt damit eine weitere<br />
Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring für diejenigen Technologien zur Verfügung, die in Kapitel<br />
4.2. und in diesem Kapitel angesprochen wur<strong>de</strong>n.<br />
Die Metho<strong>de</strong> liefert aufgrund <strong>de</strong>ssen <strong>einer</strong>seits mehr als eine De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Strategie für Technologien zu Selbstgestaltung, die in diesem Kapitel 5.4. nachgefragt<br />
war. An<strong>de</strong>rseits bleibt ihr Potential hinsichtlich <strong>de</strong>r De-Konstruktion von Geschlecht<br />
insbeson<strong>de</strong>re bei <strong>de</strong>n virtuellen StellvertreterInnen und menschenähnlichen Maschinen<br />
unkonkret, da bislang noch keine Umsetzungsversuche <strong>de</strong>s Ansatzes mit Bezug auf<br />
die Vergeschlechtlichung von Subjektrepräsentationen vorliegen. Denn während sich<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>s „Design for Experience“ zumin<strong>de</strong>st einige Zielrichtungen aufzeigen<br />
lassen, wie sich ent-vergeschlechtlichte Technologien <strong>de</strong>r Selbstgestaltung <strong>de</strong>nken<br />
lassen, verbleibt <strong>de</strong>r Ausgang eines Gestaltungsprozesses mit Hilfe <strong>de</strong>s „Reflective<br />
Design“ im Spekulativen, da <strong>de</strong>r Prozess ein offener ist, <strong>de</strong>r erfahrungsgemäß nicht auf<br />
ein bestimmtes Ergebnis hin auszurichten ist.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz erscheinen die in diesem Kapitel 5.4. vorgestellten Metho<strong>de</strong>n und<br />
ihre zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n theoretischen Positionen für das hier angestrebte Vorhaben<br />
<strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring von Konstruktionen <strong>de</strong>s Selbst in und durch Technologien, die im<br />
Kapitel 4.2.5. als zutiefst vergeschlechtlichte und normalisierte Subjektkonstitutionen<br />
aufgezeigt wur<strong>de</strong>n, äußerst viel versprechend. Zum einen eröffnen sie die Möglichkeit,<br />
das Geschlecht <strong>de</strong>r virtuellen Figuren und materiellen Verkörperungen zu vervielfältigen<br />
und zu verunein<strong>de</strong>utigen o<strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong> Normen <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit<br />
technisch zu verletzen, um damit <strong>de</strong>n NutzerInnen über die viel zitierte Variante <strong>de</strong>s<br />
Geschlechtsrollentauschs hinaus neue Erfahrungen mit androgyn bzw. gebrochen<br />
vergeschlechtlichten Körpern o<strong>de</strong>r auch Geschlechtsverwandlungen zu erproben, die<br />
mit <strong>de</strong>m Auseinan<strong>de</strong>rfallen von gelebten und verkörperten Repräsentationen <strong>de</strong>s<br />
Selbst im Technischen möglich wer<strong>de</strong>n. Zum an<strong>de</strong>ren bieten sich die Ansätze an, auch<br />
die Reflektion über Geschlecht, Technologie und <strong>de</strong>ren performativen Charakter zu<br />
unterstützen. So <strong>de</strong>monstrieren virtuelle Charaktere und an<strong>de</strong>re menschenähnliche<br />
Verkörperungen par excellence die posthumane Performanz von Geschlecht, <strong>de</strong>nen<br />
bisher jedoch eine geschlechts- und sexualitätsnormalisieren<strong>de</strong>r Wirkung nachgesagt<br />
wer<strong>de</strong>n muss (vgl. Kapitel 4.2.5.). Insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Bezug auf Erfahrung und die<br />
Techniken <strong>de</strong>r Verfremdung lassen sich hier in <strong>de</strong>m Sinne <strong>de</strong>uten, die Performativität<br />
von Geschlecht bei <strong>de</strong>r Gestaltung bestimmter Systeme auszunutzen, um nicht nur<br />
geschlechtersubversive Be<strong>de</strong>utungen <strong>de</strong>r Artefakte zu produzieren, son<strong>de</strong>rn zugleich<br />
die Vorannahmen <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen über das, was für sie Geschlecht darstellt,<br />
grundlegend zu <strong>de</strong>-konstruieren. Dies könnte sogar noch nachhaltigere Effekte<br />
hervorbringen als nur eine Konstruktion alternativer Artefakte. Denn sobald DesignerInnen<br />
Geschlechtlichkeit anhand <strong>de</strong>s Beispiels virtueller Charaktere nicht mehr nur als<br />
Zitate bestehen<strong>de</strong>r Geschlechternormen verstün<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn Verschiebungen, Brüche<br />
und Verän<strong>de</strong>rungsmöglichkeiten von Geschlechtlichkeit erlaubten, die im realen Körper<br />
und Leben nicht leicht möglich sind, könnte dieses „Sichtbarwer<strong>de</strong>n“ <strong>de</strong>s performativen<br />
Charakters von Geschlecht und Technologie eine queere Vorstellung von Geschlecht<br />
jenseits <strong>de</strong>r binären Norm beför<strong>de</strong>rn. Eine solche Erkenntnis könnte jedoch<br />
insbeson<strong>de</strong>re mit <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „Reflective Design“ auch zu ganz an<strong>de</strong>ren<br />
Designi<strong>de</strong>en führen, die hier bisher noch nicht bedacht wur<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r auch noch nicht<br />
268
<strong>de</strong>nkbar erscheinen. Sie könnte etwa von <strong>de</strong>r Grundannahme, dass Technologien <strong>de</strong>r<br />
Selbstgestaltung körperlich-grafisch repräsentiert wer<strong>de</strong>n müssen, abrücken o<strong>de</strong>r auch<br />
von <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e, die Maschinen menschenähnlich zu gestalten, komplett Abstand<br />
nehmen. Dies legen die Technologien, die bisher auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>s „Reflective<br />
Design“ konzipiert wur<strong>de</strong>n, nahe (vgl. Sengers 2003), bei <strong>de</strong>nen versucht wird,<br />
jedwe<strong>de</strong> Essentialisierung, Verdinglichung und Festschreibung von Normen zu<br />
vermei<strong>de</strong>n, die eine Nachbildung menschlicher Eigenschaften o<strong>de</strong>r Verkörperungen<br />
mit sich brächten. Insofern lässt die konsequente Anwendung <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
„Reflective Design“ auf Technologien <strong>de</strong>r Selbstgestaltung mit <strong>de</strong>m Ziel ihres De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring einen spannen<strong>de</strong>n Prozess und Ausgang erwarten.<br />
5.5. De-Gen<strong>de</strong>ring von Formalismen, Grundannahmen und Grundlagenforschung:<br />
Ansatzpunkte und Forschungs<strong>de</strong>si<strong>de</strong>rate<br />
Neben <strong>de</strong>n in diesem Kapitel 5 bereits betrachteten Klassen von Technologien –<br />
scheinbar neutrale Anwendungstechnologien für Je<strong>de</strong> und Je<strong>de</strong>n, Technologien für<br />
sich aus <strong>de</strong>r Genusgruppe <strong>de</strong>r Frauen rekrutieren<strong>de</strong>n Zielgruppen und Technologien<br />
<strong>de</strong>r Selbstgestaltung – gibt es eine weitere, umfangreiche Klasse <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte, die bislang noch nicht diskutiert wor<strong>de</strong>n ist. Zu diesen Artefakten, die <strong>de</strong>n<br />
Grundlagen <strong>informatischer</strong> Technologien bzw. <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik<br />
zugeordnet wer<strong>de</strong>n können, gehören Algorithmen, Formalismen und informatische<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung sowie konzeptuelle Annahmen, Klassifikationssysteme<br />
und Dichotomien, für die in Kapitel 4.3. ebenfalls tiefgreifen<strong>de</strong> Prozesse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
nachgewiesen wer<strong>de</strong>n konnten. In diesem Abschnitt wird <strong>de</strong>r Versuch<br />
unternommen, De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien auch für diese Klasse von Artefakten zu<br />
entwickeln.<br />
Eine Schwierigkeit, für diese Form <strong>informatischer</strong> Artefakte methodische Vorschläge<br />
unterbreiten zu wollen, stellen die vergleichsweise abstrakten Ebenen dar, auf <strong>de</strong>nen<br />
die Vergeschlechtlichung dieser Artefakte erfolgt. Die Praktiken und Produkte gehen<br />
aus Formalisierungs- und Klassifikationsprozessen hervor, <strong>de</strong>ren Abstraktionsgrad es<br />
zunächst erfor<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>n Gegenstand als solchen <strong>de</strong>r Analyse und Reflektion möglicher<br />
Vergeschlechtlichung zugänglich zu machen. In Kapitel 4.3. wur<strong>de</strong>n entsprechend die<br />
De-Kontextualisierung, die Setzung fragwürdiger epistemologischer und ontologischer<br />
Grundannahmen sowie <strong>de</strong>r implizite Bezug auf traditionelle Dichotomien als<br />
Mechanismen i<strong>de</strong>ntifiziert, durch welche eine Vergeschlechtlichung zustan<strong>de</strong> kommen<br />
kann. Ein solches Gen<strong>de</strong>ring liegt damit häufig primär auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>s<br />
Symbolischen. Tatsächlich kann dies jedoch – wie anhand verschie<strong>de</strong>ner Beispiele<br />
<strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n ist – strukturell äußerst wirksam wer<strong>de</strong>n.<br />
Diese Problemstellung unterschei<strong>de</strong>t sich nur graduell von <strong>de</strong>n bisher diskutierten<br />
Prozessen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte. Deshalb können viele<br />
<strong>de</strong>r bereits vorgestellten Vorgehensweisen zur Technikgestaltung auch hier zum Einsatz<br />
kommen. Insbeson<strong>de</strong>re das „Participatory Design“ strebt danach, stärker auch auf<br />
abstrakten Ebenen <strong>de</strong>r Formalisierung <strong>kritisch</strong> zu intervenieren, um <strong>de</strong>n Objektivitätsanspruch<br />
formaler Objekte und Spezifikationen, hinter <strong>de</strong>nen sich Technik-<br />
269
gestalterInnen häufig verstecken, zu unterminieren 367 und kann damit zu einem De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring beitragen.<br />
Im Folgen<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Gestaltung <strong>informatischer</strong> Artefakte vorgestellt,<br />
die im Vergleich zu genannten Ansätzen direkt auf die in Kapitel 4.3. i<strong>de</strong>ntifizierten<br />
Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung fokussieren. Das heißt, dass diese Ansätze<br />
darauf ausgerichtet sind, die TechnikgestalterInnen zur Reflektion und Sichtbarmachung<br />
<strong>de</strong>r eigenen, in Abstraktionen und Formalismen verborgenen Vorannahmen<br />
anzuregen, damit an<strong>de</strong>re und aus Sicht <strong>de</strong>r Geschlechterforschung bessere Artefakte<br />
produziert wer<strong>de</strong>n können. Ferner zielen diese Techniken jeweils speziell auf eine Re-<br />
Kontextualisierung von Formalismen, auf eine Revision <strong>de</strong>r epistemologischen und<br />
ontologischen Grundannahmen bzw. auf eine De-Konstruktion von Dichotomien im<br />
Sinne <strong>de</strong>r Wahrnehmung, Anerkennung o<strong>de</strong>r Integration <strong>de</strong>s Ausgegrenzten, ab.<br />
Vorgestellt und diskutiert wer<strong>de</strong>n die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r „Narrative Transformation“ und <strong>de</strong>s<br />
„Mind Scripting“, mit <strong>de</strong>nen implizite Annahmen und Gen<strong>de</strong>rskripte im Technikgestaltungsprozess<br />
aufge<strong>de</strong>ckt und transformiert wer<strong>de</strong>n können, „Value Sensitive<br />
Design“, das auf die explizite Einschreibung humaner Werte in Technologien zielt,<br />
„Critical Technical Practice“, durch die sich marginalisierte Aspekte menschlichen<br />
Han<strong>de</strong>lns in die technische Konzeption und Umsetzung integrieren lassen, sowie eine<br />
intervenieren<strong>de</strong> „Laborstudien“-Forschung, die mit Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r sozial- und kulturwissenschaftlichen<br />
Technikforschung auf Konzepte <strong>de</strong>r informatischen Grundlagenforschung<br />
während ihrer Entstehung feministisch-<strong>kritisch</strong> Einfluss zu nehmen sucht.<br />
5.5.1. „Narrative Transformation“ und „Mind Scripting“: Erinnerungs- und<br />
Reflektionsarbeit mit <strong>de</strong>n DesignerInnen<br />
Im letzten Kapitel 5.4. wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m „Reflective Design“ bereits eine<br />
Technikgestaltungsmetho<strong>de</strong> vorgestellt, die nicht nur darauf zielt, Reflektionsprozesse<br />
bei <strong>de</strong>n NutzerInnen durch eine entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung <strong>de</strong>s Produkts anzustoßen,<br />
son<strong>de</strong>rn auch die EntwicklerInnen dazu anzuregen, sich eigene Selbstverständlichkeiten<br />
bewusst zu machen und zu hinterfragen. Ein solches Sichtbarmachen und<br />
<strong>kritisch</strong>es Reflektieren <strong>de</strong>r Vorannahmen von Seiten <strong>de</strong>r EntwicklerInnen erscheint<br />
vielfach notwendig, etwa um „moralische Ordnungen“ von Informationssystemen o<strong>de</strong>r<br />
in Software eingeschriebene Ontologien aufzu<strong>de</strong>cken, welche dazu tendieren, bestehen<strong>de</strong><br />
Macht- und Geschlechterverhältnisse festzuschreiben und zu verstärken. Im<br />
Kapitel 4.3. wur<strong>de</strong>n solche Politiken <strong>de</strong>s Formalen allgemein am Beispiel Susan Leigh<br />
Stars Zwiebelallergie (Star 1991a, b) und speziell anhand eines medizinischen<br />
Informationssystems (Willis 1997) vorgeführt. Ferner ist die Problematik ontologischer<br />
Klassifizierung von Kommunikationsabsichten mit Hilfe Lucy Suchmans Kritik an <strong>de</strong>m<br />
Kommunikationssystem COORDINATOR <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n (Suchman 1994), bei <strong>de</strong>m<br />
die DesignerInnen nicht nur auf ihre eigenen Vorstellungen zurückgriffen, son<strong>de</strong>rn<br />
auch auf wissenschaftliche Theorien.<br />
Mit <strong>de</strong>m „Reflective Design“ können diese Probleme zwar in <strong>de</strong>n Blick genommen<br />
wer<strong>de</strong>n, allerdings gibt die Metho<strong>de</strong> keinen Hinweis darauf, wie <strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>r<br />
367 Eine Variante besteht etwa darin, konsequent von <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen einzufor<strong>de</strong>rn, dass<br />
sie formale Beschreibungen von Systemen o<strong>de</strong>r Anwendungskontexten in textuelle Beschreibungen<br />
übersetzen.<br />
270
Selbstreflektion bei <strong>de</strong>n TechnikgestalterInnen vonstatten gehen soll, mit welchen<br />
Mitteln er unterstützt und in alternative Artefakte übersetzt wer<strong>de</strong>n kann. Die grundlegen<strong>de</strong><br />
I<strong>de</strong>e, die DesignerInnen selbst zur Reflektion <strong>de</strong>r sozial-kulturellen Einschreibungen<br />
und Wirkungen <strong>de</strong>r von ihnen gestalteten Artefakte einzula<strong>de</strong>n, wird durch die<br />
Ansätze „Narrative Transformation“ (Törpel 2004, 2003a, b, Törpel/ Poschen 2002) und<br />
„Mind Scripting“ (Allhutter/ Hanappi-Egger 2006, Allhutter et al. 2008) zu eigenständigen<br />
methodischen Vorgehensweisen ausgebaut.<br />
Die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r narrativen Transformation hat Bettina Törpel mit <strong>de</strong>m Ziel<br />
entwickelt, Zweck und Funktionalität von IT-Arbeitsmitteln zu klären (Törpel 2004,<br />
2003a, b, Törpel/ Poschen 2002). Sie ist speziell auf Gruppen von DesignerInnen-<br />
NutzerInnen ausgerichtet, die – wie beispielsweise Freelancer und WissenschaftlerInnen<br />
– weitgehend selbst dafür verantwortlich sind, ihre Arbeitssituation zu <strong>de</strong>finieren,<br />
zu organisieren und dazu geeignete Arbeitsmittel einzusetzen. Dabei fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r<br />
Klärungsprozess vorwiegend innerhalb <strong>einer</strong> selbst zusammengefun<strong>de</strong>n Gruppe statt.<br />
Demgegenüber ist das „Mind Scripting“ in beliebigen Technikgestaltungsprozessen, die<br />
in Teamarbeit bewältigt wer<strong>de</strong>n, anwendbar und setzt die Unterstützung durch externe<br />
„Mind Scripting“-ExpertInnen voraus. Bei<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong>n basieren wesentlich auf Frigga<br />
Haugs Ansatz <strong>de</strong>r kollektiven Erinnerungsarbeit.<br />
Das Konzept <strong>de</strong>r „kollektiven Erinnerungsarbeit“ (Haug 1990, Haug 1999) entstand<br />
in <strong>de</strong>n 1970er Jahren im Rahmen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Frauenbewegung. Wesentliches Ziel<br />
<strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> ist es, „I<strong>de</strong>ologien und Alltagstheorien, die das eigene Denken und Han<strong>de</strong>ln<br />
mitbestimmen, <strong>einer</strong> Reflektion zugänglich zu machen. Es han<strong>de</strong>lt sich um ein<br />
Verfahren <strong>de</strong>r Dekonstruktion, das soziale Aneignungsprozesse und Formen <strong>de</strong>s<br />
‚doing gen<strong>de</strong>r‘ freilegt und damit gesellschaftliche Konstruktionen von ‚Weiblichkeit‘<br />
und ‚Männlichkeit‘ und <strong>de</strong>ren Aneignung durch die Subjekte – im Sinne Haraways<br />
verkörperten Wissens – sichtbar macht“ (Allhutter et al. 2008, 155). Methodisch unterstützt<br />
wird dabei sowohl <strong>de</strong>r Reflektionsprozess, <strong>de</strong>r die eigene Sozialisation und die<br />
daraus resultieren<strong>de</strong>n beschränken<strong>de</strong>n Selbstverständnisse bewusst macht, als auch<br />
<strong>de</strong>r Prozess, die eigene Situation zu verbessern. Eine solche Selbstverän<strong>de</strong>rung wird<br />
als Gesellschaftsverän<strong>de</strong>rung verstan<strong>de</strong>n und umgekehrt. Damit wird ein enger<br />
Zusammenhang zwischen Frauen- bzw. Geschlechterforschung und Aktivismus, d.h.<br />
zwischen Wissenschaft und Politik hergestellt.<br />
Kollektive Erinnerungsarbeit ist eine sozialpsychologische Forschungsmetho<strong>de</strong>, die<br />
intendiert, das Wissen um Vergesellschaftungsprozesse zu erweitern und die Handlungsfähigkeit<br />
<strong>de</strong>r Subjekte zu vergrößern. Dabei sind Subjekt und Objekt <strong>de</strong>s<br />
Forschungsprozesses i<strong>de</strong>ntisch, <strong>de</strong>nn die Geschichten <strong>de</strong>r Beteiligten sollen diesen als<br />
empirische Grundlage <strong>de</strong>s eigenen Forschungsprozesses dienen, auf <strong>de</strong>ren Basis sie<br />
herausarbeiten können, wie ihre Sozialisation erfolgt ist und welche Handlungsmuster<br />
sie im Zuge dieser herausgebil<strong>de</strong>t haben. Ein wesentliches Merkmal <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> ist<br />
die kollektive Empirie – ihr Untersuchungsgegenstand die kollektive Erinnerung mit<br />
Hilfe von Narrationen. Dies beinhaltet zugleich eine Analyse <strong>de</strong>s Anteils, <strong>de</strong>n die<br />
Beteiligten selbst an <strong>de</strong>r Reproduktion <strong>de</strong>r herrschen<strong>de</strong>n Kultur und I<strong>de</strong>ologie haben.<br />
Erinnerungsarbeit zielt zugleich darauf Handlungsalternativen aufzuzeigen, um das<br />
erarbeitete Wissen um allgemeine Strukturen und Muster, die sich in <strong>de</strong>n Geschichten<br />
<strong>de</strong>r Einzelnen gefun<strong>de</strong>n haben, für Verän<strong>de</strong>rungen nutzen zu können.<br />
271
Die Metho<strong>de</strong> grün<strong>de</strong>t auf drei Arbeitsschritten: 1. wird gemeinsam eine Forschungsfrage<br />
festgelegt, 2. wer<strong>de</strong>n Szenen zu dieser Frage geschrieben und 3. wer<strong>de</strong>n die<br />
Texte bearbeitet. Dabei soll die Frage aus einem gemeinsamen Interesse entstehen<br />
und allgemeinverständlich formuliert sein. Die Szenen sollen jeweils ein Erlebnis<br />
beschreiben, eine Erfahrung <strong>de</strong>r Einzelnen, an die sich jene möglichst genau erinnern.<br />
Weitere Kriterien für die Szenen sind, dass sie einen klaren Anfang, ein <strong>de</strong>finiertes<br />
En<strong>de</strong> und <strong>de</strong>n Umfang von etwa <strong>einer</strong> Seite haben sollen sowie in <strong>de</strong>r dritten Person<br />
geschrieben sind. Letzteres dient <strong>de</strong>r Historisierung und Verfremdung <strong>de</strong>r<br />
Erzählperson (vgl. Haug 1999, 203).<br />
Die Bearbeitung <strong>de</strong>r Texte in <strong>de</strong>r Gruppe stellt <strong>de</strong>n umfangreichsten Teil <strong>de</strong>r<br />
Metho<strong>de</strong> dar und ist wie<strong>de</strong>rum in vier Arbeitsschritte unterglie<strong>de</strong>rt. Zunächst wird a) ein<br />
Konsens über <strong>de</strong>n Gegenstand <strong>de</strong>s Textes hergestellt und b) die Sprache anhand <strong>de</strong>r<br />
Kategorien Handlungen, Gefühle und Gedanken <strong>de</strong>r AutorIn als auch <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
Personen in ihre Bausteine zerlegt sowie sprachliche Beson<strong>de</strong>rheiten i<strong>de</strong>ntifiziert. Der<br />
nächste Schritt besteht darin, c) das vorgestellte Problem zu formulieren, in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r<br />
Text auf Leerstellen, Wi<strong>de</strong>rsprüche, Floskeln/ Klischees, neue, bisher nicht bedachte<br />
Zusammenhänge, die Selbstkonstruktion <strong>de</strong>r Autorin und die Konstruktionen <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren<br />
hin analysiert wird. Anhand dieser Kernaussagen wird d) ein neues Problem<br />
formuliert, d.h. eine Problemverschiebung herausgearbeitet, <strong>de</strong>nn „aus <strong>de</strong>n Konstruktionen<br />
<strong>de</strong>s Ich und an<strong>de</strong>ren, aus <strong>de</strong>n Spalten über Leerstellen und Wi<strong>de</strong>rsprüche<br />
[ergibt sich] eine neue Botschaft in <strong>einer</strong> These“ (Haug 1999, 220). Anschließend wird<br />
die AutorIn gebeten, durch das Schreiben <strong>einer</strong> zweiten Szene Leerstellen zu füllen<br />
und Unklarheiten auszuräumen. Bei Bedarf kann <strong>de</strong>r Schritt 3 – die Bearbeitung <strong>de</strong>s<br />
Textes – erneut durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Dabei lassen sich die gewonnenen Ergebnisse<br />
nochmals überprüfen, sie können ggf. reformuliert wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r es kann nun auf die<br />
Problemverschiebung verzichtet wer<strong>de</strong>n.<br />
„Narrative Transformation“ wen<strong>de</strong>t diesen Ansatz auf die Untersuchung von<br />
Arbeitssituationen und ihre Unterstützung durch informationstechnische Arbeitsmittel<br />
an. Ziel ist es, anhand transformierter Narrationen die Arbeits- und Lebenssituationen<br />
<strong>de</strong>r Beteiligten zu verbessern: „their joint work is geared toward re-shaping relevant<br />
phenomena in the participants’ working lives to which the episo<strong>de</strong>s refer, such as<br />
technology/functionality, work and organization. Work/life phenomena are changed<br />
(transformed) by working on episo<strong>de</strong>s (narratively)“ (Törpel 2004, 123, Hervorhebung<br />
im Orig.). Dazu wird die Vorgehensweise <strong>de</strong>r Erinnerungsarbeit erweitert, in<strong>de</strong>m bei<br />
<strong>de</strong>r gemeinsamen Bearbeitung <strong>de</strong>r Szenen die Kategorien Nutzung, Entwicklung und<br />
Modifikation von Arbeitsmitteln, Herstellung und Nutzung weiterer Ressourcen, verbesserungswürdige<br />
Aspekte und „good practices“ einbezogen wer<strong>de</strong>n. Törpel betont<br />
jedoch, dass die jeweiligen Analyse-Dimensionen je<strong>de</strong>rzeit ergänzt o<strong>de</strong>r auch wie<strong>de</strong>r<br />
verworfen wer<strong>de</strong>n können. Sie sollen ein eigenständiges gemeinsames Reflektionsthema<br />
<strong>de</strong>r Gruppe darstellen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Verfahren <strong>de</strong>r<br />
Erinnerungsarbeit besteht darin, dass die Pläne zur Verbesserung <strong>einer</strong> beschriebenen<br />
Situation, die gemeinsam in <strong>de</strong>r Gruppe entwickelt wer<strong>de</strong>n, zugleich praktisch erprobt<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. Diese Erfahrungen wer<strong>de</strong>n anschließend in die Gruppe zurückgetragen,<br />
wo sie wie<strong>de</strong>rum gemeinsam evaluiert wer<strong>de</strong>n können. Solche Verbesserungen <strong>de</strong>s<br />
272
(Arbeits-)Alltags können beispielsweise neue Verhandlungsstrategien, die Gründung<br />
neuer Gruppen, aber auch die Gestaltung von Artefakten umfassen. 368<br />
Entwickelt wur<strong>de</strong> die Metho<strong>de</strong> für die Zielgruppe neoliberal-selbstbestimmt Arbeiten<strong>de</strong>r,<br />
die ihre Aufgaben nur dann bewältigen können, wenn sie genau klären, welche IT-<br />
Arbeitsmittel sie dafür benötigen und in welcher Weise sie diese am besten einsetzen.<br />
Diese Bedingung, die eigenen Arbeitsplätze und die dazugehörigen professionellen<br />
Strukturen und Infrastrukturen selbst gestalten zu müssen, fin<strong>de</strong>n sich primär in<br />
fragmentierten Arbeitsumgebungen, wie in virtuellen Unternehmen und Netzwerkorganisationen<br />
o<strong>de</strong>r bei Scheinselbständigen und WissenschaftlerInnen, wo traditionelle<br />
partizipative Verfahren <strong>de</strong>r Technikgestaltung nicht greifen können (vgl. Törpel 2000,<br />
Törpel et al. 2002). Dass gera<strong>de</strong> dort ein solcher Klärungsprozess notwendig ist, führt<br />
die Autorin anhand eines negativen Praxisbeispiels vor (vgl. Törpel 2004, 2003a, b,<br />
Törpel/ Poschen 2002): In <strong>de</strong>m untersuchten Netzwerk freiberuflich Tätiger hatten die<br />
Mächtigen nach langen Überlegungen ein organisationsweites Groupware-System<br />
eingeführt. Diese Entscheidung ignorierte jedoch die bestehen<strong>de</strong>n individuellen Praktiken<br />
<strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r, ihre Arbeitsmittel und Computermittel im Sinne <strong>einer</strong> nutzen<strong>de</strong>n<br />
Herstellung selbst zusammenzustellen. 369 Im Ergebnis ist <strong>de</strong>shalb die hierarchisch<br />
verordnete Lösung nicht angenommen wor<strong>de</strong>n. Nur wenige Netzwerkmitglie<strong>de</strong>r hatten<br />
ihre bisherigen Systeme und Nutzungspraktiken zugunsten <strong>de</strong>r neuen aufgegeben.<br />
„Der teuere und langwierige Prozess <strong>de</strong>r Anschaffung, Modifikation, Einführung und<br />
Schulung zahlte sich nicht aus“ (Törpel 2003a, 473).<br />
Anhand eines positiven Praxisbeispiels wird <strong>de</strong>mgegenüber <strong>de</strong>utlich, wie <strong>de</strong>r<br />
subjektwissenschaftliche Zugang <strong>de</strong>r narrativen Transformation <strong>de</strong>rartige Fehlentscheidungen<br />
vermei<strong>de</strong>n kann. In diesem Fall fand sich eine Gruppe von WissenschaftlerInnen<br />
zu <strong>einer</strong> überregionalen, interdisziplinären Forschungskooperation zusammen<br />
(Törpel 2003a, b, Törpel/ Poschen 2002). Sie startete mit <strong>de</strong>m Anliegen, die<br />
Beson<strong>de</strong>rheiten ihrer Zusammenarbeit auch vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r geografischen<br />
Dispersion zu verstehen und geeignete Unterstützung durch IT zu fin<strong>de</strong>n. Die<br />
Gruppenmitglie<strong>de</strong>r schrieben Szenen zum Thema „Ein Ereignis in meinem<br />
Forschungsalltag“, in <strong>de</strong>nen beispielsweise das Packen für eine Dienstreise von <strong>einer</strong><br />
Person skizziert wird, die verteilt an fünf verschie<strong>de</strong>nen Orten lebt. Eine an<strong>de</strong>re<br />
WissenschaftlerIn, die primär von zu Hause aus arbeitet, beschreibt, wie sie sich<br />
Informationen und Klarheit über anstehen<strong>de</strong> Aufgaben verschafft. Eine weitere Person,<br />
die dringend Rückmeldung auf ihre Arbeitsvorhaben benötigt, thematisiert ihren<br />
Umgang mit ständig ausfallen<strong>de</strong>n Gruppensitzungen. Bei <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>r Szenen<br />
stellte sich zunächst heraus, dass die Gruppenmitglie<strong>de</strong>r prinzipiell gewisse I<strong>de</strong>alvorstellungen<br />
<strong>de</strong>r gemeinsamen Forschungskooperation miteinan<strong>de</strong>r teilen, wie etwa die<br />
Notwendigkeit <strong>de</strong>s Austausches und von Absprachen sowie Verbindlichkeit, die<br />
Relevanz von Rückmeldungen, das Verfügbarmachung von Informationen und eine<br />
Neugier<strong>de</strong> auf die gemeinsame Arbeit, ein Interesse an <strong>de</strong>n Fragen und Ergebnissen<br />
368 „Zu <strong>de</strong>n vielen Möglichkeiten <strong>de</strong>s Eingreifens hier gehört, Computeranwendungen probeweise einzuführen,<br />
‚Mock-Ups‘ o<strong>de</strong>r Prototypen zu erstellen und damit zu experimentieren, Verhandlungsstrategien<br />
mit relevanten Personen zu entwerfen u.v.m. Das praktische Erproben <strong>de</strong>r neu geschaffenen o<strong>de</strong>r<br />
erschlossenen Möglichkeiten und Gegenstän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Gruppe und im (Arbeits-)Alltag selbst ist ein<br />
essentieller Teil <strong>de</strong>s Verfahrens von Narrativer Transformation“ (Törpel 2003a, 488).<br />
369 Törpel spricht in diesem Zusammenhang vom „multiplen parallelen experimentellen Prototyping“ (vgl.<br />
Törpel 2003a, 482f).<br />
273
<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren sowie eine gegenseitige Wertschätzung. Auch ein aufmerksamer Umgang<br />
mit <strong>de</strong>r geografischen Verteiltheit <strong>de</strong>r Beteiligten wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Szenen thematisiert.<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r weiteren Forschungskooperation traten jedoch massive Differenzen<br />
auf, da einzelne Gruppenmitglie<strong>de</strong>r eine eher hierarchische Organisation durchzusetzen<br />
versuchten, relevante Inhalte nicht thematisierten, Informationen nicht verfügbar<br />
machten o<strong>de</strong>r auch Ausschlüsse aufgrund <strong>de</strong>r geografischen Verteiltheit in Kauf<br />
nehmen wollten. Die eigenen I<strong>de</strong>ale wur<strong>de</strong>n somit unterlaufen. Törpel zufolge konnte<br />
jedoch die Arbeit an <strong>de</strong>n Szenen zu <strong>einer</strong> Klärung <strong>de</strong>r Situation beitragen. In <strong>de</strong>r Folge<br />
seien neue Zirkel gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n, wie Gruppen zur Diskussion von Texten, Qualifikationsarbeiten<br />
und Veröffentlichungsvorhaben o<strong>de</strong>r zur Einrichtung eines Kolloquiums<br />
mit internationalen Gästen, <strong>de</strong>nen gegenüber die ursprüngliche Forschungsgruppe<br />
an Be<strong>de</strong>utung verlor.<br />
Das Beispiel zeigt, dass die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r narrativen Transformation dazu beitragen<br />
kann, Annahmen, Interessen und Wi<strong>de</strong>rsprüche in <strong>einer</strong> Gruppe aufzu<strong>de</strong>cken. Deutlich<br />
wird dabei, dass ein solcher Klärungsprozess eine notwendige Voraussetzung sowohl<br />
<strong>de</strong>r bedarfsgerechten Neuorganisation <strong>de</strong>r Gruppe und ihrer Arbeit darstellt als auch<br />
für <strong>de</strong>ren informationstechnische Unterstützung. „Wäre sofort nach ‚<strong>de</strong>r‘ informationstechnischen<br />
Lösung gesucht wor<strong>de</strong>n, so hätte man systematisch im ‚falschen‘ Arbeitssetting<br />
gesucht“ (Törpel 2003a, 494).<br />
Die Metho<strong>de</strong> setzt damit tiefer gehend als die in <strong>de</strong>n Kapiteln 5.2. und 5.3.<br />
vorgestellten Ansätze an <strong>de</strong>n Annahmen und Voraussetzungen an, die in die Technikgestaltung<br />
eingehen, da sie nicht – wie so oft – von <strong>einer</strong> bereits klaren Zielsetzung für<br />
die gesuchte, zu erstellen<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r anzupassen<strong>de</strong> Software ausgeht, son<strong>de</strong>rn die in<br />
diese Setzung eingehen<strong>de</strong>n Selbstverständlichkeiten noch einmal grundlegend<br />
offenlegt und <strong>kritisch</strong> reflektiert. Insofern geht sie über die, für die Entwicklung von<br />
Software an Arbeitsplätzen geeigneten Verfahren <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ und <strong>de</strong>s<br />
„Participatory Design“ hinaus, die auf die Berücksichtigung <strong>de</strong>r vor<strong>de</strong>rgründigen<br />
Erfor<strong>de</strong>rnisse von NutzerInnen zielen bzw. eine klare politische Struktur <strong>de</strong>r Arbeitsverhältnisse<br />
(z.B. UnternehmerIn – ArbeitnehmerIn – Gewerkschaft) voraussetzen, welche<br />
dann als Erklärungsmuster für Interessen und Wi<strong>de</strong>rsprüche dienen (vgl. hierzu Kapitel<br />
5.2. und 5.3.).<br />
Auch für <strong>de</strong>n Zweck <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte erscheint „Narrative<br />
Transformation“ insbeson<strong>de</strong>re für Gruppen hilfreich, <strong>de</strong>ren Arbeit, Organisation und<br />
Kooperation weitgehend selbstbestimmt ist. Die Metho<strong>de</strong> kann dort in Bezug auf die<br />
Kategorie Geschlecht vor allem dann wirksam eingesetzt wer<strong>de</strong>n, wenn die Gruppe<br />
bzw. die Arbeit <strong>de</strong>r Einzelnen von wi<strong>de</strong>rsprüchlichen Interessen, Anliegen und<br />
Vorannahmen durchdrungen ist, die auf <strong>de</strong>r strukturell-symbolischen Geschlechterordnung<br />
beruhen. In Kapitel 4, in <strong>de</strong>m Vergeschlechtlichungsprozesse <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte analysiert wur<strong>de</strong>n, ist zwar kein <strong>de</strong>rartiges Fallbeispiel diskutiert wor<strong>de</strong>n, auf<br />
das diese Bedingungen genau zutreffen. Wären jedoch bei <strong>de</strong>m von Törpel beschriebenen<br />
Beispiel <strong>de</strong>r überregionalen interdisziplinären Forschungskooperation die,<br />
während <strong>de</strong>s Prozesses erkannten Differenzen primär durch geschlechtshierarchische<br />
Strukturen im Wissenschaftsbetrieb erklärbar gewesen, so hätte „Narrative Transformation“<br />
eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Funktion gehabt. Damit wird <strong>de</strong>utlich, dass die Metho<strong>de</strong> im<br />
Bereich <strong>de</strong>r Zusammenarbeit von Gruppen produktiv eingesetzt wer<strong>de</strong>n kann, um <strong>de</strong>r<br />
274
Festschreibung struktureller Geschlechterhierarchie durch Technologien<br />
entgegenzuwirken.<br />
Da die Metho<strong>de</strong> relativ offen ist, unterschiedliche Themen <strong>de</strong>r Gruppenmitglie<strong>de</strong>r im<br />
Prozess zu diskutieren, hat sie das Potential, selbstverständliche Annahmen <strong>de</strong>r Beteiligten<br />
offen zu legen. So könnten mit ihrer Hilfe auch Grundannahmen an<strong>de</strong>ren<br />
Charakters, die die Gruppe teilt und die zu grundlegen<strong>de</strong>n strukturellen Ausschlüssen<br />
führen, herausgearbeitet wer<strong>de</strong>n. Beispielsweise ließe sich auf diese Weise<br />
hinterfragen, ob die standardisierte Produktion von Hamburgern bzw. von Speisen in<br />
Restaurants notwendigerweise Zwiebeln enthalten müsse, wenn das für Einzelne in<br />
<strong>de</strong>r Gruppe ein Problem darstellt, o<strong>de</strong>r ob nur das naturwissenschaftlich-medizinisch<br />
anekannte Wissen in einem Medizininformationssystem wie HIPPOCRATES als<br />
relevant gelten soll (vgl. Kapitel 4.3.1.). Eine Thematisierung solcher Fragen hängt<br />
wesentlich davon ab, ob diejenigen, die die Metho<strong>de</strong> anwen<strong>de</strong>n, sie aufwerfen. Sie<br />
wer<strong>de</strong>n wahrscheinlicher aufgeworfen, wenn es innerhalb <strong>de</strong>r Gruppe Betroffene gibt.<br />
Ein weiterer Aspekt, <strong>de</strong>r „Narrative Transformation“ für die Geschlechterforschung in<br />
<strong>de</strong>r Informatik interessant macht, ist ihr <strong>de</strong>zidiertes Anliegen, die Design-Nutzungs-<br />
Dichotomie zu überbrücken. Denn bei dieser Metho<strong>de</strong> schließen sich die beteiligten<br />
NutzerInnen weiter gehend als in <strong>de</strong>r üblichen Vorgehensweisen <strong>de</strong>s „Participatory<br />
Design“ (vgl. Kapitel 5.3.) selbst in <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Technikentwicklung ein. Törpel<br />
spricht in diesem Zusammenhang von „<strong>de</strong>signer-users“ (Törpel 2004, 122), da die<br />
NutzerInnen mit Hilfe <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> zu TechnikentwicklerInnen ermächtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Damit löst „Narrative Transformation“ die geschlechtlich höchst aufgela<strong>de</strong>ne Dichotomie<br />
von Technikgestaltung und -nutzung bereits im Ansatz auf.<br />
Diese Beson<strong>de</strong>rheit, die diese Metho<strong>de</strong> reizvoll macht, stellt jedoch zugleich eine<br />
Beschränkung dar. Denn sie setzt zum einen voraus, dass sich die Beteiligten selbstorganisiert<br />
in <strong>einer</strong> Gruppe zusammenfin<strong>de</strong>n, um sich ihrer Situation bewusst zu<br />
wer<strong>de</strong>n und sie zu verbessern. Ein solcher Anspruch zur Selbstverän<strong>de</strong>rung wird<br />
jedoch nur selten zu fin<strong>de</strong>n sein. Zum zweiten ist es notwendig, dass die Gruppenmitglie<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>n Freiraum zur Reflektion über scheinbar Selbstverständliches und<br />
Wi<strong>de</strong>rsprüche in <strong>de</strong>r Gruppe haben. Deshalb ist sie etwa in Arbeitskontexten, die<br />
streng hierarchisch organisiert sind, kaum anwendbar. 370 Nichts<strong>de</strong>stotrotz lässt sich in<br />
vielen an<strong>de</strong>ren Situationen prüfen, ob eine weitere Modifikation von Frigga Haugs<br />
Erinnerungsarbeit für <strong>de</strong>n Zweck <strong>de</strong>s Auf<strong>de</strong>ckens von Annahmen in <strong>de</strong>r<br />
Technikgestaltung, das „Mind Scripting“, eingesetzt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
„Mind Scripting“ (Allhutter et al. 2008, Allhutter/ Hanappi-Egger 2006) ist eine<br />
Metho<strong>de</strong> zur Sichtbarmachung von impliziten Geschlechtereinschreibungen in technologischen<br />
Entwicklungsprozessen, die im Rahmen <strong>de</strong>s Forschungsprojekts „Gen<strong>de</strong>red<br />
Software Design“ an <strong>de</strong>r Wirtschaftuniversität Wien von E<strong>de</strong>ltraud Hanappi-Egger,<br />
Doris Allhutter und Sara John von 2005 bis 2007 entwickelt wur<strong>de</strong>. Sie grün<strong>de</strong>t –<br />
ebenso wie die gesamte vorliegen<strong>de</strong> Arbeit – auf <strong>de</strong>r These, dass Technikentwicklung<br />
ein vergeschlechtlichter Prozess ist, in <strong>de</strong>m sozial konstruierte Paradigmen und<br />
Vorstellungen eine zentrale Rolle spielen. Insbeson<strong>de</strong>re bezieht sie sich auf die von<br />
Rommes thematisierten „Gen<strong>de</strong>r Scripts“ und das von Akrich (1995) eingeführte<br />
370 Dort stehen jedoch die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ und <strong>de</strong>s „Participatory Design“ zur<br />
Verfügung, vgl. Kapitel 5.2. und 5.3.<br />
275
Konzept <strong>de</strong>r „I-methodology“, das die „Ten<strong>de</strong>nz von EntwicklerInnen ihre eigenen<br />
Vorstellungen und Fähigkeiten als repräsentativ für <strong>de</strong>n zukünftigen Nutzungskontext<br />
zu sehen und dies nicht zu reflektieren“ (Allhutter et al. 2008, 153f) in <strong>de</strong>n Blick rückt. 371<br />
Die bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung getroffenen Entscheidungen seien darüber hinaus von <strong>de</strong>m<br />
jeweils vorherrschen<strong>de</strong>n Wertesystemen durchdrungen, die die TechnikentwicklerInnen<br />
als soziale AkteurInnen verinnerlicht hätten. Diese zumeist unhinterfragten a-priori-<br />
Annahmen sollen durch die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Mind Scripting“ aufge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n.<br />
„Mind Scripting“ versteht sich als ein Verfahren zur Dekonstruktion von Software-<br />
Entwicklungsprozessen und von Geschlecht in <strong>de</strong>n Diskursen <strong>de</strong>r TechnikentwicklerInnen,<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>ssen versteckte und unsichtbare Dimensionen <strong>de</strong>s Software-<br />
Entwicklungsprozesses herausgearbeitet wer<strong>de</strong>n sollen/können. „Mind Scripting verstan<strong>de</strong>n<br />
als Prozess <strong>de</strong>s Dekonstruierens von Mind Scripts, d.h. von kurzen Texten<br />
über zentrale Situationen im konkreten Entwicklungsprozess o<strong>de</strong>r wichtige damit in<br />
Zusammenhang stehen<strong>de</strong> Situationen, erlaubt es, diese gesellschaftlichen, vergeschlechtlichten<br />
und durch Erfahrungen in technischer Ausbildung und professioneller<br />
Praxis erworbenen Diskurse sichtbar zu machen. Die Metho<strong>de</strong> gibt Einsicht in kollektiv<br />
geteilte Konstruktionsmechanismen und soziale Realitätskonstruktionen wie Gen<strong>de</strong>r<br />
Scripts, die sich SoftwareentwicklerInnen im Laufe ihrer Sozialisation im technischen<br />
Bereich, durch öffentliche Diskurse und durch Alltagserfahrungen angeeignet haben“<br />
(Allhutter et al. 2008, 156).<br />
„Mind Scripting“ passt die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Erinnerungsarbeit zum einen an aktuelle<br />
Geschlechtertheorien an. „Adaptions were mainly ma<strong>de</strong> on a theoretical basis which<br />
was adjusted to current post-structuralist theories that follow an approach of socialization<br />
as ‚subjectivation‘ and besi<strong>de</strong> gen<strong>de</strong>r hierarchical power structures also<br />
emphasize intra gen<strong>de</strong>r differences as well as intersecting segmentation on the<br />
grounds of gen<strong>de</strong>r, race, ethnicity, sexual orientation and class“ (Allhutter/ Hanappi-<br />
Egger 2006, 182). Zum an<strong>de</strong>ren wird die Erinnerungsarbeit für <strong>de</strong>n Einsatz in<br />
Softwareentwicklungsprozessen abgewan<strong>de</strong>lt: Die Szenen/ „Mind Scripts“ beziehen<br />
sich nicht auf Alltagssituation o<strong>de</strong>r wie bei <strong>de</strong>r „Narrative Transformation“ auf Arbeitssituationen<br />
<strong>de</strong>r NutzerInnen, son<strong>de</strong>rn auf zentrale Ereignisse <strong>de</strong>s Technikentwicklungsprozesses<br />
aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r DesignerInnen. Diese Themen sollen erlauben, die<br />
Konstruktionen <strong>de</strong>r EntwicklerInnen in Bezug auf ihre Konzepte <strong>de</strong>r Qualität von<br />
Software genauer zu beleuchten. Während beim ursprünglichen Verfahren das Thema<br />
<strong>de</strong>r Szenen, die die TeilnehmerInnen schreiben, von <strong>de</strong>n Gruppen selbst ausgewählt<br />
wird, haben die „Mind Scripting“-Autorinnen zu diesem Zweck ExpertInneninterviews<br />
mit allen Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s zu untersuchen<strong>de</strong>n Projekts durchgeführt. 372 Auch die<br />
Untersuchung <strong>de</strong>r entstan<strong>de</strong>nen Texte wird nicht ausschließlich von <strong>de</strong>n Beteiligten<br />
durchgeführt. So sind zwar Workshops zur Dekonstruktion <strong>de</strong>r „Mind Scripts“ vorgesehen,<br />
die eigentliche Analyse fin<strong>de</strong>t jedoch außerhalb <strong>de</strong>r Gruppe von <strong>de</strong>n WissenschaftlerInnen<br />
statt, die als Materialien neben <strong>de</strong>n Szenen <strong>de</strong>r EntwicklerInnen auch<br />
Transkriptionen <strong>de</strong>r Interviews und <strong>de</strong>r „Mind Scripting“-Workshops einbeziehen.<br />
Hanappi-Egger, Allhutter und John haben das „Mind Scripting“-Verfahren in zwei<br />
verschie<strong>de</strong>nen Entwicklungskontexten – Computerspiele und Suchmaschinen –<br />
371 Diese Konzepte wur<strong>de</strong>n in Kapitel 3.7. ausführlich beschrieben und diskutiert.<br />
372 Demgegenüber folgte die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Narrativen Transformation“ in dieser Hinsicht <strong>de</strong>m ursprüng-<br />
lichen Verfahren <strong>de</strong>r Erinnerungsarbeit.<br />
276
erprobt. Eine Studie im Computerspielbereich zeigte, dass im untersuchten<br />
Entwicklungsteam zwei unterschiedliche Konzepte für die Bewertung <strong>de</strong>r Qualität eines<br />
Produkts herangezogen wur<strong>de</strong>n. Zum einen seien dies objektivierbare Qualitätsstandards,<br />
die sich aus <strong>de</strong>r professionellen Perspektive ergaben und auf die technische<br />
Umsetzung (wie Funktionalität, Grafikgestaltung und Interaktion) bezogen, zum<br />
an<strong>de</strong>ren ein implizites Wissen über weitere qualitätsrelevante Kriterien, die das „Mind<br />
Scripting“-Verfahren offen legen konnte. Diese impliziten Qualitätsaspekte seien aus<br />
<strong>einer</strong> NutzerInnenperspektive, „wie es sich anfühlt zu spielen, o<strong>de</strong>r was bewirkt, dass<br />
man sich gut dabei fühlt“ (Allhutter et al. 2008, 159), und höchst subjektiv beschrieben<br />
wor<strong>de</strong>n. 373 Allhutter und ihre Kolleginnen (2008) bemerken, dass in <strong>de</strong>n „Mind Scripts“<br />
<strong>de</strong>r EntwicklerInnen häufig zwischen <strong>einer</strong> solchen NutzerInnenperspektive und <strong>einer</strong><br />
technikzentrierten Sicht gewechselt wur<strong>de</strong>, womit Qualitätsvorstellungen <strong>de</strong>r<br />
DesignerInnen als wi<strong>de</strong>rsprüchliche rekonstruiert wür<strong>de</strong>n, die teils als objektive<br />
Standards, teils als subjektive Präferenzen <strong>de</strong>r Einzelnen dargestellt wür<strong>de</strong>n. Dabei<br />
seien die impliziten Qualitätskriterien von <strong>de</strong>n EntwicklerInnen auf ein „künstlerisches<br />
Talent“ zurückgeführt wor<strong>de</strong>n. Mittels dieser Legitimation hätte letztendlich ein<br />
Vorgehen nach <strong>de</strong>r „I-methodology“ praktiziert und Gen<strong>de</strong>r Skripte in die Software<br />
eingeschrieben wer<strong>de</strong>n können. So sei etwa die Entwicklung <strong>de</strong>r Spielcharaktere Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong>n Realitätskonventionen gefolgt, „die UserInnen als<br />
‚männlich‘ und als ‚weiblich‘ konstruierte Figuren als ‚fotorealistisch‘ glaubhaft machen<br />
sollen“ (John/ Allhutter 2007, 30f). Da die eine Frau repräsentieren<strong>de</strong> Spielfigur zu<br />
einem gewissen Grad von <strong>einer</strong> anatomisch korrekten Darstellung abweichen durfte,<br />
während die einen Mann repräsentieren<strong>de</strong> Spielfigur möglichst realitätsnah anhand<br />
<strong>de</strong>s Fotos eines Schauspielers mo<strong>de</strong>lliert wur<strong>de</strong>, haben die Teammitglie<strong>de</strong>r<br />
persönliche geschlechtsstereotype Präferenzen realisiert (vgl. hierzu auch John 2006<br />
bzw. Kapitel 4.2.5.). Auch die Narration <strong>de</strong>s Spiels ließ Rückgriffe auf vorherrschen<strong>de</strong><br />
Geschlechterstereotype, beispielsweise die Annahme körperlicher Schwäche von<br />
Frauen, erkennen. Denn die NutzerIn habe anhand <strong>de</strong>s Arguments, dass die Tasche<br />
mit <strong>de</strong>r Belohnung für eine Frau zu schwer sei, kausallogisch zu schließen, dass die<br />
männliche Nebenfigur und nicht <strong>de</strong>r weibliche Charakter die VerräterIn ist (John/<br />
Allhutter 2007, 31).<br />
Im zweiten beobachteten Fall <strong>de</strong>r Suchmaschinen-Entwicklung konnten ebenfalls<br />
mit Hilfe <strong>de</strong>s „Mind Scripting“ implizite Qualitätskriterien aufge<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n. Hier seien<br />
sich die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Entwicklungsteams zwar prinzipiell ihrer Gestaltungsmacht<br />
bewusst gewesen und hätten soziale Komponenten, z.B. ausdifferenzierte Abfragemöglichkeiten<br />
für die NutzerInnen o<strong>de</strong>r eine bessere Aufbereitung <strong>de</strong>r Suchergebnisse<br />
im Software-Entwicklungsprozess, zu berücksichtigen gesucht. Jedoch zeigte sich in<br />
<strong>de</strong>n empirischen Untersuchungen eine Diskrepanz zwischen <strong>de</strong>n theoretischen<br />
Überlegungen und <strong>de</strong>n tatsächlichen Vorgehensweisen. Es hätte <strong>de</strong>n EntwicklerInnen<br />
an Strategien gefehlt, „um diese abstrakten Konzepte handhabbar zu machen und sie<br />
tatsächlich umsetzbar zu machen. Der hohen Reflektionsfähigkeit <strong>de</strong>r Teammitglie<strong>de</strong>r<br />
auf <strong>einer</strong> abstrakten, theoretischen Ebene stand die mangeln<strong>de</strong> Reflexion <strong>de</strong>r<br />
373 Als Kriterien <strong>de</strong>s impliziten Qualitätsbegriffs, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n EntwicklerInnen zufolge eine Faszination und<br />
Spielsucht erzeugen solle, welche die SpielerInnen emotional in das Spiel verwickelt, extrahierten Allhutter<br />
und ihre Kolleginnen (2008) eine gut inszenierte Geschichte, eine ansprechen<strong>de</strong> Grafik, atmosphärische<br />
Sounds, eine gewisse Spieltiefe und die Möglichkeit <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntifikation mit <strong>de</strong>n Spielfiguren.<br />
277
konkreten Umsetzungspraxis gegenüber“ (Allhutter et al. 2008, 160). Ferner sei<br />
anhand <strong>de</strong>s Sprachgebrauchs in <strong>de</strong>n „Mind Scripts“<strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n, dass die Teammitglie<strong>de</strong>r<br />
ihre Aufgaben sehr unterschiedlich verstan<strong>de</strong>n. Beispielsweise wur<strong>de</strong> das<br />
offizielle Teilprojekt „Reise<strong>de</strong>monstrator“ von einzelnen als „Visualisierung-Demonstrator“<br />
bezeichnet. Ein „Reise<strong>de</strong>monstrator“ ermögliche jedoch eine Suche zum Thema<br />
Reisen, visualisiere die Ergebnisse und stelle diese Funktionalität anhand eines Demo-<br />
Produktes vor, während <strong>de</strong>r zweite Begriff die Visualisierung und damit das Front-End<br />
im Vergleich zu <strong>de</strong>m zuvor gleichgewichteten Back-End in <strong>de</strong>n Vor<strong>de</strong>rgrund stelle. Die<br />
Begriffe stün<strong>de</strong>n somit für zwei unterschiedliche, wenngleich nicht inkompatible<br />
Projektsichten. Das „Mind Scripting“-Verfahren zeigte damit im Fallbeispiel <strong>de</strong>r<br />
Suchmaschinen-Entwicklung, dass <strong>de</strong>r Nutzungskontext nicht genügend spezifiziert<br />
war und es kein klares, gemeinsames Projektziel gegeben hat.<br />
Die bei<strong>de</strong>n Fallbeispiele <strong>de</strong>monstrieren, dass das „Mind Scripting“ implizite<br />
Annahmen über <strong>de</strong>n Nutzungskontext und das Entwicklungsprojekt sowie insbeson<strong>de</strong>re<br />
über Geschlechtsvorstellungen <strong>de</strong>r DesignerInnen herauszuarbeiten und zu<br />
reflektieren vermag. Mit <strong>einer</strong> solchen Offenlegung von Vorannahmen von Seiten <strong>de</strong>r<br />
EntwicklerInnen liefert die Metho<strong>de</strong> eine wesentliche Voraussetzung für die Re-Kontextualisierung<br />
von (geschlechts-)neutral gelten<strong>de</strong>n Produkten. Im Vergleich zur<br />
„Narrative Transformation“ wur<strong>de</strong> das „Mind Scripting“-Verfahren bereits explizit dafür<br />
eingesetzt, implizite Gen<strong>de</strong>rskripten aufzu<strong>de</strong>cken. Allerdings bleibt bei <strong>de</strong>n Fallbeispielen<br />
aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>r Computerspiele und Suchmaschinen unklar, ob die<br />
Bewusstmachung ansonsten verborgen bleiben<strong>de</strong>r Geschlechtsvorstellungen <strong>de</strong>r<br />
DesignerInnen tatsächlich zu einem De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozess geführt hat und alternative<br />
Produkte entwickelt wor<strong>de</strong>n sind. Da die analytischen Erkenntnisse jedoch noch<br />
während <strong>de</strong>s Technikentwicklungsprozesses gewonnen wer<strong>de</strong>n, ist es prinzipiell<br />
möglich, sie in die konkrete Gestaltung <strong>de</strong>s Produktes einzuarbeiten.<br />
Hanappi-Egger (2004) schlägt dazu eine Modifikation i<strong>de</strong>altypischer nutzerInnenzentrierter<br />
Entwicklungsprozesse vor, die sie mit Bezug auf Flood und Romm (1996)<br />
als „Triple-Loop Learning“ bezeichnet (vgl. auch Allhutter/ Hanappi-Egger 2006).<br />
„Triple-Loop Learning“ ergänze die bei<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Informatik etablierten Metho<strong>de</strong>n, die<br />
Funktionalität und die Adäquatheit <strong>de</strong>r Spezifikation zu überprüfen um eine zusätzliche<br />
Feedback-Schleife, in <strong>de</strong>r implizite Annahmen offen gelegt und hinterfragt wer<strong>de</strong>n<br />
sollen. Damit bestehe das Prozessmo<strong>de</strong>ll aus einem drei Schleifen umfassen<strong>de</strong>n, zyklischen<br />
Entwicklungsprozess: „The first loop (the How? Loop) is built around the<br />
question ‚Are we doing things right?‘ The second loop (the What? Loop) is built around<br />
the question ‚Are we doing the right things?‘ The third loop (the Why? Loop) is built<br />
around the question ‚Is rightness buttressed by mightiness and vice versa?‘“ (Allhutter/<br />
Hanappi-Egger 2006, 189). Demzufolge wer<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r ersten Schleife (Wie?) die<br />
Bedürfnisse und Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r NutzerInnen hinsichtlich ihrer Implementierung<br />
innerhalb <strong>de</strong>s Entwicklungsteams diskutiert: Welche Funktionalitäten sollen implementiert,<br />
welche Werkzeuge benutzt, welche Programmiersprache gewählt wer<strong>de</strong>n<br />
und welche Datenbanken sind dazu notwendig? In <strong>de</strong>r zweiten Schleife (Was?) <strong>de</strong>s<br />
Prozesses wird die Funktionalität fortlaufend mit <strong>de</strong>m Anwendungskontext<br />
abgeglichen, in<strong>de</strong>m etwa Teile <strong>de</strong>r Implementierung hinsichtlich ihrer Syntax, aber<br />
auch semantisch getestet wer<strong>de</strong>n. Falls die Ergebnisse <strong>de</strong>r Tests eine Verän<strong>de</strong>rung<br />
nahe legen, wird das Konzept <strong>de</strong>r Implementierung entsprechend angepasst. Mit Hilfe<br />
278
<strong>de</strong>r dritten Schleife (Warum?), die bislang nicht als Teil <strong>de</strong>r Systementwicklung<br />
gesehen wer<strong>de</strong>, soll vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n, dass spezielle Perspektiven <strong>de</strong>r EntwicklerInnen,<br />
die Ausschlüsse herstellen, in die Implementierung hineingeraten. „[T]his means<br />
that besi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>veloping the system, we suggest establishing a meta-level and want to<br />
introduce a tool allowing <strong>de</strong>signers to reflect on their own hid<strong>de</strong>n presumptions and in<br />
particular on their social scripts influencing the way of specifying the system“ (Allhutter/<br />
Hanappi-Egger 2006, 190).<br />
Die mit Hilfe <strong>de</strong>s „Mind Scripting“ gewonnenen Reflektionen über Vorannahmen und<br />
mentale Mo<strong>de</strong>lle <strong>de</strong>r EntwicklerInnen können somit in <strong>de</strong>n Systementwicklungsprozess<br />
integriert wer<strong>de</strong>n, sodass auf dieser Basis „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“ entwickelt<br />
wer<strong>de</strong>n können. Dennoch bleibt unklar, wie die Reflektion über die Vorannahmen<br />
konkret in <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess einfließen kann. Hier gilt es auf <strong>einer</strong><br />
empirischen Ebene Erfahrungswerte zu sammeln. Allhutter und Hanappi-Egger (2006,<br />
193) stellen selbst fest, dass es am effektivsten sei, „Mind Scripting“ am Anfang von<br />
Software-Entwicklungsprojekten einzusetzen, um Verzerrungen und Vergeschlechtlichungen<br />
möglichst früh reflektieren zu können. Jedoch sei dies in kommerziellen<br />
Projekten, die in <strong>de</strong>r Regel unter hohem zeitlichem Druck stehen, häufig zu aufwendig.<br />
Insgesamt können mit Hilfe <strong>de</strong>r „Narrative Transformation“ und <strong>de</strong>s „Mind Scripting“<br />
für <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess relevante Annahmen erkannt und <strong>kritisch</strong><br />
hinterfragt wer<strong>de</strong>n, um auf <strong>de</strong>r Basis dieser Reflektionen alternative Artefakte zu konstruieren.<br />
Eine sorgfältige Anwendung dieser Metho<strong>de</strong>n erfor<strong>de</strong>rt jedoch einen<br />
Freiraum für die Beteiligten, d.h. umfangreiche personelle und zeitliche Ressourcen.<br />
Wenn die Kosten dafür nicht gescheut wer<strong>de</strong>n, erweisen sich bei<strong>de</strong> Verfahren als viel<br />
versprechen<strong>de</strong> De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien, wobei sie unterschiedliche Einsatzgebiete<br />
bedienen. „Narrative Transformation“ eignet sich primär für selbst organisierte Gruppen,<br />
die ihre selbstverständlichen Annahmen klären möchten, um ihre Zusammenarbeit<br />
und ggf. Technikunterstützung zu verbessern. Sie wur<strong>de</strong> bisher noch nicht explizit<br />
aus <strong>einer</strong> geschlechter<strong>kritisch</strong>en Perspektive angewen<strong>de</strong>t. Demgegenüber zielt das<br />
„Mind Scripting“ in erster Linie darauf, soziale Skripten und Gen<strong>de</strong>rskripten im Technikentwicklungsprozess<br />
herauszuarbeiten. Da ferner vorgesehen ist, dass bestimmte<br />
„Mind Scripting“-ExpertInnen mit Gruppen von TechnikgestalterInnen zusammenarbeiten,<br />
weicht das Verfahren stärker von <strong>de</strong>m Selbstermächtigungsanspruch Frigga<br />
Haugs „Erinnerungsarbeit“ ab. Ein weiterer, daraus resultieren<strong>de</strong>r Unterschied<br />
zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n besteht darin, dass „Mind Scripting“ nicht wie<br />
„Narrative Transformation“ danach strebt, die vorherrschen<strong>de</strong> geschlechtskonnotierte<br />
Dichotomie von EntwicklerInnen und NutzerInnen zu unterminieren, son<strong>de</strong>rn sich an<br />
<strong>de</strong>n Rahmen kommerzieller Technikentwicklung und <strong>de</strong>n damit einhergehen<strong>de</strong>n<br />
Unterscheidungen anpasst. Gera<strong>de</strong> aufgrund dieses Aspekts lässt sich das „Mind<br />
Scripting“ jedoch prinzipiell in allen Technikentwicklungsprozessen, die auf Teamarbeit<br />
beruhen, einsetzen.<br />
Für die Fragestellung dieser Arbeit nach einem De-Gen<strong>de</strong>ring möglichst vieler<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte lässt sich jedoch eine weitere, eher konzeptuell bestimmte<br />
Beschränkung feststellen. Die bei<strong>de</strong>n Verfahren erscheinen zwar gut geeignet, um<br />
Vorannahmen zu i<strong>de</strong>ntifizieren, die aus <strong>de</strong>r „I-methodology“ und einem gemeinsam<br />
geteilten sozial-kulturellen Kontext <strong>de</strong>r DesignerInnen resultieren. Jedoch vermögen<br />
sie an<strong>de</strong>re Einschreibungen in informatische Artefakte, die beispielsweise auf<br />
279
wissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen an<strong>de</strong>rer Disziplinen beruhen, nicht<br />
aufzu<strong>de</strong>cken. Grundsätzlich können Grundannahmen, die zu formal sind, auf diese<br />
Weise nicht <strong>kritisch</strong> hinterfragt wer<strong>de</strong>n. Dies gilt insbeson<strong>de</strong>re für auf sozialen bzw.<br />
Gen<strong>de</strong>rskripten, die in Bezug auf die Geschlechterordnung stabilisieren<strong>de</strong> Effekte<br />
haben, welche sich nicht im Anwendungskontext von NutzerInnen zeigen. In diesen<br />
Fällen kann die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Value Sensitive Design“ einen Schritt weiter führen.<br />
5.5.2. „Value Sensitive Design“: Eine Metho<strong>de</strong> zur Re-Kontextualisierung von<br />
formalen Artefakten<br />
Im Kapitel 4.3. wur<strong>de</strong> die Re-Kontextualisierung von Technologien als eine De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Strategie i<strong>de</strong>ntifiziert. Die Rückbindung <strong>informatischer</strong> Artefakte an ihren<br />
Anwendungsbereich stellt insbeson<strong>de</strong>re bei Formalismen eine Voraussetzung dar, um<br />
Geschlechtseinschreibungen erkennen und begegnen zu können, die letztendlich stets<br />
erst über diesen Kontext wirksam wer<strong>de</strong>n. Ginge es dabei ausschließlich darum,<br />
Anwendungssysteme zu re-kontextualisieren, so ließe sich dazu auf eine Reihe <strong>de</strong>r<br />
zuvor beschriebenen Metho<strong>de</strong>n zurückgreifen: angefangen bei Elementen <strong>de</strong>s „User-<br />
Centered“ o<strong>de</strong>r „Participatory Design“, die in Kapitel 5.2. und 5.3. beschriebenen<br />
wur<strong>de</strong>n, bis hin zu <strong>de</strong>n zuletzt vorgestellten Verfahren <strong>de</strong>r „Narrativen Transformation“<br />
und <strong>de</strong>s „Mind Scripting“. 374 Diese Vorgehensweisen haben sich für eine Re-<br />
Kontextualisierung hilfreich erwiesen, wenn sich die Vergeschlechtlichung auf <strong>de</strong>n<br />
Prozess <strong>de</strong>r Abstraktion von <strong>de</strong>n NutzerInnen, vom Anwendungsbereich und vom<br />
Technikgestaltungsverlauf zurückführen lässt. Denn es trägt zum De-Gen<strong>de</strong>ring von<br />
Formalismen bei, in<strong>de</strong>m die dabei eingehen<strong>de</strong>n Annahmen und Skripte explizit<br />
gemacht wer<strong>de</strong>n sollen. Einzelne <strong>de</strong>r Ansätze sind darüber hinaus in <strong>de</strong>r Lage, auch<br />
tiefer gehen<strong>de</strong> kulturelle Annahmen und Konzepte im Technologieentwicklungsprozess<br />
zu hinterfragen.<br />
Im Fall <strong>de</strong>r Algorithmen und Grenzwerte, die bei <strong>de</strong>r Erzeugung von Bil<strong>de</strong>rn aus<br />
computertomographisch ermittelten Daten dafür verantwortlich sind, ob eine scheinbar<br />
essentielle körperliche Geschlechterdifferenz konstruiert wird o<strong>de</strong>r nicht (vgl. Kapitel<br />
4.3.1.), ist es jedoch fraglich, inwiefern die bislang diskutierten Metho<strong>de</strong>n zum Ziel <strong>de</strong>s<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring führen. Hier liegen zwei Probleme vor, die für ein De-Gen<strong>de</strong>ring zu<br />
lösen sind. Erstens sind Erkenntnisse <strong>de</strong>r feministischen Naturwissenschaftskritik über<br />
<strong>de</strong>n Bereich notwendig, in <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Formalismus eingebettet ist. Eine breite und interdisziplinäre<br />
Forschung zu <strong>de</strong>n Vergeschlechtlichungen <strong>de</strong>s Anwendungsfelds, d.h. hier<br />
<strong>de</strong>r Hirnforschung, stellt damit eine wesentliche Voraussetzung für die Re-Kontextualisierung<br />
und die angestrebte Ent-Vergeschlechtlichung formaler Artefakte dar. Zweitens<br />
wird eine Metho<strong>de</strong> benötigt, die die TechnikgestalterInnen direkt in <strong>de</strong>n<br />
Reflektionsprozess über Geschlechterimplikationen <strong>de</strong>r von ihnen produzierten<br />
Artefakte einzubin<strong>de</strong>n vermag.<br />
Hinsichtlich <strong>de</strong>r ersten Voraussetzung, dass feministische Untersuchungen <strong>de</strong>s<br />
formalisierten Bereichs vorliegen müssen, unterschei<strong>de</strong>t sich das Beispiel <strong>de</strong>r<br />
374 Auch aus <strong>de</strong>m Bereich herkömmlicher Softwareentwicklung könnten hier Metho<strong>de</strong>n eingesetzt wer<strong>de</strong>n,<br />
die wie <strong>de</strong>r „Rational Unified Process“ (vgl. Jacobsen et al. 1999) darauf zielen, Designentscheidungen<br />
während <strong>de</strong>s Prozesses zu dokumentieren, um sie dauerhaft sichtbar und damit <strong>de</strong>r Kritik und ggf.<br />
Revision zugänglich zu machen.<br />
280
vergeschlechtlichten computertomografischen Bil<strong>de</strong>r zwar nicht prinzipiell von <strong>de</strong>n<br />
zuvor diskutierten Technologien. So ist etwa für ein De-Gen<strong>de</strong>ring von Softwaresystemen,<br />
die an Arbeitsplätzen eingesetzt wer<strong>de</strong>n, auch ein tiefer gehen<strong>de</strong>s Verständnis<br />
<strong>de</strong>r vorherrschen<strong>de</strong>n geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n Arbeitsteilung zentral. Ein<br />
Unterschied besteht jedoch darin, dass das Wissen um die Zweigeschlechtlichkeit<br />
konstituieren<strong>de</strong> Ausdifferenzierung und symbolische Zuordnung bestimmter Berufe,<br />
Tätigkeiten und Kompetenzen in <strong>de</strong>r Informatik und im Alltagsverständnis eher<br />
bekannnt ist als das von <strong>de</strong>r feministischen Naturwissenschaftskritik produzierte<br />
Wissen. Mehr noch arbeiten populärwissenschaftliche Darstellungen und Feuilletons<br />
darauf hin, ein naturwissenschaftliches Verständnis vermeintlicher Geschlechterdifferenzen<br />
(beispielsweise bei <strong>de</strong>r Funktionsweise von Gehirnen) zu verbreiten. Sie<br />
verankern damit angeblich kognitive Unterschie<strong>de</strong> zwischen Frauen und Männern<br />
körperlich und legitimieren auf diese Weise soziale Ungleichheitsstrukturen mit biologischen<br />
Fakten statt sich mit <strong>de</strong>n feministischen Ansätzen <strong>kritisch</strong> gegen solche rhetorischen<br />
Strategien zu wen<strong>de</strong>n. Es kann <strong>de</strong>shalb nicht davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n,<br />
dass speziell im Anwendungsbereich <strong>de</strong>r Naturwissenschaften das umfangreiche<br />
Wissen über die Geschlechterverhältnisse und Vergeschlechtlichungsprozesse, das<br />
eine Bedingung <strong>de</strong>r Re-Kontextualisierung formaler Artefakte darstellt, Berücksichtigung<br />
fin<strong>de</strong>t. Liegen die erfor<strong>de</strong>rlichen Geschlechteranalysen <strong>de</strong>r Domäne jedoch<br />
bereits vor, so ist das „Value Sensitive Design“ für <strong>de</strong>n Zweck, diese Ergebnisse<br />
methodisch in Technikgestaltungsprozesse zu integrieren, ein viel versprechen<strong>de</strong>r<br />
Ansatz.<br />
„Value Sensitive Design“ ist eine theoretisch fundierte Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Technologiegestaltung, die auf die systematische Berücksichtigung „menschlicher<br />
Werte“ 375 während <strong>de</strong>s Gestaltungsprozesses zielt (Friedman et al. 2006, Friedman/<br />
Kahn 2003, Friedman et al. 2002). Der Ansatz grün<strong>de</strong>t auf <strong>de</strong>r Erkenntnis, dass<br />
Informationstechnologien häufig bestimmte Werte unterstützen o<strong>de</strong>r auch unterminieren,<br />
manchmal sogar gleichzeitig. So wür<strong>de</strong>n etwa Überwachungskameras an<br />
öffentlichen Orten <strong>einer</strong>seits die individuelle und nationale Sicherheit erhöhen, an<strong>de</strong>rerseits<br />
gingen sie oft zulasten <strong>de</strong>s Datenschutzes. Große vernetzte medizinische Datenbanken<br />
könnten die Effizienz <strong>de</strong>s Informationsflusses erhöhen, während sie zugleich<br />
das Vertrauen zwischen ÄrztIn und PatientIn verletzten. Generell solle <strong>de</strong>shalb die<br />
Untersuchung von Werten Gegenstand <strong>de</strong>r Systementwicklung und informatischen<br />
Forschung sein. „Value Sensitive Design“ zielt darauf, allgemeine Werte wie das<br />
Gemeinwohl, menschliche Wür<strong>de</strong>, Gerechtigkeit und Menschenrechte bewusst in<br />
Technologien hineinzuschreiben. Die Metho<strong>de</strong> basiert auf wissenschaftlichen<br />
Diskursen in <strong>de</strong>n USA und spiegelt <strong>de</strong>ren hegemoniale Werte.<br />
„Value Sensitive Design“ baut auf <strong>de</strong>n Erkenntnissen <strong>de</strong>r Computer-Ethik, <strong>de</strong>r<br />
Sozialen Informatik, <strong>de</strong>s „Participatory Design“ und <strong>de</strong>r „Computer-Supported<br />
Collaborative Work“ (CSCW) auf, in <strong>de</strong>nen in Systeme eingeschriebene Werte bereits<br />
untersucht wor<strong>de</strong>n sind (vgl. Friedman/ Kahn 2003, 1183ff). Nach Friedman und Kahn<br />
375 Der Begriff <strong>de</strong>r „menschlichen Werte“ (im Englischen „human values“) zeigt eine Überhöhung <strong>de</strong>s<br />
Menschseins durch diesen Ansatz an, die mit <strong>de</strong>m in Kapitel 3 entwickelten Theorieansatz nicht vereinbar<br />
ist. Ferner sind mit diesem Begriff stets implizite Konstruktionen <strong>de</strong>s Menschseins verbun<strong>de</strong>n, die<br />
Ausgrenzungen zur Folge haben. Aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungsperspektive ist <strong>de</strong>shalb die<br />
Gesellschaftlichkeit „menschlicher Werte“ zu überprüfen, insbeson<strong>de</strong>re weil <strong>de</strong>r Begriff suggeriert, dass<br />
Werte eine feststehen<strong>de</strong> Größe seien. Vgl. hierzu auch die Diskussion am En<strong>de</strong> dieses Abschnitts.<br />
281
könne etwa Computer-Ethik zur Begriffsklärung von Konzepten beitragen, die in <strong>de</strong>r<br />
Informatik nicht konsistent benutzt wür<strong>de</strong>n, sowie potentielle Auswirkungen von<br />
Technologien aus <strong>de</strong>r Perspektive philosophischer Ethik beurteilen. Soziale Informatik<br />
rücke darüber hinaus <strong>de</strong>n sozialen Kontext technischer Artefakte und seine empirische<br />
Untersuchung in <strong>de</strong>n Mittelpunkt. Auswirkungen von Technologien wür<strong>de</strong>n dabei als<br />
sozio-technische verstan<strong>de</strong>n. Jedoch böten bei<strong>de</strong> Ansätze, da sie sich auf die Analyseebene<br />
beschränkten, kaum Hilfen für eine alternative Gestaltung von Informationstechnologien<br />
an. „Computer Supported Cooperative Work“ ziele dagegen direkt auf die<br />
technischen Designprozesse und lege dabei ethische Wertmaßstäbe an. Friedman und<br />
Kahn zufolge wür<strong>de</strong>n jedoch die in diesem Fachgebiet relevanten Werte, wie die <strong>de</strong>r<br />
Kooperation, aber auch <strong>de</strong>s Datenschutz, <strong>de</strong>r Autonomie, Eigentumsrechte, Werte <strong>de</strong>r<br />
Verbindlichkeit, <strong>de</strong>r Sicherheit und <strong>de</strong>s Vertrauens häufig zu eng gefasst. Speziell<br />
aufgrund <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rzeit beobachtbaren Trends <strong>de</strong>s Gebiets, sich nicht mehr nur auf die<br />
Analyse arbeitsbezogener Zusammenhänge <strong>de</strong>s Technikeinsatzes zu beschränken,<br />
hätte das Feld einen grundlegen<strong>de</strong>ren moralischen Standpunkt in Bezug auf humane<br />
Werte zu entwickeln. Auch das „Participatory Design“ ziele auf eine an Werten<br />
orientierte Technikgestaltung, in<strong>de</strong>m es die Demokratisierung <strong>de</strong>s Arbeitsplatzes und<br />
das Wohl aller anstrebe. Allerdings sei diese Metho<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n USA zwar vielfach übernommen<br />
wor<strong>de</strong>n, nicht jedoch die damit verbun<strong>de</strong>nen moralischen Werte. Dies läge<br />
nach Einschätzung von Friedman und Kahn daran, dass Partizipation <strong>de</strong>n Prinzipien<br />
<strong>de</strong>s US-Arbeitsmarktes wi<strong>de</strong>rspräche (wenngleich sie einen Grundpfeiler <strong>de</strong>s<br />
politischen Systems darstellten). Ferner sei <strong>de</strong>r Anspruch <strong>de</strong>r partizipativen Metho<strong>de</strong>n,<br />
sämtlichen durch die Technik Betroffenen eine Stimme im Gestaltungsprozess zu<br />
geben, in <strong>einer</strong> von Diversität geprägten Gesellschaft schlechter praktikabel als in <strong>de</strong>n<br />
vermeintlich homogeneren skandinavischen Gesellschaften.<br />
Mit <strong>de</strong>m „Values Sensitive Design“-Ansatz sollen die genannten Beschränkungen<br />
überwun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n. Dazu legen die AutorInnen eine systematische dreiteilige<br />
Methodik – bestehend aus 1. konzeptuellen, 2. empirischen und 3. technischen Untersuchungen<br />
– vor. Die konzeptuelle Analyse grün<strong>de</strong>t auf moralphilosophischen Ansätzen.<br />
Ihr Gegenstand sind die direkt von <strong>de</strong>r Technologie betroffenen Akteure und<br />
indirekten Interessengruppen, die humanen Werte, <strong>de</strong>ren Umsetzung angestrebt wird,<br />
sowie die möglichen Konflikte zwischen <strong>de</strong>n als wesentlich erachteten Werten. Durch<br />
die empirische Analyse soll mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Metho<strong>de</strong>n aufge<strong>de</strong>ckt<br />
wer<strong>de</strong>n, wie die Akteure und Interessengruppen in Bezug auf die jeweils relevanten<br />
Werte <strong>de</strong>nken und han<strong>de</strong>ln. Technische Analysen ergänzen diese Erkenntnisse, in<strong>de</strong>m<br />
sie herausarbeiten, wie spezifische technische Entscheidungen intendierte Werte und<br />
Praktiken unterstützen o<strong>de</strong>r behin<strong>de</strong>rn. Die drei Untersuchungsebenen sollen integriert<br />
und iterativ durchlaufen wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Values Sensitive Design“ wur<strong>de</strong> von Batya Friedman und seinen<br />
KollegInnenen Lynette Millett, Daniel Howe, Edward Felten erstmals anhand eines<br />
Projektes zum Cookiemanagement für <strong>de</strong>n MOZILLA-Webbrowser entwickelt und<br />
praktisch getestet (vgl. Millett et al. 2001). Ausgangspunkt war dabei eine konzeptuelle<br />
Untersuchung <strong>de</strong>s Begriffs <strong>de</strong>r „informierten Einwilligung“ („informed consent“) sowie<br />
<strong>de</strong>r damit verknüpften Werte <strong>de</strong>s Datenschutzes, <strong>de</strong>r Autonomie und <strong>de</strong>s Vertrauens<br />
im Kontext <strong>de</strong>s Cookiemanagement. Ergebnis war, dass eine Informiertheit <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen voraussetzt, dass diese ein grundlegen<strong>de</strong>s Verständnis davon haben,<br />
282
welche Informationen durch Cookies offen gelegt wer<strong>de</strong>n und welchen Nutzen und<br />
Scha<strong>de</strong>n eine solche Offenlegung haben kann. „Einwilligung“ setze ferner voraus, dass<br />
die Zustimmung freiwillig erfolgt, eine tatsächliche Wahl besteht und die Entscheidung<br />
auch je<strong>de</strong>rzeit revidiert wer<strong>de</strong>n kann. Ferner müssten die Subjekte <strong>de</strong>r Einwilligung<br />
mental, emotional und physisch dazu in <strong>de</strong>r Lage sein, ihr Einverständnis abzugeben.<br />
In einem weiteren Schritt, <strong>de</strong>r auf die technische Ebene fokussiert, untersuchten die<br />
Autoren rückblickend bereits bestehen<strong>de</strong> Systeme auf ihre Umsetzung <strong>de</strong>r<br />
herausgearbeiteten Kriterien: <strong>de</strong>m Verständnis <strong>de</strong>r Funktion von Cookies, Freiwilligkeit,<br />
Wahlfreiheit und Kompetenz. Dabei zeigte sich, dass die Cookie-Technologie innerhalb<br />
von fünf Jahren zwar ständig verbessert wur<strong>de</strong>, einige Probleme jedoch niemals<br />
adressiert wor<strong>de</strong>n sind. Beispielsweise warnt <strong>de</strong>r Browser zwar, wenn ein Cookie<br />
gespeichert wer<strong>de</strong>n soll, nicht aber, wenn von an<strong>de</strong>rer Seite versucht wird, auf diesen<br />
Cookie zuzugreifen. Ebenso wenig informiert <strong>de</strong>r Browser über <strong>de</strong>n Zweck <strong>de</strong>s<br />
intendierten Zugriffs.<br />
Diese Erkenntnisse gaben Anlass zu <strong>einer</strong> Neugestaltung <strong>de</strong>s MOZILLA-Browsers,<br />
für <strong>de</strong>n konkret drei neue technische Mechanismen eingeführt wur<strong>de</strong>n: <strong>de</strong>r Browser<br />
sollte 1. eine periphere „Awareness“ für Cookies herstellen, 2. Echtzeitinformationen<br />
über einzelne Cookies wie die Funktionsweise von Cookies allgemein unterstützen<br />
sowie 3. <strong>de</strong>ren Echtzeitmanagement ermöglichen. Anschließen<strong>de</strong> empirische Tests<br />
zeigten, dass NutzerInnen möglichst wenig Aufmerksamkeit auf die Cookies richten<br />
möchten. Diese Anfor<strong>de</strong>rung führte zu <strong>de</strong>r weiteren Verf<strong>einer</strong>ung <strong>de</strong>r technischen<br />
Mechanismen, insbeson<strong>de</strong>re sollten die NutzerInnen möglichst wenig von ihrer<br />
eigentlichen Aufgabe abgelenkt wer<strong>de</strong>n. Insgesamt wur<strong>de</strong>n auf diese Weise<br />
konzeptuelle, empirische und technische Analysen integriert und wie<strong>de</strong>rholt<br />
durchlaufen.<br />
Ein zweites Beispiel für die Anwendung <strong>de</strong>s „Value Sensitive Design“ ist<br />
URBANSIM, eine Software, mit <strong>de</strong>r integrierte Landnutzung, Transport und Ökologie<br />
von ländlichen wie städtischen Gebieten simuliert wer<strong>de</strong>n sollte, um Langzeitfolgen<br />
bestimmter Entscheidungen mittels verschie<strong>de</strong>ner Szenarien abschätzen zu können<br />
(Friedman et al. 2002, 2006). Primäres Gestaltungsziel dieser Software war es,<br />
StadtplanerInnen, PolitikerInnen und weitere EntscheidungsträgerInnen in ihren<br />
Entscheidungsprozessen durch eine geeignete Technologie zu unterstützen. Ein<br />
zweites Ziel bestand in <strong>de</strong>r Demokratisierung von Planungsprozessen durch<br />
Bürgerbeteiligung.<br />
Bei <strong>de</strong>r konzeptuellen Analyse für dieses Fallbeispiel wur<strong>de</strong>n entsprechend zwei<br />
Arten von Werten unterschie<strong>de</strong>n: generelle Werte und spezifische Werte, die einigen,<br />
aber nicht notwendigerweise allen Akteuren wichtig waren. Zu letzteren zählten etwa<br />
ökologische Nachhaltigkeit, gute Erreichbarkeit/Laufnähe, Raum für Unternehmensexpansionen,<br />
Mobilität von Gütern, geringe staatliche Intervention, geringe<br />
Pen<strong>de</strong>lzeiten, Eigentumsrechte und Landschaftsschutz. Die DesignerInnen wählten auf<br />
dieser Grundlage drei zentrale Werte aus, die durch die Simulationssoftware<br />
umgesetzt wer<strong>de</strong>n sollten: 1. Gerechtigkeit, insbeson<strong>de</strong>re „Freedom from Bias“, d.h.<br />
keine <strong>de</strong>r Interessensgruppen sollte benachteiligt wer<strong>de</strong>n, 2. Rechenschaftspflicht, d.h.<br />
die verschie<strong>de</strong>nen Akteure sollten ihre eigenen Werte in <strong>de</strong>r Simulation verwirklicht<br />
sehen, 3. Demokratie, d.h. es sollte ein <strong>de</strong>mokratischer Prozess <strong>de</strong>r Landnutzung, <strong>de</strong>s<br />
Transports und <strong>de</strong>r Umweltschutzplanung unterstützt wer<strong>de</strong>n. Ein Beispiel für die<br />
283
technische Umsetzung <strong>de</strong>s Gerechtigkeitsanspruchs bestand darin, dass eine<br />
Fortbewegung zu Fuß simuliert wur<strong>de</strong>, obwohl es eine sehr viel ausdifferenzierte<br />
Mo<strong>de</strong>llierung <strong>de</strong>s physischen Raumes erfor<strong>de</strong>rte als etwa das Autofahren. Ferner<br />
wur<strong>de</strong> das System offen gehalten für Verän<strong>de</strong>rungen und neue Bedingungen, in<strong>de</strong>m<br />
agile Softwareentwicklungsmetho<strong>de</strong>n angewandt wur<strong>de</strong>n. Dies sollte ermöglichen,<br />
dass je<strong>de</strong>rzeit neue Anfor<strong>de</strong>rungen von bestimmten Akteuren aufgenommen wer<strong>de</strong>n<br />
können. Als zukünftige Weiterentwicklung kündigten die AutorInnen an, die Benutzungsoberfläche<br />
anzupassen, so dass NutzerInnen die Verwirklichung ihrer Werte<br />
leicht wie<strong>de</strong>r erkennen können. Außer<strong>de</strong>m wer<strong>de</strong> angestrebt, <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>r „informed<br />
<strong>de</strong>mocratic participation“ auszuformulieren und zu implementieren (Friedman et al.<br />
2002, 7).<br />
Die bei<strong>de</strong>n Anwendungsbeispiele zeigen <strong>einer</strong>seits, dass „Value Sensitive Design“<br />
in vielfältigen Bereichen eingesetzt wer<strong>de</strong>n kann. An<strong>de</strong>rerseits verweisen sie auch auf<br />
Unklarheiten, Einseitigkeiten und Beschränkungen <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>. Zum einen wird nicht<br />
beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich, wie die drei Untersuchungsebenen <strong>de</strong>r konzeptuellen, empirischen<br />
und technischen Analyse im Detail ineinan<strong>de</strong>rgreifen und iterativ angewandt wer<strong>de</strong>n<br />
können. Zum zweiten scheinen die angestrebten Werte stark durch hegemoniale<br />
Diskurse <strong>de</strong>r US-amerikanischen Gesellschaft sowie theoretisch durch die in diesen<br />
Diskursen einflussreiche (Moral-)Philosophie geprägt. Drittens ist die Kategorie<br />
Geschlecht bzw. eine Ent-Vergeschlechtlichung von Artefakten kein expliziter<br />
Gegenstand <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>. Diese Einwän<strong>de</strong> bedürfen <strong>einer</strong> genaueren Betrachtung.<br />
Dass die Vorgehensweise <strong>de</strong>s „Values Sensitive Design“ klarer strukturiert wer<strong>de</strong>n<br />
kann, zeigt das Projekt „Values at Play“, in <strong>de</strong>m die Metho<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n Kontext <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung von Computerspielen adaptiert wur<strong>de</strong> (Flanagan et al. 2007, Flanagan et al.<br />
2008). „Values at Play“ umfasst drei Stufen: das Ent<strong>de</strong>cken und I<strong>de</strong>ntifizieren von<br />
Werten in Computerspielen, ihre Übersetzung und Verifikation. „First, <strong>de</strong>signers<br />
discover the values relevant to their project, and <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> which values should be<br />
integrated into the <strong>de</strong>sign. Then, they translate those values into concrete <strong>de</strong>sign<br />
features. Finally, they systematically verify that those values have in<strong>de</strong>ed been<br />
embed<strong>de</strong>d in the game.“ (Flanagan et al. 2007, 2). Damit wird das Verfahren <strong>de</strong>s<br />
„Value Sensitive Design“ auf ein dreischrittiges Vorgehen vereinfacht.<br />
Diese Verbesserung <strong>de</strong>r Vorgehensweise löst jedoch noch nicht die zweite<br />
Problematik <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>, dass „menschlichen Werten“ stets gesellschaftliche<br />
Setzungen vorausgehen und damit Ausschlüsse hergestellt wer<strong>de</strong>n. So erscheint etwa<br />
die Friedman und Kahn (2003) vorgeschlagene Vorauswahl von Werten für die<br />
konzeptuelle Analyse ten<strong>de</strong>nziös. Die Autoren scheinen nicht zu reflektieren, dass<br />
Werte wie menschliches Wohlergehen, Recht auf Eigentum, Datenschutz, „Freedom<br />
from Bias“, universelle Usability, Vertrauen, Autonomie, „Informed Consent“ und<br />
ökologische Nachhaltigkeit höchst voraussetzungsvoll sind und ein westlich-liberales<br />
Werteverständnis zur Norm setzen.<br />
Im Gegensatz dazu sind sich Mary Flanagan und ihre KollegInnen immerhin <strong>de</strong>ssen<br />
bewußt, dass ihre methodische Variation <strong>de</strong>s „Value Sensitive Design“ Werte spezifischer<br />
gesellschaftlicher Kontexte repräsentiert: „If an i<strong>de</strong>al world is one in which<br />
technologies promote not only instrumental values such as functional efficiency, safety,<br />
reliability, and ease of use, but also the substantive social, moral, and political values to<br />
which societies and their peoples subscribe, then those who <strong>de</strong>sign systems have the<br />
284
esponsibility to take these latter values as well as the former into consi<strong>de</strong>ration as they<br />
work. In technologically advanced, liberal <strong>de</strong>mocracies, such values may inclu<strong>de</strong><br />
liberty, justice, enlightenment, privacy, security, friendship, comfort, trust, autonomy<br />
and sustenance“ (Flanagan et al. 2008, 322). Das Zitat zeigt eine gewisse, für<br />
feministische Forschungen typische Selbstreflektion <strong>de</strong>r eigenen Vorannahmen. Ferner<br />
schlägt <strong>de</strong>r „Values at Play“-Ansatz damit im Vergleich zum „Value Sensitive Design“<br />
eine stärker emanzipatorische Richtung ein, in<strong>de</strong>m er die Aufmerksamkeit auf<br />
Diversität, Gerechtigkeit, Inklusion, Gleichheit, Geschlechtergerechtigkeit, Kooperation<br />
o<strong>de</strong>r Großzügigkeit lenkt und damit Anschlüsse an feministische Ansätze <strong>de</strong>r<br />
Technikgestaltung herstellt.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz ist auch die ursprüngliche Version <strong>de</strong>s „Value Sensitive Design“,<br />
die sich nicht auf das Anwendungsfeld <strong>de</strong>s Game Design beschränkt, für das Ziel<br />
dieses Abschnitts, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Formalismen und Kategorien in <strong>de</strong>r<br />
Informatik und Technikgestaltung entgegenzuwirken, interessant. Denn sie führt explizit<br />
<strong>de</strong>n Wert an, Voreingenommenheit, Verzerrung und Vorurteilsbela<strong>de</strong>nheit zu<br />
vermei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sich im Englischen durch <strong>de</strong>n Begriff „Freedom from Bias“ auf <strong>de</strong>n<br />
Punkt bringen lässt (vgl. etwa Friedman/ Kahn 2003, 1189f). Mit Bezug auf Friedman<br />
und Nissenbaum (1996) wird dabei „Bias“ in drei Kategorien unterschie<strong>de</strong>n. Zum einen<br />
gäbe es bereits vor <strong>de</strong>r technologischen Umsetzung bestehen<strong>de</strong> soziale Vorurteile und<br />
Verzerrungen („pre-existing bias“). Ein Beispiel dafür sei die gesellschaftliche<br />
Höherbewertung inhaltlicher Aussagen, die von Stimmen von Männern vorgetragen<br />
wer<strong>de</strong>n im Vergleich zu <strong>de</strong>nen, die von Frauen ausgesprochen wer<strong>de</strong>n. Diese asymmetrische<br />
Einschätzung wer<strong>de</strong> bei technischen Realisierungen automatischer<br />
Sprachsystemen relevant (vgl. Friedman/ Kahn 2003, 1189). Die zweite Kategorie<br />
umfasse Verzerrungen, die erst während <strong>de</strong>r Nutzung entstehen („emergent social<br />
bias“), etwa wenn ein Geldautomat, <strong>de</strong>r auf schriftsprachlichen Interaktionen basiert, in<br />
<strong>einer</strong> Umgebung eingesetzt wer<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r vorwiegend AnalphabetInnen wohnen.<br />
Methodische Vorschläge, diesen bei<strong>de</strong>n Kategorie <strong>de</strong>s „Bias“ in Bezug auf die<br />
Kategorie Geschlecht zu begegnen, in<strong>de</strong>m Differenzierungen berücksichtigt wer<strong>de</strong>n<br />
und auf die tatsächlichen Anfor<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r NutzerInnen eingegangen wird, sind in<br />
<strong>de</strong>n Kapiteln 5.2. und 5.3. diskutiert wor<strong>de</strong>n. Hierfür stellt das „Value Sensitive Design“<br />
einen weiteren Ansatz dar, mit Hilfe <strong>de</strong>ssen ein De-Gen<strong>de</strong>ring von Technologien<br />
geför<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Demgegenüber eröffnet die von Friedman und Nissenbaum i<strong>de</strong>ntifizierte dritte Form<br />
von Verzerrungen, <strong>de</strong>r „technical bias“, einen neuen Bereich, in <strong>de</strong>m die Problematik<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Formalismen anzutreffen ist. Bei diesen technischen<br />
Verzerrungen rühre die Diskriminierung bestimmter Gruppen „from the use of an<br />
algorithm that fails to treat all groups fairly un<strong>de</strong>r all significant conditions“ (Friedman/<br />
Nissenbaum 1996, 334). Die AutorInnen fassen unter dieser Kategorie solche<br />
technische Beschränkungen, die aus Limitationen <strong>de</strong>r Software und Hardware, <strong>de</strong>kontextualisierten<br />
Algorithmen, Mängeln bei <strong>de</strong>r Generierung von Zufallszahlen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Formalisierung menschlicher Konstrukte resultierten. Als Beispiel führen sie eine<br />
Datenbank an, die Organspen<strong>de</strong>n mit potentiellen TransplantationspatientInnen abgestimmt.<br />
Bevorzugt diese systematisch jene Individuen, die auf <strong>de</strong>r ersten Seite angezeigt<br />
sind, gegenüber solchen, die auf späteren Seiten dargestellt wer<strong>de</strong>n, so läge eine<br />
technische Verzerrung vor. Ebenso liefen Suchmaschinen für Flüge, welche die Treffer<br />
285
so sortierten, dass in <strong>de</strong>r Ergebnisliste stets bestimmte Fluggesellschaften zuerst<br />
angezeigt wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>m Gleichbehandlungsanspruch entgegen. Technische Verzerrungen<br />
entstün<strong>de</strong>n darüber hinaus auch dadurch, dass Konzepte menschlichen Han<strong>de</strong>lns<br />
wie Diskurse, Entscheidungen o<strong>de</strong>r Intuition <strong>de</strong>m Computer zugänglich gemacht<br />
wer<strong>de</strong>n sollen, etwa mittels ExpertInnensystemen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren durch die Künstliche<br />
Intelligenz inspirierten Ansätzen. Problematisch seien sämtliche Bestrebungen, das<br />
Qualitative zu quantifizieren, das Kontinuierliche zu diskretisieren o<strong>de</strong>r das Nicht-<br />
Formale zu formalisieren.<br />
Damit beinhaltet die Kategorie <strong>de</strong>s „Technical Bias“ bei Friedman und Nissenbaum<br />
(1996) diejenigen Formen <strong>de</strong>r Einschreibung von „Bias“ in Technologien, die in Kapitel<br />
4.3. als Vergeschlechtlichung von Formalismen und Kategorisierungen kritisiert wur<strong>de</strong>n,<br />
wenngleich mit „Bias“ nicht notwendigerweise auf Geschlecht als Kategorie Bezug<br />
genommen wird. „Value Sensitive Design“ lässt sich auf scheinbar neutrale Algorithmen<br />
und Grenzwerte anwen<strong>de</strong>n, die wie diejenigen, die aus <strong>de</strong>n Rohdaten <strong>de</strong>r Computertomographie<br />
Bil<strong>de</strong>r vom „lebendigen“ Gehirn erzeugen, Unterschie<strong>de</strong> zwischen<br />
zwei Geschlechtern konstruieren o<strong>de</strong>r auch nicht i<strong>de</strong>ntifizierbar machen. Dazu Für ein<br />
solches De-Gen<strong>de</strong>ring müsste jedoch im Rahmen <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> die De-Konstruktion<br />
von Zweigeschlechtlichkeit als ein anzustreben<strong>de</strong>r Wert gesetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Mit <strong>de</strong>m Wert <strong>de</strong>s „Freedom of Bias“ ist „Value Sensitive Design“ zwar für eine von<br />
<strong>de</strong>r Geschlechterforschung motivierte Technikgestaltung offen, jedoch ist die Metho<strong>de</strong><br />
– und damit komme ich auf <strong>de</strong>n dritten Einwand zurück – bisher kaum aus <strong>einer</strong><br />
feministischen Perspektive eingesetzt wor<strong>de</strong>n. Eine Ausnahme stellt das Projekt<br />
RAPUNSEL dar, in <strong>de</strong>m eine Computerspielumgebung entwickelt wur<strong>de</strong>, mit <strong>de</strong>r sozial<br />
benachteiligte Mädchen <strong>de</strong>r Mittelstufe spielerisch das Programmieren mit JAVA lernen<br />
sollen (vgl. Flanagan et al. 2008). 376 In diesem Projekt waren die Werte <strong>de</strong>r<br />
Geschlechtergerechtigkeit und sozialen Gerechtigkeit bereits explizit in <strong>de</strong>r Projekt<strong>de</strong>finition<br />
enthalten und wur<strong>de</strong>n durch die DesignerInnen um <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>r Diversität<br />
ergänzt, <strong>de</strong>n sie als Vielfalt an Lernstilen und kognitiven Fähigkeiten aus<strong>de</strong>uteten.<br />
Dieser Anspruch sollte zum einen durch eine entsprechen<strong>de</strong> Gestaltung <strong>de</strong>s<br />
Belohnungssystems im Spiel sowie zum zweiten durch die Perspektive <strong>de</strong>r<br />
SpielerInnen realisiert wer<strong>de</strong>n. Ausgehend von gängigen Annahmen über die<br />
Zielgruppe (vgl. Kapitel 4.1.2.) starteten die DesignerInnen zunächst mit <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>e,<br />
vorherrschend Mädchen und Frauen zugeschriebene Zuständigkeiten wie Fürsorge,<br />
Pflege, Erziehung im Spiel zu belohnen, aber auch Kooperation und eine gleichberechtigte<br />
Repräsentation technisch zu unterstützen. Mit Hilfe <strong>de</strong>s „Value Sensitive<br />
Design“ gelangten sie schließlich zu <strong>einer</strong> Implementierung, bei <strong>de</strong>r „Co<strong>de</strong> Sharing“<br />
neben <strong>de</strong>m Schreiben von Co<strong>de</strong> eine wesentlichen Grundlage <strong>de</strong>s Belohnungssystems<br />
darstellte: „After consi<strong>de</strong>ring various implementation strategies the <strong>de</strong>sign team<br />
<strong>de</strong>vised a system in which players could compose, accumulate, and transport co<strong>de</strong><br />
segments, through the various stages of the game, in the virtual library of ‚backpacks‘.<br />
The backpack serves a similar function to mechanisms in traditional adventure and<br />
conflict-orientied games which allow players to gather weapons or armor in a type of<br />
‚inventory‘.“ (Flanagan et al. 2008, 340). Die Belohnung <strong>de</strong>s „Co<strong>de</strong> Sharing“ hätte <strong>de</strong>n<br />
Vorteil, weniger stark „weiblich“ kodiert zu sein als etwa die Implementierung von<br />
376 Vgl. dazu http://www.rapunsel.org<br />
286
Fürsorge, Pflege und Erziehung, mit <strong>de</strong>r das System Gefahr gelaufen wäre,<br />
bestehen<strong>de</strong> Geschlechterdifferenzierungen und -hierarchisierungen erneut festzuschreiben.<br />
Gleichzeitig hätten die empirischen Untersuchungen gezeigt, dass <strong>de</strong>r<br />
Zielgruppe 11- bis 14-jähriger Mädchen gera<strong>de</strong> dieser Aspekt sehr gut gefiel. Bei <strong>de</strong>r<br />
Realisierung <strong>de</strong>s Co<strong>de</strong>-Editors ergab sich allerdings ein Konflikt zwischen <strong>de</strong>n Werten<br />
<strong>de</strong>r NutzerInnen, die <strong>de</strong>n Co<strong>de</strong> nicht mühsam tippen wollten, und <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />
DesignerInnen, die im selbsttätigen Schreiben von Programmzeilen die Ziele <strong>de</strong>s<br />
Lernens und Erprobens, <strong>de</strong>r Kreativität und <strong>de</strong>s Empowerment verwirklicht sahen. Die<br />
TechnikgestalterInnen entschie<strong>de</strong>n sich schließlich für <strong>de</strong>n Kompromiss eines kontextsensiblen<br />
hybri<strong>de</strong>n Systems, das sowohl das Tippen als auch eine Menüauswahl<br />
zulässt.<br />
Ebenso sei bei <strong>de</strong>r Wahl <strong>de</strong>r Spielperspektive ein Wertekonflikt zu lösen gewesen.<br />
Denn die GestalterInnen bevorzugten eine subjektive Perspektive, durch die sich die<br />
SpielerInnen mit ihrer Spielfigur i<strong>de</strong>ntifizieren und einen Grad <strong>de</strong>r Immersion erreichen,<br />
bei <strong>de</strong>m sie „sehen“, was die Spielfigur sieht. Die NutzerInnen hingegen zogen einen<br />
„god’s eye view“ vor. Dieser Präferenz hätten die DesignerInnen letztendlich nachgegeben.<br />
Jedoch verhin<strong>de</strong>rten sie, dass die Spielfiguren als reine Sklaven behan<strong>de</strong>lt<br />
wer<strong>de</strong>n konnten, in<strong>de</strong>m sie diesen durch gewisse KI-Mechanismen eine quasi<br />
eigenständige Handlungsfähigkeit verliehen. Diese I<strong>de</strong>e ergab sich wie<strong>de</strong>rum aus <strong>de</strong>r<br />
empirischen Untersuchung, die zeigte, dass die 11- bis 14-jährigen Mädchen<br />
Simulationen von biologischen Prozessen mochten.<br />
Ein weiterer unerwarteter Aspekt, <strong>de</strong>n die empirischen Studien ans Licht brachten,<br />
bestand darin, dass die NutzerInnen das Spiel häufig für sich um<strong>de</strong>finierten, es<br />
beispielsweise gern gegen die intendierten Regeln spielten o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Charakteren ein<br />
morbi<strong>de</strong>s bzw. makabres Verhalten verliehen. Dies interpretierten die DesignerInnen<br />
als Wunsch nach Autonomie, <strong>de</strong>m sie dadurch Rechnung zu tragen versuchten, dass<br />
<strong>de</strong>n SpielerInnen <strong>de</strong>r Zugriff auf einen Großteil <strong>de</strong>s Systems erlaubt wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>n sie<br />
nach eigenen Wünschen umprogrammieren durften. Auf diese Weise wur<strong>de</strong><br />
Subversion als ein für <strong>de</strong>n Kontext relevanter Wert anerkannt und in Form unerwarteter<br />
Szenarien und Interaktionen umgesetzt: „the game supports subversive action without<br />
anyone knowing ahead of time what form the subversion might take, providing the<br />
necessary robustness to withstand a wi<strong>de</strong> range of unexpected outcomes. In other<br />
words, the basic i<strong>de</strong>a is to build a robust (real-world, physical) mo<strong>de</strong>l that runs whether<br />
or not human players are present, making the characters ‚smart‘ enough to <strong>de</strong>al with<br />
unanticipated states by continuing to pursue their goals, without crashing or falling<br />
apart. The team also <strong>de</strong>signed an ‚un<strong>de</strong>rworld‘ and nasty characters called ‚gobblers‘<br />
to address user interest in subversion.“ (Flanagan et al. 2008, 342).<br />
Das RAPUNSEL-Beispiel zeigt sehr schön auf, wie die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s „Value<br />
Sensitive Design“ dafür eingesetzt wer<strong>de</strong>n kann, Geschlechter- und Klassenaspekte<br />
explizit in <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess einzubringen. Dabei wur<strong>de</strong> das System<br />
jedoch so konzipiert, dass es Frauen bzw. Mädchen benachteiligter sozialer Schichten<br />
nicht auf bestimmte Rollen festlegt. Vielmehr spricht das Design offenbar zugleich<br />
Jungen an. Damit ist es hier gelungen, die Kategorien Geschlecht und Klasse bei <strong>de</strong>r<br />
287
Technikgestaltung angemessen zu berücksichtigen ohne Differenzen und Hierarchien<br />
dabei erneut fortzuschreiben. 377<br />
Zuammenfassend birgt „Value Sensitive Design“ für <strong>de</strong>n hier verfolgten Ansatz <strong>de</strong>s<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte somit min<strong>de</strong>stens zwei Vorteile: Zum einen zielt<br />
die Metho<strong>de</strong> darauf, Effekten neutral gelten<strong>de</strong>r Algorithmen und Formalismen<br />
entgegenzuwirken, die bestimmten moralischen Werten zuwi<strong>de</strong>r laufen und mit <strong>de</strong>n<br />
bislang betrachteten Metho<strong>de</strong>n nicht explizit angesprochen wur<strong>de</strong>n. Deutlich wird dies<br />
beispielsweise daran, dass sich „Value Sensitive Design“ mit <strong>de</strong>n herkömmlichen<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Softwaretechnik wie etwa <strong>de</strong>r Objektorientierung o<strong>de</strong>r mit agilen Vorgehensweisen<br />
kombinieren lässt, 378 die nicht notwendigerweise auf eine Untersuchung<br />
von EndnutzerInnen und Anwendungszusammenhang angewiesen sind. Damit erweist<br />
sich die Metho<strong>de</strong> insbeson<strong>de</strong>re in jenen Fällen als vorteilhaft, bei <strong>de</strong>nen die Vergeschlechtlichung<br />
<strong>de</strong>r Artefakte durch Abstraktionen, etwa die Wahl <strong>einer</strong> wissenschaftlichen<br />
Theorie, <strong>einer</strong> Klassifizierung o<strong>de</strong>r eines formale Algorithmus zustan<strong>de</strong> kommt.<br />
So kann das „Value Sensitive Design“ ein De-Gen<strong>de</strong>ring computertomografischer<br />
Bil<strong>de</strong>rzeugungsalgorithmen und Klassifikationen, <strong>de</strong>ren Gen<strong>de</strong>ring in Kapitel 4.3.1.<br />
beschrieben wur<strong>de</strong>, methodisch unterstützen. Dazu müsste allerdings das Ziel, das<br />
Zweigeschlechtlichkeitssystem zu <strong>de</strong>konstruieren anstatt durch <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess<br />
zu bestärken, im Vorhinein als anzustreben<strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Algorithmus zur<br />
Sichtbarmachung computertomografischer Ergebnisse <strong>de</strong>finiert und festgelegt<br />
wer<strong>de</strong>n. 379<br />
Ein zweiter Vorteil <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> besteht darin, dass die Werte <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> explizit<br />
die Herstellung von Gerechtigkeit sowie <strong>de</strong>r „Freedom from Bias“ umfassen, die an<br />
feministische Zielsetzungen anschlussfähig sind. „Value Sensitive Design“ stellt zwar<br />
ursprünglich eine epistemologisch und gesellschaftstheoretisch eher konservative<br />
Metho<strong>de</strong> dar, die – wie bemerkt – auf US-amerikanischen moralphilosophischen Ansätzen<br />
basiert und die hegemonialen Werte US-amerikanischer Fortschritts- und Freiheitsi<strong>de</strong>ologie<br />
wi<strong>de</strong>rspiegelt. Nichts<strong>de</strong>stotrotz arbeiteten einzelne GeschlechterforscherInnen<br />
bereits mit <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> zu <strong>de</strong>m Zweck, Artefakte geschlechter<strong>kritisch</strong> zu<br />
gestalten. Im Vergleich zu <strong>de</strong>n zuvor diskutierten Verfahren, die aus <strong>einer</strong> feministischen<br />
Perspektive eingesetzt wur<strong>de</strong>n, bietet das „Value Sensitive Design“ dabei die<br />
Chance, die Ziele eines De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses auszudifferenzieren. Denn während<br />
an<strong>de</strong>re Metho<strong>de</strong>n, die aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Geschlechterforschung argumentieren,<br />
implizit davon ausgehen, dass solche Ziele von vornherein klar sind, 380 kann beim<br />
„Value Sensitive Design“ diskutiert und dann festgelegt wer<strong>de</strong>n, ob <strong>de</strong>r Wert eines<br />
Technologiegestaltungsprozesses beispielsweise darin bestehen soll, Differenzen<br />
anzuerkennen, Gleichheit anzustreben, o<strong>de</strong>r Geschlecht zu <strong>de</strong>konstruieren und <strong>de</strong>ssen<br />
377 Dabei ist zu bemerken, dass die VertreterInnen <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> das erfor<strong>de</strong>rliche Wissen um<br />
Geschlechterverhältnisse und symbolische Ordnungen in Computerspielen zwar zunächst selbst in <strong>de</strong>n<br />
Prozess eingebracht hatten, später jedoch durch die Anwendung von „Value Sensitive Design“<br />
modifizieren mussten.<br />
378 So sind die bei<strong>de</strong>n ersten skizzierten Anwendungsbeispiele zum Cookiemanagement eines Browsers<br />
und zur Simulation von Landnutzung mittels traditioneller Metho<strong>de</strong>n entwickelt wor<strong>de</strong>n.<br />
379 Ferner müssten – wie eingangs bereits erläutert – Erkenntnisse <strong>de</strong>r feministischen Naturwissenschaftsforschung<br />
vorliegen, die <strong>de</strong>n Zusammenhang bestimmter bil<strong>de</strong>rzeugen<strong>de</strong>r Algorithmen bzw. bestimmter<br />
Klassifikationen und Geschlecht aufzeigen.<br />
380 Etwa das „Mind Scripting“ kombiniert mit <strong>de</strong>m „Triple Loop Learning“, vgl. Allhutter/ Hanappi-Egger<br />
2008.<br />
288
soziale Konstruierheit aufzuzeigen. Dadurch lassen sich die vielfältigen Facetten <strong>de</strong>r<br />
Kategorie Geschlecht, die bei Formalismen, Algorithmen und Grundlagenforschung,<br />
aber auch bei konkreteren Gestaltungselementen eine Rolle spielen, besser berücksichtigen<br />
und mehrere (Teil-)Ziele bzw. Werte gleichzeitig verfolgen. Wie gut sich<br />
„Value Sensitive Design“ mit einem in diesem Sinne höchst ausdifferenzierten<br />
Anspruch <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring verbin<strong>de</strong>n lässt, ist anhand <strong>de</strong>s Fallbeispiels RAPUNSEL<br />
aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Computerspiele veranschaulicht wor<strong>de</strong>n. Es käme nun darauf an,<br />
die Metho<strong>de</strong> nicht nur auf Anwendungssysteme, son<strong>de</strong>rn auch auch auf Formalismen<br />
und Nachbildungen <strong>de</strong>s Menschlichen anzuwen<strong>de</strong>n und auf dieser Ebene <strong>de</strong>n<br />
technischen „Bias“ zu vermei<strong>de</strong>n. Denn erst dann wäre damit das Ziel <strong>de</strong>s De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring von Grundlagen, Formalem und Grundlagenforschung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
erreicht.<br />
5.5.3. „Critical Technical Practice“: Das Marginalisierte ins Zentrum stellen<br />
Im Kapitel 4.3.3. wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r spezifischen Klassifizierung in dichotome Kategorien<br />
eine weitere Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte i<strong>de</strong>ntifiziert, die<br />
über die geschlechtliche Markierung von Dualismen vermittelt wird. So ist etwa Dichotomie<br />
von Nutzung und Gestaltung für die Informatik eine grundlegen<strong>de</strong> Unterscheidung,<br />
wobei insbeson<strong>de</strong>re das Design und die Entwicklung symbolisch und strukturell<br />
eng mit spezifischen „Männlichkeiten“ verknüpft sind. In <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n Arbeit<br />
wur<strong>de</strong>n speziell für diese Konstruktion <strong>de</strong>r „Design-Use“-Differenz bereits verschie<strong>de</strong>ne<br />
Ansätze vorgestellt, die diese Dichotomie aufbrechen und <strong>de</strong>shalb als De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Strategie verstan<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n können (z.B. „Narrative Transformation“ am Anfang<br />
dieses Kapitels 5.5.). 381 Für weitere in westlichen Denktraditionen vergeschlechtlichte<br />
Dichotomien, die wie die Cartesianische Trennung von Körper und Geist o<strong>de</strong>r von<br />
Emotionalität und Rationalität eine fundamentale Grundlage von Ansätzen <strong>de</strong>r Informatik<br />
bzw. KI darstellen, steht die Empfehlung von De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategien bislang<br />
jedoch noch aus. Obgleich einige dieser Dichotomien bereits in <strong>de</strong>r Disziplin selbst<br />
partikulär unterminiert wer<strong>de</strong>n, wie in Kapitel 4.3.3. <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n ist, stellt sich<br />
jedoch aus <strong>de</strong>r Perspektive dieses Kapitels die allgemeine Frage, welche methodischen<br />
Vorschläge gemacht wer<strong>de</strong>n können, um <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung Informatikrelevanter<br />
Dichotomien systematisch entgegen zu wirken. Eine Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Technikgestaltung,<br />
die sich in vielen dieser Fälle produktiv zur Anwendung bringen lässt, ist die<br />
<strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“.<br />
„Critical Technical Practice“ (Agre 1997a) wur<strong>de</strong> von Philip Agre entwickelt, <strong>de</strong>r<br />
selbst in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenzforschung am MIT promovierte und im Zuge <strong>de</strong>ssen<br />
zugleich eine <strong>de</strong>n Ansätzen <strong>de</strong>s eigenen Faches gegenüber <strong>kritisch</strong>e Haltung entwickelt<br />
hat. Die Metho<strong>de</strong> grün<strong>de</strong>t auf <strong>einer</strong> philosophischen, ethnomethodologischen<br />
und gesellschaftstheoretischen Analyse <strong>de</strong>r in einem technischen Feld wie <strong>de</strong>r<br />
Informatik verwen<strong>de</strong>ten Diskurse. Ihr erklärtes Ziel ist es, technische Sackgassen <strong>de</strong>s<br />
betrachteten Felds zu überwin<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m die Kernmetaphern <strong>de</strong>r Fachdiskurse <strong>kritisch</strong><br />
hinterfragt und für ein alternatives Design verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />
381 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 4.3.3., siehe auch Kapitel 3.2.<br />
289
Kurz zusammengefasst besteht das Vorgehen <strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“ aus<br />
vier Schritten: 1. <strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntifizieren <strong>de</strong>r Kernmetaphern eines technischen Felds, 2. <strong>de</strong>r<br />
Analyse <strong>de</strong>r Bereiche menschlichen Han<strong>de</strong>lns, die durch die dominanten Metaphern<br />
marginalisiert wer<strong>de</strong>n, 3. <strong>de</strong>r Invertierung <strong>de</strong>r i<strong>de</strong>ntifizierten Kernmetaphern, wodurch<br />
das Marginalisierte ins Zentrum gestellt wird, und 4. <strong>de</strong>r Umsetzung <strong>de</strong>r Alternativen in<br />
eine neue Technologie.<br />
Agre entwickelte diese Vorgehensweise zusammen mit seinem Kollegen David<br />
Chapman am Beispiel <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n 1980er Jahren vorherrschen<strong>de</strong>n Planungs-Ansätze in<br />
<strong>de</strong>r KI. Dabei bedienten sie sich <strong>de</strong>r Kritik von <strong>de</strong>r Anthropologin Suchman (1987), <strong>de</strong>r<br />
zufolge die Planungs-Ansätze <strong>de</strong>n verkörperten und situierten Charakter menschlichen<br />
Han<strong>de</strong>lns marginalisierten. Die damalige KI sei von <strong>de</strong>r Vorstellung ausgegangen, dass<br />
intelligentes Han<strong>de</strong>ln von rationalen Plänen gesteuert wer<strong>de</strong> – eine Annahme, die auf<br />
<strong>einer</strong> Verwechslung von Metho<strong>de</strong> und Objekt grün<strong>de</strong>, da die nachträgliche Erklärung<br />
von Handlungsweise als vollständige Beschreibung <strong>de</strong>r Handlung betrachtet wird: „The<br />
fact that we can always perform post hoc analysis of situated action that will make it<br />
apprear to have followed a rational plan says more about the nature of our analysis<br />
than it does about our situated action“ (Suchman 1987, 52f).<br />
Agre und Chapman entwickelten ein System namens PENGI, bei <strong>de</strong>m nicht<br />
rationale Pläne, son<strong>de</strong>rn die situierte Verkörperung als zentrale Voraussetzung von<br />
Intelligenz verstan<strong>de</strong>n wird (Chapman/ Agre 1987, Agre/ Chapman 1987, 1990).<br />
PENGI ist ein Computerspiel, in <strong>de</strong>m eine Pinguin-Figur Eiswürfel werfen muss, um<br />
sich gegen bedrohliche Killer-Bienen zu verteidigen. Das Programm funktioniert ohne<br />
die Festlegung expliziter Ziele und ohne die Entwicklung und Ausführung von Plänen,<br />
die zum Erreichen dieser Ziele dienen. Denn Pläne könnten <strong>de</strong>n Autoren zufolge die<br />
Komplexität <strong>de</strong>s realen Lebens, das in konkreten Situationen erfolgt, nicht erfassen:<br />
„Before and beneath any activity of plan-following, life is a continual improvisation, a<br />
matter of <strong>de</strong>ciding what to do now based on how the world is now“ (Agre/ Chapman<br />
1987, 268). Vielmehr grün<strong>de</strong>t PENGI auf <strong>einer</strong> Vielfalt von Routinen und implementierten<br />
Situation-Handlungs-Regeln, die eine kontinuierliche Reaktion auf die jeweilige<br />
Umgebung ermöglichen.<br />
Damit entwickelten Agre und Chapman eine alternative Agententechnologie für das<br />
situierte, reaktive Echtzeit-Verhalten. In<strong>de</strong>m sie die damalige Kernmetapher <strong>de</strong>r<br />
abstrakten Kognition, die <strong>de</strong>n Planungs-Ansätzen zugrun<strong>de</strong> lag, durch ein Mo<strong>de</strong>ll situierten<br />
Han<strong>de</strong>lns ersetzten, eröffneten sie einen neuen Gestaltungsraum für die KI. Ihre<br />
Arbeiten leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung <strong>de</strong>r „Neuen KI“, die sich<br />
seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren zunehmend durchsetzen konnte. Diese Richtung nimmt mit <strong>de</strong>n<br />
Paradigmen <strong>de</strong>r Situierung, Verkörperung und „Enaction“ von <strong>de</strong>r Notwendigkeit <strong>einer</strong><br />
vollständigen Repräsentation Abstand, auf <strong>de</strong>r die traditionelle KI beruhte.<br />
Mit Hilfe <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“ gelang es somit, zuvor<br />
marginalisierten Aspekten menschlichen Han<strong>de</strong>lns Be<strong>de</strong>utung zu verleihen und diese<br />
in technische Diskurse und Praktiken zu übersetzen. Vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>einer</strong> stark<br />
„vermännlichten“ Konnotation von Rationalität und Abstraktion sowie <strong>de</strong>r damit<br />
zusammenhängen<strong>de</strong>n Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r Dichotomien von Körper und Geist<br />
bzw. von Konkretem und Abstraktem, die auf diese Weise unterlaufen wer<strong>de</strong>n, lässt<br />
sich „Critical Technical Practice“ auf <strong>einer</strong> symbolischen Ebene als eine De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
290
Strategie verstehen, die an <strong>de</strong>n Grundannahmen eines Felds, in diesem Fall an <strong>de</strong>n<br />
damaligen Kernmetaphern <strong>de</strong>r KI, ansetzt.<br />
„Critical Technical Practice“ bil<strong>de</strong>t zugleich eine Grundlage, mittels <strong>de</strong>rer auch die<br />
Dichotomie von Rationalität und Emotionalität unterminiert wer<strong>de</strong>n kann. Bereits im<br />
Kapitel 4.3.3 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ansatz von Phoebe Sengers und ihrer „Culturally Embed<strong>de</strong>d<br />
Computing“-Arbeitsgruppe an <strong>de</strong>r Cornell University vorgestellt, die sich <strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r KI<br />
dominanten Verständnis, Emotionen vollständig zu repräsentieren und technisch nachzubil<strong>de</strong>n,<br />
<strong>kritisch</strong> entgegenstellt. Viele ihrer Implementierungen, die im Kontext <strong>de</strong>s<br />
umfangreichen Projekts zur Entwicklung von Alternativen zum „Affective Computing“-<br />
Ansatz (vgl. Picard 1997) stehen, sind als Anwendung <strong>de</strong>s „Critical Technical Practice“-<br />
Ansatzes zu verstehen (vgl. Sengers et al. 2002, Sengers 2003, Sengers et al. 2005).<br />
Das Projekt AFFECTOR (Boehner et al. 2004) etwa bringt Emotionen zum Ausdruck,<br />
ohne dass diese verstan<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r repräsentiert wer<strong>de</strong>n. Diese Installation basiert auf<br />
<strong>einer</strong> Vi<strong>de</strong>overbindung zwischen <strong>de</strong>n Büros zweier FreundInnen. Jedoch wer<strong>de</strong>n die<br />
Bil<strong>de</strong>r systematisch verzerrt, um einen Eindruck von <strong>de</strong>r Hintergrundstimmung zu<br />
vermitteln. Dabei wer<strong>de</strong>n die Verschiebungen zwischen Eingabe und Ausgabe durch<br />
die NutzerInnen bestimmt, die dazu ihre eigenen persönlichen Beziehungen und<br />
Interpretationsstrategien einbringen können. Damit wird bei <strong>de</strong>m Programm AFFEC-<br />
TOR die Kernmetapher <strong>de</strong>r Kodierung und Operationalisierung von Emotionen ersetzt:<br />
„Our new metaphor suggests that emotion cannot be codified and transmitted, rather,<br />
that it is in a state of constant negotiation by which meaning-making is part of our<br />
everyday activities. […] the emotional connotation of the system is not correlated with<br />
an internal, formal emotional mo<strong>de</strong>l, but with its meaning to its users, who are<br />
interpreting the behaviour of the system in a rich, situated network of human<br />
relationship“ (Boehner et al. 2004, 5).<br />
Kirsten Boehner und ihre KollegInnen (2004) <strong>de</strong>monstrieren anhand <strong>einer</strong> Reihe<br />
weiterer Beispiele die Invertierung von Metaphern, welche die grundlegen<strong>de</strong> I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r<br />
„Critical Technical Practice“ darstellt. So wer<strong>de</strong> etwa bei interaktiven Handlesegeräten<br />
für MuseumsbesucherInnen üblicherweise davon ausgegangen, dass das Artefakt<br />
Informationen über die Museumsobjekte liefern solle, womit die sozialen, kreativen und<br />
emotionalen Erfahrungen <strong>de</strong>r BesucherInnen marginalisiert wür<strong>de</strong>n. Eine an<strong>de</strong>re<br />
verbreitete Annahme bestehe darin, dass die technische vermittelte Kommunikation<br />
intensiver wer<strong>de</strong>, je mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Dies wür<strong>de</strong> jedoch die<br />
kurzzeitige, einfache Aufmerksamkeit für das Gegenüber abwerten. Beim reflexiven<br />
Prozess <strong>de</strong>r Entwicklung und Dokumentation wissenschaftlicher I<strong>de</strong>en wer<strong>de</strong> darüber<br />
hinaus häufig vom romantischen I<strong>de</strong>al <strong>de</strong>s „genialen Autors“ ausgegangen, das die<br />
wissenschaftliche Zusammenarbeit und <strong>de</strong>n Netzwerkcharakter dieser Tätigkeit<br />
ignoriere. Auf Basis <strong>de</strong>s „Critical Technical Practice“-Ansatzes stellen die AutorInnen<br />
jeweils marginalisierte Perspektiven in <strong>de</strong>n Mittelpunkt und setzen Implementierungen<br />
um, welche darüber hinausgehend auch generell die in <strong>de</strong>r Informatik vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
Metaphern wie Effizienz und Produktivität negieren. Dies zeigt, dass „Critical Technical<br />
Practice“ von VertreterInnen <strong>de</strong>s Critical Computing aufgegriffen wur<strong>de</strong>, um mittels <strong>de</strong>r<br />
Gestaltung von Technologie gesellschafts<strong>kritisch</strong> zu intervenieren.<br />
Das Potential dieses Ansatzes besteht somit darin, die Annahmen, die in die<br />
Entwicklung von Artefakten eingehen und durch sie transportiert und gefestigt wer<strong>de</strong>n,<br />
zu hinterfragen und alternative Technologien zu entwickeln. Allerdings vermag die<br />
291
Metho<strong>de</strong> auf noch tiefer liegen<strong>de</strong> implizite kulturelle Voraussetzungen zuzugreifen als<br />
die zuvor vorgestellten Techniken. Denn die Ansätze <strong>de</strong>r „Narrative Transformation“<br />
und <strong>de</strong>s „Mind Scipting“ weisen <strong>de</strong>n Fallbeispielen zufolge primär auf Interessenswi<strong>de</strong>rsprüche<br />
hin o<strong>de</strong>r machen Annahmen über <strong>de</strong>n konkreten Nutzungskontext sowie<br />
implizite Geschlechtsvorstellungen <strong>de</strong>r DesignerInnen bewusst. Das „Value Sensitive<br />
Design“ stellt Zusammenhänge zwischen humanen Werten und <strong>de</strong>n Effekten konkreter<br />
Implementierungen und Konzepte her, die durchaus auf unterschiedlichen Ebenen<br />
liegen können, in <strong>de</strong>r Praxis jedoch zumeist <strong>kritisch</strong> auf strukturelle Ausschlüsse<br />
gerichtet sind. Demgegenüber fokussiert „Critical Technical Practice“ direkt auf die<br />
diskursiven Praktiken eines technischen Felds und die darin vorherrschen<strong>de</strong>n<br />
kulturellen Annahmen, die in <strong>de</strong>n verwen<strong>de</strong>ten Metaphern zum Ausdruck kommen. 382<br />
Der Ansatz zielt damit stärker auf symbolische Ebenen und kann auf diese Weise auch<br />
solche Formen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung in <strong>de</strong>n Blick bekommen, die durch an<strong>de</strong>re<br />
Metho<strong>de</strong>n schwerer greifbar sind. Damit erscheint <strong>de</strong>r Ansatz für stark konzeptuell<br />
arbeiten<strong>de</strong> Bereiche wie die KI beson<strong>de</strong>rs viel versprechend.<br />
Ferner kommt „Critical Technical Practice“ mit <strong>de</strong>m Versuch, das jeweils<br />
Marginalisierte zu integrieren, <strong>de</strong>m Anliegen <strong>de</strong>r Geschlechterforschung bereits im<br />
Ansatz äußerst nahe, da die in einem Feld marginalisierten Aspekte häufig gera<strong>de</strong> die<br />
als „weiblich“ konnotierten sind. So betrachtet lässt sich die Metho<strong>de</strong> schon fast per se<br />
als De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie betrachten, wie die Beispiele <strong>de</strong>r Unterminierung <strong>de</strong>r<br />
bei<strong>de</strong>n Dichotomien Körper-Geist und Rationalität-Emotionalität aufgezeigt haben.<br />
Dennoch muss gera<strong>de</strong> hier gefragt wer<strong>de</strong>n, welchen De-Gen<strong>de</strong>ring-Effekt die<br />
Vorgehensweise in ihren Anwendungen tatsächlich hervorzubringen vermag. So lässt<br />
sich etwa – wie nachfolgend argumentiert wird – an jenem Beispiel, anhand <strong>de</strong>ssen<br />
„Critical Technical Practice“ ursprünglich entfaltet wur<strong>de</strong>, gut <strong>de</strong>monstrieren, dass sich<br />
<strong>kritisch</strong>e Metho<strong>de</strong>n durch eine un<strong>kritisch</strong>e Fortschrittshaltung gegenüber technischen<br />
Innovationen vereinnahmen lassen. 383<br />
Agre und Chapman entwickelten ihren Situiertheitsansatz in <strong>kritisch</strong>er Absicht. Es<br />
ging ihnen zunächst darum, neue Betrachtungsweisen und Artefakte zu konzipieren,<br />
welche die vorherrschen<strong>de</strong>n und zugleich beschränkten Sichtweisen <strong>de</strong>s Felds<br />
überwin<strong>de</strong>n könnten, die für dieses Feld in <strong>de</strong>n 1980er Jahren typisch waren. Agres<br />
Veröffentlichungen (vgl. etwa Agre 1997a, b) zeigen jedoch, dass er früh anfing, seinen<br />
Ansatz theoretisch breit zu untermauern, in<strong>de</strong>m er – inspiriert von Suchmans Arbeiten<br />
– Technikgestaltung mit ethnomethodologischen, kulturwissenschaftlichen und gesellschaftstheoretischen<br />
Ansätzen zu verknüpfen suchte. Dieser grundsätzlich <strong>kritisch</strong>e<br />
Zugang stellt ein wesentliches Element <strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“ dar.<br />
382 Metaphern sind auch Gegenstand von Techniken und Metho<strong>de</strong>n, die <strong>de</strong>m „Participatory Design“<br />
zugeordnet wer<strong>de</strong>n können (vgl. etwa Wildman et al. 1993). Dort wer<strong>de</strong>n sie jedoch konstruktiv zur<br />
Interface-Gestaltung eingesetzt, welche die I<strong>de</strong>enentwicklung und <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess partizipativ mit<br />
NutzerInnen unterstützen sollen. Madsen (1994) veranschaulicht dies anhand <strong>de</strong>r drei Metaphern für<br />
Bibliotheken – Warenlager, Kaufhaus und Treffpunkt – die von Bibliotheksangestellten als zukünftigen<br />
NutzerInnen eines Systems verwen<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n und zu <strong>einer</strong> jeweils unterschiedlichen Realisierung <strong>de</strong>r<br />
Computeranwendung führen. Demgegenüber wer<strong>de</strong>n beim „Critical Technical Practice“-Ansatz die<br />
Metaphern <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen i<strong>de</strong>ntifiziert, <strong>de</strong>konstruiert und auf <strong>de</strong>r Basis gesellschafts<strong>kritisch</strong>kulturwissenschaftlicher<br />
Theorien invertiert, um neue Konzepte zur Gestaltung von Technologien zu<br />
entwickeln.<br />
383 In <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Abschnitten nehme ich Bezug auf eine noch nicht veröffentlichte Forschungsarbeit<br />
von Phoebe Sengers zum Verhältnis von Suchmans, Agre und Chapmans sowie Brooks Verständnissen<br />
von Situierung in <strong>de</strong>r KI.<br />
292
Demgegenüber griff die KI-Community, allen voran <strong>de</strong>r dort einflussreiche Rodney<br />
Brooks, die I<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Situierung in einem eher positivistischen Sinne auf. Brooks,<br />
Dissertationsbetreuer von Chapman und Mitglied <strong>de</strong>s Promotionsausschusses von<br />
Agre, interpretierte situierte Handlung im Kontext evolutionsbiologischer Theorien von<br />
Intelligenz. Sie ist für ihn gekennzeichnet durch die Interaktion mit <strong>einer</strong> physischen<br />
Umgebung, in <strong>de</strong>r die Agenten han<strong>de</strong>ln und letztendlich lernen – eine Vorstellung, die<br />
durch die grafischen Darstellung von Software-Agenten in einem Standard-Lehrbuch<br />
<strong>de</strong>r KI veranschaulicht wird (vgl. Abbildung 2).<br />
Abbildung 2: Darstellung eines interaktiven Softwareagenten nach Russell/ Norvig 1995<br />
Abbildung 2: Darstellung eines interaktiven Softwareagenten nach Russel/Norvig 1995<br />
Diese Auffassung <strong>de</strong>s situierten Han<strong>de</strong>lns negiert jedoch das epistemologische und<br />
ontologische Verständnis von Agres und Suchmans Konzeptionen, einschließlich ihres<br />
<strong>kritisch</strong>en Impetus. Denn letztere begreifen Situiertheit als einen höchst sozialen und<br />
kommunikativen Prozess. In<strong>de</strong>m traditionelle KI-ForscherInnen versuchten, situiertes<br />
Han<strong>de</strong>ln zu mo<strong>de</strong>llieren, formalisieren und die Möglichkeiten <strong>de</strong>r Interaktion zwischen<br />
AgentIn und physischer Umgebung in maschineninterpretierbare Regeln zu fassen,<br />
haben sie <strong>de</strong>n eigentlichen Punkt von Suchmans Kritik missverstan<strong>de</strong>n. Denn diese<br />
stellt Interpretation und (soziale) Be<strong>de</strong>utungskonstruktion als Voraussetzungen für die<br />
physische Realität dar, wohingegen Brooks – und mit ihm die dominanten Strömungen<br />
<strong>de</strong>r KI – dieses epistemologisch-ontologische Verhältnis verkehrt, in<strong>de</strong>m er Objektivität<br />
das Primat gegenüber einem interpretativen Verständnis <strong>de</strong>s Physischen als soziale<br />
Konstruktion zuweist. 384<br />
384 Agre (1997b) zufolge zeigt dies, dass es <strong>de</strong>n VertreterInnen <strong>de</strong>r KI äußerst schwer falle, <strong>de</strong>n eigenen<br />
Denkhorizont und Handlungsrahmen zu verlassen. Alternativen wür<strong>de</strong>n zwar durchaus in Betracht<br />
gezogen, dann aber stets innerhalb <strong>de</strong>r Agenda <strong>de</strong>r Formalisierung interpretiert. Erfolg wer<strong>de</strong> stets<br />
anhand von lauffähigen Programmen gemessen: „I have often encountered an empathetic, explicitly stated<br />
injunction against ‚criticizing other people’s work‘, the i<strong>de</strong>a being that the only legitimate form of critical<br />
argument is that ‚my system performs better than your system on problem X‘“ (Agre 1997b, 150). Sollte<br />
Agre darin auch heute noch Recht haben, so wür<strong>de</strong> dies das hier angestrebte Ziel eines De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte grundsätzlich in Frage stellen, da es mit <strong>einer</strong> kompromisslos verstan<strong>de</strong>nen<br />
Agenda <strong>de</strong>r Formalisierung nicht vereinbart wer<strong>de</strong>n kann. Ich wer<strong>de</strong> im folgen<strong>de</strong>n Abschnitt auf die Frage,<br />
ob und in welchem Maße <strong>kritisch</strong>e und feministische Ansätze auf die Technikgestaltung Einfluss nehmen<br />
können, zurückkommen.<br />
293
Um auf die Problematik <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung von Dichotomien zurückzukommen,<br />
stellt sich nun die Frage, wie sich diese Entwicklung in <strong>de</strong>r KI rückblickend <strong>de</strong>uten<br />
lässt. Im Kapitel 4.3.3. wur<strong>de</strong>n auf <strong>einer</strong> theoretischen Ebene drei prinzipielle Strategien<br />
<strong>de</strong>s Umgangs mit Dichotomien vorgeschlagen: die Dekonstruktion, die Anerkennung<br />
eines <strong>de</strong>r Formalisierung unverfügbaren Rests und die Integration <strong>de</strong>s Ausgegrenzten.<br />
„Critical Technical Practice“ lässt sich als eine Kombination <strong>de</strong>r ersten und<br />
letzten Strategie verstehen, <strong>de</strong>nn das Marginalisierte wird zwar in die technische<br />
Implementierung integriert, dabei aber grundlegend gegenüber <strong>de</strong>m dominanten<br />
Verständnis im Feld <strong>de</strong>konstruiert. Demgegenüber wird von Brooks und seinen KollegInnen<br />
allein das zuvor Ignorierte bzw. Ausgegrenzte formalisiert und technisch<br />
umgesetzt, ohne dabei eine Strategie <strong>de</strong>r Dekonstruktion zu verfolgen. Dies hat<br />
hinsichtlich <strong>de</strong>s Ziels <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring von Dichotomien nicht nur die Konsequenz,<br />
das Physische reduktionistisch zu verstehen. Vielmehr wird dadurch die Dichotomie<br />
von Körper und Geist und die damit einhergehen<strong>de</strong> Geschlechterordnung wie<strong>de</strong>rhergestellt<br />
statt unterlaufen. Der <strong>kritisch</strong> intendierte Ansatz situierten Han<strong>de</strong>lns wur<strong>de</strong> auf<br />
diese Weise affirmativ für die technische Innovation vereinnahmt. Agres Ansatz <strong>de</strong>s<br />
„Critical Technical Practice“ konnte die Künstliche Intelligenz-Forschung s<strong>einer</strong> Zeit<br />
zwar nicht grundsätzlich revolutionieren. Doch wur<strong>de</strong> seine Metho<strong>de</strong> später wie<strong>de</strong>r<br />
aufgegriffen. Die Interventionen von Phoebe Sengers und ihren Kolleginnen im Bereich<br />
<strong>de</strong>s „Affective Computing“ belegen, dass seine bzw. Suchmans wissenschaftspolitische<br />
und epistemologische Positionen erfolgreich umgesetzt wer<strong>de</strong>n können.<br />
Dies wirft die prinzipielle Frage auf, welchen Effekt solche <strong>kritisch</strong>en Projekte – etwa<br />
die erneute Präsenz <strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“ – auf die gesamte Künstliche<br />
Intelligenz-Forschung haben können. Welche Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring von Konzepten<br />
und Grundlagen können eine breite Wirkung auf die Forschungspraktiken und<br />
wissenschaftstheoretischen Setzungen eines etablierten „epistem-ontologischen“ (vgl.<br />
Kapitel 3.5.) Zusammenhangs <strong>de</strong>r Informatik und Künstlichen Intelligenz-Forschung<br />
entfalten? Was kann das Ausmaß <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung sein? Es wäre sicherlich naiv<br />
anzunehmen, dass eine einzelne <strong>kritisch</strong>e I<strong>de</strong>e o<strong>de</strong>r ein einzelner konkreter methodischer<br />
Ansatz wie die „Critical Technical Practice“ die theoretischen Vorannahmen und<br />
Praktiken eines gesamten technischen Felds verän<strong>de</strong>rn könnten. Nichts<strong>de</strong>stotrotz ist<br />
zu fragen, welche Formen <strong>de</strong>r interdisziplinären Kooperation und <strong>kritisch</strong>feministischen<br />
Intervention das Potential hätten, die Grundlagen und Grundlagenforschungen<br />
<strong>einer</strong> technischen Community allmählich, aber grundlegend zu<br />
verschieben.<br />
5.5.4. Sozial- und kulturwissenschaftliche „Laborstudien“: Kritischfeministische<br />
Intervention in <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik?<br />
Die Metho<strong>de</strong>n, die bis hierher vorgestellt und diskutiert wur<strong>de</strong>n, sind aus <strong>de</strong>r Informatik<br />
heraus entwickelt wor<strong>de</strong>n und integrieren <strong>kritisch</strong>e sozial- und kulturwissenschaftliche<br />
Ansätze mit <strong>de</strong>r Technikgestaltung. Es wur<strong>de</strong>n jeweils geeignete Theorien und Praktiken<br />
aus <strong>de</strong>n Sozial- und Kulturwissenschaften ausgewählt, um sie methodisch angepasst<br />
in die technischen Designprozesse einzuflechten. Die Ansätze <strong>de</strong>s „User-Centered<br />
Design“ bzw. <strong>de</strong>r „Usability“, die in Kapitel 5.2. diskutiert wur<strong>de</strong>n, übernehmen<br />
etwa psychologische bzw. sozialwissenschaftliche Metho<strong>de</strong>n und modifizieren sie für<br />
294
<strong>de</strong>n Zweck, technische Systeme zu evaluieren. Dort wie im „Participatory Design“ (vgl.<br />
Kapitel 5.3.) haben sich darüber hinaus ethnographische Metho<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Kulturforschung<br />
als produktiv erwiesen, um Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten <strong>de</strong>r<br />
NutzerInnen sowie Anwendungskontexte <strong>de</strong>tailliert erfassen zu können. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
beim „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“, „Design for Experience“ und „Reflective Design“, die<br />
in Kapitel 5.4. vorgestellt wur<strong>de</strong>n, fin<strong>de</strong>n sich mit Pädagogik, Phänomenologie und<br />
Gesellschaftstheorie noch breitere theoretische Anleihen bei <strong>de</strong>n Geistes- und<br />
Kulturwissenschaften.<br />
Auch in diesem Kapitel 5.5. wur<strong>de</strong>n sozial- und kulturwissenschaftliche Ansätze<br />
herangezogen, um grundlegen<strong>de</strong> ontologische und epistemologische Annahmen in<br />
formalen Artefakten und <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik auf<strong>de</strong>cken und diese<br />
Erkenntnisse ggf. produktiv für ein De-Gen<strong>de</strong>ring anwen<strong>de</strong>n zu können. Dazu gehören<br />
die Erinnerungsarbeit („Narrative Transformation“, „Mind Scripting“), Moralphilosophie<br />
(„Value Sensitive Design“) und ethnomethodologisch-philosophische Analysen von<br />
Metaphern („Critical Technical Practice“). Dabei hat jedoch insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Ansatz<br />
<strong>de</strong>r „Critical Technical Practice“, <strong>de</strong>ssen explizite Intention es ist, auf grundlegen<strong>de</strong><br />
Konzepte, Denkweisen und epistemologische Annahmen eines technologischen<br />
Forschungsbereiches Einfluss zu nehmen, auf Grenzen <strong>de</strong>s Versuches, <strong>kritisch</strong>e<br />
Ansätze in die Technikgestaltung zu integrieren, aufmerksam gemacht. Diese Grenzen<br />
<strong>de</strong>r Möglichkeit <strong>kritisch</strong>er Intervention könnten <strong>einer</strong>seits prinzipieller Natur sein.<br />
Schließlich geht es bei <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>m De-Gen<strong>de</strong>ring auf <strong>de</strong>r Ebene von „Epistem-ontologien“<br />
häufig nicht nur darum, die in einem gewissen Rahmen aushan<strong>de</strong>lbaren<br />
Annahmen <strong>de</strong>r DesignerInnen in Frage zu stellen, son<strong>de</strong>rn gewissermaßen<br />
um die Problematisierung <strong>de</strong>r Grundfeste eines technischen Felds. So <strong>de</strong>utet etwa<br />
Agre seinen mangeln<strong>de</strong>n Erfolg, das vorherrschen<strong>de</strong> Konzept kognitiver Pläne durch<br />
das Konzept situierten Han<strong>de</strong>lns im Sinne Suchmans zu ersetzen, mit <strong>de</strong>m<br />
beharrlichen Festhalten <strong>de</strong>r KI-Forschung an <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n Agenda <strong>de</strong>r<br />
Formalisierung (vgl. Agre 1997b).<br />
An<strong>de</strong>rerseits ließe sich das Phänomen, dass gera<strong>de</strong> für <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r formalen<br />
Grundlagen, Metho<strong>de</strong>n und Grundlagenforschungen in <strong>de</strong>r Informatik bislang nur<br />
vereinzelte <strong>kritisch</strong>e Reflektions- und Gestaltungsansätze vorliegen, jedoch auch auf<br />
die Komplexität <strong>de</strong>r Problemstellung zurückführen. Denn eine Intervention in diesem<br />
Bereich erfor<strong>de</strong>rt – sowohl für die Analyse als auch für die Entwicklung alternativer<br />
technologischer Konzepte – nicht nur eine Integration sozial- und kulturwissenschaftlicher<br />
Ansätze in die technische Konzeption und Konstruktion, son<strong>de</strong>rn eher eine<br />
intensive interdisziplinäre Übersetzungsarbeit zwischen <strong>de</strong>r Informatik/KI und <strong>de</strong>n<br />
Sozial-/Kulturwissenschaften. Deshalb soll nun zum Abschluss <strong>de</strong>r Diskussion<br />
möglicher De-Gen<strong>de</strong>ring-Ansätze die Perspektive gewechselt und vom Ausgangspunkt<br />
<strong>de</strong>r Sozial- und Kulturwissenschaften nach Metho<strong>de</strong>n und Vorgehensweisen für eine<br />
<strong>kritisch</strong>-feministische Technikgestaltung gefragt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Frage nach einem produktiven Beitrag <strong>de</strong>r Sozial- und Kulturwissenschaften<br />
führt zurück auf das Gebiet <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung, <strong>de</strong>ssen<br />
Debatten um das Verhältnis von Technologien und Gesellschaft/Kultur ausführlich im<br />
Kapitel 3 dieser Arbeit diskutiert wor<strong>de</strong>n sind. Es bietet <strong>de</strong>r Informatik jedoch nicht nur<br />
theoretische Konzepte an, wie sich die Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
theoretisch fassen lässt, son<strong>de</strong>rn verfügt mit so genannten „Laborstudien“ über ein<br />
295
methodisches Repertoire, WissenschaftlerInnen bei ihrer Arbeit begleitend zu<br />
beobachten und dabei zugleich <strong>kritisch</strong> zu intervenieren – eine Expertise, die an dieser<br />
Stelle hilfreich erscheint.<br />
Die ersten „Laborstudien“ wur<strong>de</strong>n En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1970er und Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre<br />
von Bruno Latour und Steve Woolgar (1979), Karin Knorr-Cetina (1985 [1981]),<br />
Michael Lynch (1985) und Sharon Traweek (1988) durchgeführt und können als<br />
Ausgangspunkt <strong>de</strong>r neueren Wissenschaftsforschung betrachtet wer<strong>de</strong>n. Sie wen<strong>de</strong>ten<br />
sich gegen die Vorstellung, dass naturwissenschaftliches Wissen überall und immer<br />
gültig, d.h. ahistorisch, apolitisch und unabhängig von sozialen Faktoren ist. „Laborstudien“<br />
sollten Aufschluss darüber geben, dass und wie naturwissenschaftliche Tatsachen<br />
sozial konstruiert sind. Ziel <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong> war es, „the process of knowledge<br />
production as ‚constructive’ rather than <strong>de</strong>scriptive“ (Knorr-Cetina 1995, 141)<br />
aufzu<strong>de</strong>cken „through direct observation and discourse analysis at the root of where<br />
knowledge is produced“ (ebd., 140). Dazu folgten die WissenschaftsforscherInnen<br />
NaturwissenschaftlerInnen an <strong>de</strong>n Ort <strong>de</strong>r „Fabrikation <strong>de</strong>r Erkenntnis“ (Knorr-Cetina<br />
1985 [1981]), d.h. in die Labore, um sie dort monatelang <strong>de</strong>tailliert zu beobachten. Auf<br />
dieser Basis konnten sie Konstruktionsaspekte und Herstellungsverläufe naturwissenschaftlichen<br />
Wissens sichtbar machen.<br />
Methodisch basieren die „Laborstudien“ auf Ansätzen <strong>de</strong>r Anthropologie und Ethnografie.<br />
Konkrete Vorgehensweisen bestehen darin, „<strong>de</strong>n NaturwissenschaftlerInnen am<br />
Labortisch auf die Finger zu sehen, ihre Eintragungen in die Arbeitsbücher nachzuvollziehen,<br />
ihnen beim Informationsaustausch bzw. bei <strong>de</strong>n ‚Fachsimpeleien‘ mit ihren KollegInnen<br />
zuzuhören, die Entstehungs- und Umschreibeprozesse von wissenschaftlichen<br />
Aufsätzen zu dokumentieren und an<strong>de</strong>res mehr“ (Felt et al. 1995, 134). Dabei ist<br />
die Beobachtung <strong>de</strong>r „Science in Action“ (Latour 1987) an bestimmten Grundsätzen<br />
orientiert. Dazu gehören etwa Auffor<strong>de</strong>rungen an die Durchführen<strong>de</strong>n wie „Folge <strong>de</strong>n<br />
Akteuren“ (ebd.) o<strong>de</strong>r „Folge ihren Praktiken und Dingen und beschreibe Relationen“<br />
(Rammert 2007, 12). Die Beobachtungen selbst wer<strong>de</strong>n mit Bezug auf die<br />
anthropologische Tradition in Feldnotizen festgehalten, heutzutage auch mittels Bild-<br />
und Tonaufzeichnungen sowie Computerprotokollen. Neuere Studien auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r<br />
Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. Kapitel 3.3) ergänzen dieses empirische Material<br />
zumeist um Interviews mit <strong>de</strong>n ExpertInnen im Feld. Zu <strong>de</strong>n klassischen Auswertungsmetho<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Anthropologie gehören Verdichtungen (vgl. etwa Geertz 1983 [1973])<br />
sowie qualitative sozialwissenschaftliche Metho<strong>de</strong>n.<br />
Gegenstand dieser ethnografischen Verfahren ist mittlerweile nicht mehr nur die<br />
naturwissenschaftliche Arbeit. Die Metho<strong>de</strong> wird auch im Bereich <strong>de</strong>r Technologie-<br />
Gestaltung eingesetzt. Dort hat sie jedoch ein an<strong>de</strong>res Ziel als <strong>de</strong>n allgemeinen<br />
Nachweis <strong>de</strong>r sozialen Gemachtheit naturwissenschaftlicher Fakten bzw. technischer<br />
Artefakte. Vielmehr geht es dabei in <strong>de</strong>r Regel darum, Erkenntnisse über die Nutzung<br />
und <strong>de</strong>n Anwendungsbereich <strong>einer</strong> Technologie zu gewinnen. Die ersten bekannten<br />
ethnografischen Studien im Technologiebereich sind Suchmans Analysen <strong>de</strong>r<br />
Interaktion von NutzerInnen mit so genannt intelligenten Kopierern (Suchman 1987)<br />
sowie Julian Orrs Untersuchung <strong>de</strong>r Arbeit und Kommunikation technischen Reparaturpersonals<br />
(Orr 1996). Suchman konnte aus ihrer Studien grundsätzliche Erkenntnisse<br />
über die Konzepte menschlichen Han<strong>de</strong>lns ableiten, die die TechnikgestalterInnen <strong>de</strong>m<br />
untersuchten Kopierer eingeschrieben hatten, in<strong>de</strong>m sie zeigte, dass eine mangeln<strong>de</strong><br />
296
Berücksichtigung <strong>de</strong>r Situiertheit von Handlungen zu Störungen in <strong>de</strong>r Interaktion mit<br />
<strong>de</strong>r Maschine führte. Sie leistete somit mittels Labor- bzw. ethnografischer Studien zu<br />
<strong>de</strong>m hier angestrebten Vorhaben, auf <strong>de</strong>r Ebene von Grundlagen <strong>de</strong>r Informatik zu<br />
intervenieren, einen maßgeblichen analytischen Beitrag. Demgegenüber wer<strong>de</strong>n diese<br />
Metho<strong>de</strong>n im „User-Centered Design“, z.T. auch im „Participatory Design“ häufig<br />
lediglich dazu benutzt, Arbeitsabläufe und Interaktionen von NutzerInnen mit <strong>de</strong>r<br />
Technik genau zu beobachten, um im Sinne von Funktionalität und Interfacegestaltung<br />
„bessere“ Anwendungssysteme zu kreieren. Grundlegen<strong>de</strong> Konzepte, auf <strong>de</strong>nen die<br />
Technologien beruhen, wer<strong>de</strong>n dabei jedoch kaum untersucht.<br />
Dies lässt sich zum Teil durch die jeweilige Zielsetzung <strong>de</strong>r Projekte, zum Teil aber<br />
auch durch die epistemologischen Grundannahmen erklären, auf <strong>de</strong>ren Basis<br />
ethnografische Studien häufig durchgeführt wer<strong>de</strong>n. Denn klassische anthropologische<br />
Ansätze gingen – wie auch die frühen Laborstudien – in ihrem Selbstverständnis davon<br />
aus, dass sie frem<strong>de</strong> Kulturen erforschten, ohne dass sie dabei die eigene Beteiligung<br />
an <strong>de</strong>r Konstruktion <strong>de</strong>r Ergebnisse mit reflektierten. Ethnografische Untersuchungen<br />
in <strong>de</strong>r Informatik folgen oft diesem objektivistischen Verständnis <strong>de</strong>s „view from<br />
nowhere“, nach <strong>de</strong>m die Beschreibungen <strong>de</strong>s Beobachteten als unhinterfragbare<br />
„Wirklichkeit“ wahrgenommen wer<strong>de</strong>n. Im Gegensatz dazu verstehen sich konstruktivistische<br />
AnthropologInnen und WissenschaftsforscherInnen in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r „Cultural<br />
Studies of Science and Technology“ als aktiv Partizipieren<strong>de</strong> am Forschungsprozess.<br />
Sie begreifen nicht nur die Ergebnisse <strong>de</strong>s von ihnen untersuchten<br />
Forschungsfelds als eine sozial-kulturelle Konstruktion, son<strong>de</strong>rn auch die ihrer eigenen<br />
Studien, in die Positionen und Selbstverständlichkeiten <strong>de</strong>r ForscherInnen<br />
unvermeidlich Eingang fin<strong>de</strong>n.<br />
Eine solche Beeinflussung <strong>de</strong>r Forschungsergebnisse fängt bereits bei <strong>de</strong>r Präsenz<br />
<strong>de</strong>r WissenschaftsforscherInnen im Forschungsfeld an, welche die Möglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Beobachtung bestimmen. So wird etwa eine Geschlechter-Technik-Forscherin in einem<br />
männlich dominierten Feld <strong>de</strong>r Technologieentwicklung an<strong>de</strong>re Phänomene beobachten<br />
können als ihre Kollegen (vgl. hierzu etwa Bath/ Weber 2006, 29). Ebenso ist <strong>de</strong>r<br />
Blick von WissenschaftsforscherInnen durch die Beteiligung an <strong>de</strong>r Technowissenschaftskultur<br />
und <strong>de</strong>r damit einhergehen<strong>de</strong>n Verfangenheit in Selbstverständlichkeiten<br />
geprägt, aufgrund <strong>de</strong>ssen sie bestimmte Aspekte <strong>de</strong>r beobachteten Situationen wahrnehmen,<br />
an<strong>de</strong>re aber als „blin<strong>de</strong> Flecke“ nicht „sehen“ können. 385 Die Subjektivität und<br />
Befangenheit in spezifischen historischen, räumlichen und soziokulturellen Kontexten<br />
kann aber auch über solche für <strong>de</strong>n Forschungsprozess nicht intendierte Effekte<br />
hinaus eine bewusste Form <strong>de</strong>r Intervention annehmen. Beispielsweise lässt sich das<br />
Ziel <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte als intentionale Einflussnahme auf <strong>de</strong>n<br />
Technikgestaltungsprozess von Seiten <strong>de</strong>r Sozial- und Kulturwissenschaften<br />
verstehen.<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis dieser Überlegungen möchte ich die De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n für die<br />
informatische Grundlagenforschung weiter<strong>de</strong>nken. Dazu schlage ich gegenüber <strong>de</strong>n<br />
klassischen Laborstudien, aber ebenso gegenüber <strong>de</strong>n klassischen „Workplacestudies“<br />
<strong>de</strong>s „User-Centered Design“ sowie vielen Ausprägungen partizipativer Verfahren eine<br />
doppelte Verschiebung vor. Erstens sollten „Laborstudien“ zur Beobachtung und Erfor-<br />
385 Diese Problematik tritt letztendlich bei jedwe<strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Forschung auf.<br />
297
schung von InformatikerInnen bei <strong>de</strong>r Arbeit, insbeson<strong>de</strong>re im Grundlagenforschungsbereich,<br />
eingesetzt wer<strong>de</strong>n und nicht nur für die Untersuchung <strong>de</strong>r Arbeit von<br />
NaturwissenschaftlerInnen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Interaktion von NutzerInnen mit Technologien.<br />
Denn auf diese Weise können grundlegend Konzepte und Annahmen <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
offen gelegt und <strong>de</strong>r Reflektion zugänglich gemacht wer<strong>de</strong>n. Zweitens sind<br />
die Erkenntnisse <strong>de</strong>r Wissenschafts- und TechnikforscherInnen vor <strong>de</strong>m Hintergrund<br />
ihrer eigenen Mitbeteiligung, d.h. mit Hilfe <strong>einer</strong> konstruktivistischen Epistemologie zu<br />
verstehen. Davon ausgehend kann schließlich erprobt wer<strong>de</strong>n, wie Wissenschafts- und<br />
TechnikforscherInnen als GeschlechterforscherInnen eine wissenschaftliche Gemeinschaft<br />
<strong>de</strong>r Informatik nicht nur <strong>kritisch</strong> analysieren, son<strong>de</strong>rn explizit aus <strong>einer</strong> feministischen<br />
Perspektive auf sie Einfluss nehmen können. 386<br />
Eine solche Vorgehensweise als Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Technologiegestaltung vorzustellen,<br />
erscheint – da sie traditionelle Grenzziehungen zwischen <strong>de</strong>n Disziplinen aufbricht –<br />
provokativ und neu. Denn zur Erforschung <strong>de</strong>r Grundlagenbereiche in <strong>de</strong>r Informatik<br />
und KI, insbeson<strong>de</strong>re zu wissensbasierten Systemen und zur Artificial Life-Forschung,<br />
liegen zwar bereits einige ethnografische Arbeiten vor, die in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r<br />
konstruktivistischen „Laborstudien“ stehen (vgl. Forsythe 1993a, b, Helmreich 1998,<br />
Henriksen 2002, Jensen 2004). Jedoch gehört eine bewusste Einwirkung auf die<br />
untersuchten technischen Fel<strong>de</strong>r nicht zu <strong>de</strong>ren expliziter Forschungsagenda. 387<br />
Umgekehrt gibt es auch auf Seiten <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Interventionsforschung durchaus<br />
wissenschaftliche Programme, die in Bereichen <strong>de</strong>r Informatik auf eine Verän<strong>de</strong>rung<br />
technologischer Grundlagen und Konzepte zielen. So strebt etwa das „Virtual<br />
Knowledge Studio“ in Amsterdam an, mittels reflexiver Analyse auf die Gestaltung<br />
<strong>de</strong>rjenigen Technologien Einfluss zu nehmen, die gegenwärtig in Großbritannien unter<br />
<strong>de</strong>n Namen „E-Science“ und in <strong>de</strong>n USA als „Cyber Infrastructures“ diskutiert wer<strong>de</strong>n<br />
und zukünftig die wissenschaftliche (Informations-)Arbeit unterstützen sollen (vgl. etwa<br />
Wouters/ Beaulieu 2007, Virtual Knowledge Studio 2008). Ebenso wird im Bereich <strong>de</strong>r<br />
Nanotechnologien von forschungspolitischer Seite versucht, durch eine entsprechen<strong>de</strong><br />
sozialwissenschaftliche Begleitforschung <strong>de</strong>r Nanowissenschaften frühzeitig Entwicklungen<br />
entgegen zu wirken, die bei <strong>de</strong>r Entwicklung von Gentechnologien – insbeson<strong>de</strong>re<br />
<strong>de</strong>r Agrobiotechnologien – als <strong>einer</strong> <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong> für die mangeln<strong>de</strong> Akzeptanz<br />
innerhalb breiter Bevölkerungsschichten angesehen wur<strong>de</strong>n. Allerdings wird dabei eher<br />
das Ziel verfolgt, wissenschaftliche Ergebnisse besser <strong>de</strong>r Gesellschaft zu kommunizieren<br />
als mittels „Laborstudien" in die Nanowissenschaften selbst zu intervenieren. 388<br />
Ferner fehlt all diesen Ansätzen eine fundierte feministische, insbeson<strong>de</strong>re epistemologische<br />
Perspektive, welche die Vergeschlechtlichung formaler und abstrakter<br />
Artefakte wie Dichotomien und Klassifikationen in <strong>de</strong>n Blick zu nehmen vermag.<br />
386 Genau genommen ist dabei eine dritte Verschiebung mit zu <strong>de</strong>nken, auf die insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r<br />
Techniksoziologe Werner Rammert und seine Kollegen <strong>de</strong>utlich hingewiesen haben. Mit <strong>de</strong>m Ansatz <strong>de</strong>r<br />
Technografie (vgl. Rammert 2007, Rammert/ Schubert 2006) betonen sie, dass auch bei <strong>de</strong>r Anwendung<br />
von Forschungsmetho<strong>de</strong>n das Mithan<strong>de</strong>ln <strong>de</strong>r Artefakte zu berücksichtigen sei. Dies ist auch <strong>de</strong>m in<br />
Kapitel 3 erarbeiteten theoretischen Rahmen zufolge erfor<strong>de</strong>rlich.<br />
387 Eine Ausnahme bil<strong>de</strong>t hierin das Forschungsprogramm <strong>de</strong>r Sozionik, bei <strong>de</strong>m zumin<strong>de</strong>st eine explizite<br />
Kooperation zwischen <strong>de</strong>r Soziologie und Multiagentenforschung angestrebt ist. Die in diesem Rahmen<br />
durchgeführten ethnografischen Fallstudien folgen jedoch eher <strong>de</strong>r Grundi<strong>de</strong>e <strong>de</strong>r Workplacestudies,<br />
<strong>de</strong>ren Folgerungen eher anwendungspraktisch auf die Nutzung <strong>de</strong>r konkreten Softwareprodukte<br />
ausgerichtet sind als auf ein <strong>kritisch</strong>es Hinterfragen kulturtheoretischer und epistemologischer Annahmen.<br />
388 In <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung wer<strong>de</strong>n diese forschungspolitischen Strategien lebhaft<br />
diskutiert, siehe etwa McNaghten et al. 2005; Erlemann 2010.<br />
298
Der Vorschlag, die Metho<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Laborstudien“ dafür zu nutzen, technologische<br />
Grundlagenkonzepte noch während ihrer Entstehung in <strong>de</strong>r Grundlagenforschung zu<br />
erkennen sowie <strong>kritisch</strong> zu reflektieren und zu verän<strong>de</strong>rn, hat <strong>de</strong>mzufolge mehrere<br />
Vorteile. Erstens wer<strong>de</strong>n die AkteurInnen direkt am Ort <strong>de</strong>s Geschehens verfolgt. Das<br />
heißt, dass die Analyse <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung auf die aktuell benutzten Konzepte<br />
bezogen ist, die von <strong>de</strong>n InformatikerInnen verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n, und damit nicht – wie<br />
die auf Produkte gerichteten Analysen von Technologien – zwangsläufig <strong>de</strong>m gegenwärtigen<br />
Stand <strong>informatischer</strong> Technologien und Theorien hinterher hinkt. In diesem<br />
Sinne ist die Metho<strong>de</strong> mit partizipativen Ansätzen verwandt, die bereits in <strong>de</strong>n frühen<br />
Phasen sowie während <strong>de</strong>s gesamten Entwicklungsprozesses von Softwaresystemen<br />
NutzerInnen zu beteiligen sucht. Sie vermag damit während <strong>de</strong>r Entstehung <strong>de</strong>r<br />
Konzepte <strong>kritisch</strong> einzugreifen und kann auf diese Weise nachhaltig wirksam wer<strong>de</strong>n.<br />
Intervenieren<strong>de</strong> „Laborstudien“ sind <strong>einer</strong>seits zeitlich-prozesshaft im Prozess <strong>de</strong>r<br />
Technologiegestaltung situiert. An<strong>de</strong>rerseits sind sie kulturell und hinsichtlich <strong>de</strong>r von<br />
<strong>de</strong>n WissenschaftlerInnen bearbeiteten Problemstellungen verortet. Damit hat die<br />
Metho<strong>de</strong> zweitens das Potential, <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r gleichzeitigen Materialisierung und<br />
Vergeschlechtlichung von Konzepten in <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik direkt<br />
bei ihrer Herstellung mitzuverfolgen. Sie vermag auf diese Weise <strong>de</strong>n in Kapitel 3.9.<br />
formulierten theoretischen Anspruch dieser Arbeit einzulösen.<br />
Der dritte Vorteil <strong>de</strong>s Vorschlags, „Laborstudien“ mit <strong>kritisch</strong>en Interventionen aus<br />
<strong>einer</strong> feministischen Perspektive zu verbin<strong>de</strong>n, besteht darin, dass er Gegenstrategien<br />
auch für diejenigen Vergeschlechtlichungsprozesse in <strong>de</strong>r Informatik zur Verfügung<br />
stellt, für die bislang nur wenige o<strong>de</strong>r gar keine De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung<br />
konzipiert wer<strong>de</strong>n konnten. So konnten in dieser Arbeit etwa keine<br />
methodischen Vorschläge eines De-Gen<strong>de</strong>ring für Informations-, ExpertInnen- und<br />
Wissenssystemen wie HIPPOCRATES und CYC gemacht wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Vergeschlechtlichung<br />
auf epistem-onto-logischen Ebenen in Kapitel 4.3.2. aufgezeigt wor<strong>de</strong>n<br />
war. Die Systeme selbst haben heutzutage zwar lediglich eine historische Be<strong>de</strong>utung.<br />
Jedoch lässt sich von diesen Fallstudien lernen, wie bei ähnlichen Projekten, die – wie<br />
beispielsweise das Semantic Web – aktuell Wissensordnungen produzieren, eine<br />
solche Vergeschlechtlichung vermie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n kann. Dazu können intervenieren<strong>de</strong><br />
„Laborstudien“ methodisch richtungsweisend sein. Ebenso erscheint eine Zusammenarbeit<br />
zwischen GeschlechterforscherInnen und InformatikerInnen im Sinne eines<br />
solchen methodischen Ansatzes viel versprechend, um Mo<strong>de</strong>llierungsprozesse mit<br />
Hilfe <strong>de</strong>r Objektorientierung (vgl. Kapitel 4.3.2.) <strong>kritisch</strong>-feministisch zu begleiten.<br />
Eine intervenieren<strong>de</strong> „Laborstudien“-Forschung stellt jedoch hohe Anfor<strong>de</strong>rungen an<br />
sämtliche Beteiligte, da sie eine intensive interdisziplinäre Übersetzungsarbeit voraussetzt.<br />
Als beson<strong>de</strong>rs sorgfältiges ethnografisches Verfahren erscheint die Metho<strong>de</strong><br />
zwar geeignet, um die Herstellungsprozesse technologischer Konzepte von Seiten <strong>de</strong>r<br />
sozial- und kulturwissenschaftlichen Technikforschung besser zu verstehen. Dabei<br />
müssen die TechnikforscherInnen jedoch dafür offen sein, sich auf Denk- und Sprachgewohnheiten<br />
eines <strong>grundlagen</strong>orientierten technischen Felds einlassen. Gleichzeitig<br />
müssen die TechnologiegestalterInnen dazu bereit sein, ihre Denkweisen und<br />
Routinen verständlich zu erklären, zu hinterfragen und ggf. neue Vorschläge<br />
aufzunehmen. Ferner hat die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit nachdrücklich aufgezeigt, dass<br />
Gen<strong>de</strong>ring-Prozesse höchst komplex und wi<strong>de</strong>rsprüchlich sein können. Um solche im<br />
299
Feld wirksame Vergeschlechtlichungen i<strong>de</strong>ntifizieren und begreifen zu können sowie<br />
alternative Vorschläge zu entwickeln, sind neben einem guten Verständnis <strong>de</strong>r technologischen<br />
Konzepte fundierte Kenntnisse <strong>de</strong>r Geschlechterforschung und feministischen<br />
Theorie notwendig. Eine solch radikale Kreuzung disziplinärer Gewohnheiten<br />
setzt nicht nur auf <strong>de</strong>r kognitiven Ebene die Bereitschaft und Ressourcen zur<br />
Zusammenarbeit voraus, son<strong>de</strong>rn erfor<strong>de</strong>rt vielmehr Vertrauen von allen Seiten. Neben<br />
Verständigungen auf inhaltlichen, sprachlichen und konzeptuellen Ebenen ist die<br />
gegenseitige Offenheit eine notwendige Bedingung. Erst auf diesem Bo<strong>de</strong>n wird es<br />
möglich sein, Grundannahmen <strong>de</strong>r technologischen Forschung und Entwicklung<br />
gemeinsam zu überprüfen, zu diskutieren und dadurch fundamentalen Konzepten<br />
<strong>informatischer</strong> Grundlagenforschung wie epistemologischen Setzungen <strong>kritisch</strong>e<br />
Anstösse zu geben und allmählich, aber kontinuierlich in eine feministisch-<strong>kritisch</strong>e<br />
Richtung zu verschieben.<br />
Dass die Kombination ethnografischer Ansätze mit einem <strong>kritisch</strong>-feministischen Interventionsanspruch<br />
für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Grundlagenforschung Erfolg<br />
verspricht, zeigte das Forschungsprojekt „Sozialität mit Maschinen“ von Jutta Weber<br />
und mir, in <strong>de</strong>m wir die vorgeschlagene Methodik erprobt hatten. Dieses Forschungsprojekt<br />
zielte darauf, Konzepte von Interaktion, Sozialität und Emotionen, mit <strong>de</strong>nen<br />
InformatikerInnen versuchen, Software-AgentInnen und Roboter menschähnlich zu<br />
gestalten, aus <strong>einer</strong> feministischen, gesellschafts<strong>kritisch</strong>en und wissenschaftstheoretischen<br />
Perspektive zu analysieren. Anhand von Literaturstudien, ExpertInneninterviews,<br />
<strong>de</strong>r Teilnahme an einschlägigen Tagungen und Kurzzeit-Laborstudien ließen<br />
sich innerhalb <strong>de</strong>s technischen Felds vergeschlechtlichte Muster erkennen, etwa eine<br />
„Caregiver-Infant“-Beziehung <strong>de</strong>r KonstrukteurInnen mit ihren technischen Kreationen<br />
(vgl. Weber 2005b, Weber 2006, 76) o<strong>de</strong>r epistem-ontologische Annahmen, die auf <strong>de</strong>r<br />
geschlechtlich konnotierten Dichotomie von Rationalität und Emotionalität basierten<br />
(vgl. Kapitel 4.3.3. sowie Bath 2009, 2010). Solche Aspekte haben wir in <strong>de</strong>r Rolle <strong>de</strong>r<br />
feministischen TechnikforscherInnen problematisiert. Dabei sind wir in <strong>de</strong>r<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>n Software-AgentenforscherInnen und RobotikerInnen vielfach<br />
auf offene Türen gestoßen, <strong>de</strong>nn die InformatikerInnen nahmen solche <strong>kritisch</strong>en<br />
Anregungen durchaus auf.<br />
Es ist uns zwar nicht gelungen, während <strong>de</strong>r kurzen Zeit <strong>de</strong>r Zusammenarbeit<br />
alternative Konzepte <strong>de</strong>r Mensch-Maschine-Interaktion, die als „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red“ bezeichnet<br />
wer<strong>de</strong>n könnten, zu entwickeln und im Forschungsfeld zu etablieren. Ebenso wenig<br />
hatten wir die Möglichkeit, die im Forschungsfeld bestehen<strong>de</strong> Gruppe von WissenschaftlerInnen,<br />
die mit gesellschafts<strong>kritisch</strong>en und konstruktivistischen Emotionskonzepten<br />
arbeiten, zu stärken. Hierfür hätte es mehr Ressourcen und eine längerfristige<br />
Zusammenarbeit gebraucht. Dennoch stimmen die Reaktionen <strong>de</strong>r Beteiligten hoffnungsvoll.<br />
So ermutigten uns einzelne <strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen sogar dazu, <strong>kritisch</strong>en<br />
Aspekte technischer Entwürfe, die unseres Erachtens dringend <strong>einer</strong> Verän<strong>de</strong>rung<br />
bedürften, mit <strong>de</strong>n Software-AgentenforscherInnen und RobotikerInenn intensiv<br />
zu diskutieren und direkt auf <strong>de</strong>n Forschungs- und Entwicklungsprozess Einfluss zu<br />
nehmen. Dabei warnten sie jedoch zugleich davor, uns auf eklatantest vergeschlechtlichen<strong>de</strong><br />
Fälle zu konzentrieren und so „die DesignerInnen“ von Technologie<br />
vorzuführen, um mit solchen Ergebnissen in <strong>de</strong>n Sozial- und Kulturwissenschaften<br />
bzw. <strong>de</strong>r Geschlechterforschung brillieren zu können:<br />
300
„When you’re analyzing what you’re seeing, think about how people can actually<br />
work with that knowledge to make shifts. […] in other words, don’t just point out the<br />
problems, point out the features into which someone could apply some energy and<br />
make some change. […] Because if you’re only speaking for the critics, you can paint a<br />
beautiful case study, […] but if you really want to help practitioners shift their practice<br />
[…] point out to them […] those places where there’re dangerous spots. [… ] I think it’s<br />
all too easy to take the most negative cases and come up with a concept. And then,<br />
what happens is, you make the practitioners <strong>de</strong>fensive and they’re like ‚ha, oh, those<br />
critics again‘ […], they don’t un<strong>de</strong>rstand how much work you put into this, you know<br />
what I mean? So I think that’s one of the ways to offer, the way is to work with what<br />
you’ve found.“ (Interviewausschnitt in: Bath/ Weber 2006, 166)<br />
Es käme nun darauf an, diese Auffor<strong>de</strong>rung ernst zu nehmen und weitere Studien<br />
auf <strong>de</strong>r Basis dieser intervenieren<strong>de</strong>n Methodik durchzuführen, um die Konzepte und<br />
Forschungspraxen <strong>informatischer</strong> Grundlagenforschung zwar allmählich, aber kontinuierlich-nachhaltig<br />
in eine <strong>kritisch</strong>-feministische Richtung zu verschieben.<br />
5.6. Resümee: Methodische Konzepte für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte<br />
In diesem Kapitel 5 wur<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung vorgestellt, mit <strong>de</strong>nen<br />
sich <strong>de</strong>n in Kapitel 4 i<strong>de</strong>ntifizierten Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte begegnen lässt. Für je<strong>de</strong> <strong>de</strong>r herausgearbeiteten Dimensionen konnten<br />
konkrete methodische Vorschläge gemacht wer<strong>de</strong>n, die auf ein De-Gen<strong>de</strong>ring zielen.<br />
Dabei wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Regel zur Veranschaulichung noch einmal explizit auf die<br />
paradigmatischen Fallbeispiele für die Vergeschlechtlichungen von Technologien aus<br />
<strong>de</strong>m Kapitel 4 Bezug genommen.<br />
Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung Technikgestaltungsmetho<strong>de</strong> zum De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
„I-methodology“ <strong>de</strong>r DesignerInnen „User-Centered Design“ (5.2.):<br />
- „Usability Tests“<br />
- Ethnografische Studien/ „Cultural Probes“<br />
- „Personas“ und Auswahl Testpersonen<br />
Implizite Geschlechterannahmen<br />
im Anwendungsfeld<br />
Einschreibung expliziter<br />
Geschlechterstereotype in<br />
(menschenähnliche) Artefakte<br />
De-Kontextualisierung durch<br />
Formalisierungs-, Abstraktions-<br />
und Klassifikationsprozesse sowie<br />
epistem-ontologische<br />
Grundannahmen<br />
„User-Centered“ und „Partizipatory Design“ (5.3.):<br />
- „Contextual Design“/ Szenarien-basiertes Design<br />
- „Collective Resource Approach“<br />
- Organisations-Design-Spiele und<br />
Zukunftswerkstätten<br />
Spezifische Ansätze (5.4.):<br />
- „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“<br />
- „Design for Experience“<br />
- „Reflective Design“<br />
„Participatory Design“ und spezifische Ansätze (5.5.):<br />
- „Narrative Transformation“/ „Mind Scripting“<br />
- „Value Sensitive Design“<br />
- „Critical Technical Practice“<br />
- „Laborstudien“ als feministische Intervention<br />
301
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten: Ist das Gen<strong>de</strong>ring von Anwendungstechnologien<br />
1. auf die „I-methodology“ zurückzuführen, bei <strong>de</strong>r die DesignerInnen ihre<br />
eigenen Kompetenzen, Interessen und Nutzungsweisen als repräsentativ für sämtliche<br />
NutzerInnen <strong>de</strong>r Technologie erachten, so lässt sich diesen Vorstellungen in <strong>de</strong>r Regel<br />
mit Metho<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m „User-Centered Design“ entgegenwirken. Häufig genügt es<br />
dabei bereits, „Usability-Tests“ mit <strong>de</strong>m Produkt o<strong>de</strong>r Prototypen durchzuführen, um<br />
Fehlannahmen über NutzerInnen und <strong>de</strong>n Nutzungskontext zu wi<strong>de</strong>rlegen. Geht es<br />
jedoch darum, solche Selbstverständlichkeiten <strong>de</strong>r DesignerInnen und Missinterpretationen<br />
<strong>de</strong>s Nutzungszusammenhangs bereits im Vorhinein zu vermei<strong>de</strong>n, so können<br />
ethnografische Studien von NutzerInnen in Arbeitssituation o<strong>de</strong>r „Cultural Probes“ zur<br />
Erforschung von Nutzungssituationen im Alltag fundierte Erkenntnisse für <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess<br />
zur Verfügung stellen. Bei diesen Verfahren spielt jedoch die Auswahl<br />
von Testpersonen und Freiwilligen für die Verfahren eine wesentliche Rolle. Die<br />
„Personas“-Technik kann darüber hinaus hilfreich sein, Technologien für spezifische,<br />
charakteristische NutzerInnen zu konzipieren. Generell ist es jedoch zu bevorzugen,<br />
Tests, ethnografische Studien und „Cultural Probes“ mit ausgewählten NutzerInnen <strong>de</strong>r<br />
tatsächlichen Zielgruppen durchzuführen. Soll ein Design eine breite Zielgruppe<br />
erreichen, so ist eine größtmögliche Diversität von NutzerInnen bei <strong>de</strong>r Anwendung <strong>de</strong>r<br />
Verfahren anzustreben und Menschen verschie<strong>de</strong>nen Geschlechts, sexueller<br />
Orientierung, Alters, sozialer Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit etc. zu berücksichtigen.<br />
Bei <strong>einer</strong> weiteren Klasse von Technologien wur<strong>de</strong>n 2. implizite Geschlechterannahmen<br />
als <strong>de</strong>rjenige Mechanismus i<strong>de</strong>ntifiziert, aus <strong>de</strong>m eine Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r<br />
Artefakte resultiert. Liegen diese Annahmen relativ direkt auf <strong>de</strong>r Ebene von Geschlechterstereotypen<br />
wie beispielsweise <strong>de</strong>r Vorstellung, dass Frauen run<strong>de</strong> Formen<br />
gegenüber eckigen bevorzugen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r vermeintlich „weiblichen“ Technikinkompetenz,<br />
so wer<strong>de</strong>n hier ebenfalls „Usability“-Tests mit VertreterInnen <strong>de</strong>r tatsächlichen<br />
Zielgruppe Inkongruenzen aufzeigen können. Bestehen diese Annahmen jedoch<br />
vermittelter darin, „unsichtbare Arbeit“ im Prozess <strong>de</strong>r Anfor<strong>de</strong>rungsermittlung o<strong>de</strong>r<br />
Mo<strong>de</strong>llierung nicht wahrzunehmen und <strong>de</strong>shalb beim Design nicht zu berücksichtigen,<br />
so können die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „Contextual Design“ und <strong>de</strong>s „Scenario-based Design“<br />
die TechnikgestalterInnen dabei unterstützen, ansonsten ignorierte Aspekte von Arbeit<br />
angemessen zu mo<strong>de</strong>llieren und durch die Technologie zu unterstützen. Im Fall<br />
impliziter Ein- und Festschreibungen <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>n<br />
Arbeitsteilung in die Artefakte ist neben <strong>de</strong>r Analyse <strong>de</strong>s Anwendungskontexts eine<br />
explizite Parteinahme für die strukturell Benachteiligten notwendig. Eine solche<br />
politische Grundhaltung liegt <strong>de</strong>m „Participatory Design“ <strong>de</strong>r Skandinavischen Schule<br />
zugrun<strong>de</strong>, das unter an<strong>de</strong>rem die Techniken <strong>de</strong>r Organisations-Design-Spiele und<br />
Zukunftswerkstätten zur Verfügung stellt. Partizipative Metho<strong>de</strong>n sind bereits vielfach<br />
und höchst erfolgreich für die Gestaltung <strong>de</strong>rjenigen Softwaresystemen eingesetzt<br />
wor<strong>de</strong>n, die die Arbeit von abhängig Beschäftigten an so genannten „Frauenarbeitsplätzen“<br />
unterstützen sollen.<br />
Die 3. Variante <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte lässt sich<br />
ebenfalls auf stereotype Annahmen über Frauen und Männer zurückführen. Im<br />
302
Unterschied zu <strong>de</strong>n impliziten Einschreibungen beziehen sich diese Vorstellungen<br />
jedoch explizit auf <strong>de</strong>n Körper und das Verhalten. Sie kommen primär bei <strong>de</strong>r<br />
Konstruktion menschenähnlicher Artefakte wie Avataren, Computerspielfiguren und<br />
anthropomorphen Softwareagenten vor, in die sie häufig direkt übersetzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Metho<strong>de</strong>n, um auf dieser speziellen Ebene <strong>de</strong>r erneuten Festschreibung von „Weiblichkeiten“<br />
und „Männlichkeiten“ zu begegnen, bestehen darin, <strong>de</strong>n NutzerInnen eine<br />
Vielfalt subjektiver (Geschlechter-)Erfahrungen mit <strong>de</strong>n Artefakten zu ermöglichen.<br />
„Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ zielt darauf, <strong>de</strong>n NutzerInnen einen möglichst großen Raum<br />
bei <strong>de</strong>r Gestaltung von Technologien zur Verfügung zu stellen, beispielsweise in<strong>de</strong>m<br />
ihre Erzählungen und damit ihre I<strong>de</strong>ntitätskonstruktionen technisch unterstützt wer<strong>de</strong>n.<br />
Demgegenüber stellt „Design for Experience“ die verkörperten und emotionalen Erfahrungen<br />
<strong>de</strong>r NutzerInnen ins Zentrum <strong>de</strong>r Gestaltung. „Reflective Design“ geht in<br />
diesem Anspruch noch einen Schritt weiter, in<strong>de</strong>m es <strong>de</strong>n NutzerInnen wie GestalterInnen<br />
qua Design gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Reflektionen über scheinbare Selbstverständlichkeiten<br />
ermöglichen möchte. Die letzten bei<strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n überwin<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r<br />
Grundlage <strong>einer</strong> konstruktivistischen Epistemologie <strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Informatik und KI<br />
verbreiteten Versuch, körperliche Prozesse und Emotionen zu formalisieren, mo<strong>de</strong>llieren<br />
und damit unhinterfragt in die Artefakte hineinzuschreiben. Es steht jedoch noch<br />
aus, diese Vorgehensweisen zur De-Konstruktion von Geschlecht einzusetzen, bei<br />
<strong>de</strong>m das Artefakt etwa Erfahrungen in „an<strong>de</strong>ren“ Geschlechtern ermöglicht o<strong>de</strong>r eine<br />
Reflektion über das Zweigeschlechtlichkeitssystem an sich anstößt.<br />
Im Vergleich zu <strong>de</strong>n ersten drei beschriebenen Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte stellen 4. die De-Kontextualisierung durch Formalisierungs-,<br />
Abstraktions- und Klassifikationsprozesse sowie epistem-ontologische<br />
Grundannahmen die größte Herausfor<strong>de</strong>rung dar. Deshalb liegen hierzu nur vereinzelte<br />
Ansätze aus <strong>de</strong>r <strong>kritisch</strong>en Informatik vor, die als spezifische De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Strategie aussichtsreich erscheinen. Mit Hilfe <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n „Narrative Transformation“<br />
und „Mind Scripting“, die auf Frigga Haugs „Erinnerungsarbeit“ basieren, lassen sich<br />
Selbstverständnisse und Annahmen <strong>de</strong>r DesignerInnen sowie Gen<strong>de</strong>r-Skripte<br />
herausarbeiten und <strong>de</strong>ren <strong>kritisch</strong>e Reflektion in <strong>de</strong>n Softwareentwicklungsprozess<br />
integrieren. „Value Sensitive Design“ ist ein Verfahren, das ethische Werte (wie<br />
„Geschlechtergerechtigkeit“ o<strong>de</strong>r „Freedom from Bias“) festlegt und diese systematisch<br />
in ein technisches Artefakt einschreibt. „Critical Technical Practice“ zielt darauf,<br />
marginalisierte Aspekte menschlichen Han<strong>de</strong>lns zur Grundlage technologischer<br />
Konzepte zu machen, und eignet sich <strong>de</strong>shalb insbeson<strong>de</strong>re dazu, <strong>de</strong>r Einschreibung<br />
vergeschlechtlichter Dichotomien in Artefakte <strong>de</strong>r KI zu vermei<strong>de</strong>n. Ferner wer<strong>de</strong>n<br />
sozial- und kulturwissenschaftliche „Laborstudien“ als eine Form <strong>de</strong>r feministischen<br />
Intervention in <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik vorgeschlagen, die auf<br />
fundamentale Konzepte von Denken, Fühlen und Han<strong>de</strong>ln o<strong>de</strong>r auch die Wissensrepräsentation<br />
Einfluss zu nehmen vermag. Ein solches Vorgehen <strong>de</strong>r interdisziplinären<br />
Zusammenarbeit erscheint auch für <strong>de</strong>n Fall <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Mo<strong>de</strong>llierung, etwa durch die verbreitete Programmatik <strong>de</strong>r Objektorientierung,<br />
vielversprechend.<br />
Damit wur<strong>de</strong> in diesem Kapitel 5 insgesamt ein breites Spektrum von Ansätzen zur<br />
Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik vorgestellt, die für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
303
Artefakte geeignet sind. 389 Insbeson<strong>de</strong>re aus <strong>de</strong>n Bereichen <strong>de</strong>s „User-Centered<br />
Design“ und <strong>de</strong>s „Participatory Design“ liegen umfangreiche Erfahrungen vor, wie<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technikgestaltung aus <strong>einer</strong> Geschlechterforschungs- bzw. feministischen<br />
Perspektive dazu eingesetzt wer<strong>de</strong>n können. Demgegenüber müssen viele <strong>de</strong>r<br />
weiteren in diesem Kapitel 5 empfohlenen Verfahren für <strong>de</strong>n Zweck <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
erst noch erprobt wer<strong>de</strong>n. Dabei besteht die Herausfor<strong>de</strong>rung darin, dass einige dieser<br />
Vorgehensweisen von ihrem allgemein gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Ausgangspunkt spezifisch<br />
für <strong>de</strong>n Einsatz als De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie anzupassen sind. An<strong>de</strong>re wur<strong>de</strong>n<br />
ursprünglich für einen an<strong>de</strong>ren als <strong>de</strong>n hier vorgeschlagenen Kontext (bspw. in Bezug<br />
auf Anwendungstechnologien) entwickelt und müssen nun übertragen wer<strong>de</strong>n (bspw.<br />
auf die Grundlagenforschung). Auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r grundlegen<strong>de</strong>n Annahmen, Epistemologien<br />
und Ontologien, die <strong>de</strong>r Technikgestaltung zugrun<strong>de</strong> liegen, konnten zwar<br />
einzelne methodische Ansätze vorgestellt wer<strong>de</strong>n, die zu einem De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte beitragen. Jedoch bestehen gera<strong>de</strong> im Bereich <strong>de</strong>s Formalen<br />
und <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r Informatik weiterhin Leerstellen.<br />
Insgesamt wur<strong>de</strong> in diesem Kapitel 5 aufgezeigt, dass die <strong>kritisch</strong>e Informatik ein<br />
reichhaltiges Potential besitzt, um <strong>de</strong>n in Kapitel 4 herausgearbeiteten Dimensionen<br />
und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte entgegenwirken<br />
zu können. Deutlich wur<strong>de</strong> jedoch zugleich ein weiterhin erheblicher Forschungsbedarf,<br />
sowohl hinsichtlich <strong>de</strong>r Entwicklung weiterer geeigneter De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n<br />
als auch in Bezug auf die konkrete Anwendung und Erprobung <strong>de</strong>r hier<br />
vorgeschlagenen Vorgehensweisen.<br />
389 An dieser Stelle ist anzumerken, dass es eine Reihe weiterer methodischer Ansätze zur Technikgestaltung<br />
gäbe, die auf ihr Potential, <strong>de</strong>r Informatik De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n zur Verfügung zu stellen, hin<br />
abgeklopft wer<strong>de</strong>n sollten – beispielsweise das Gebiet <strong>de</strong>s „Computer Supported Cooperative Work“<br />
(CSCW) und die „Soft Systems Methodology“ (SSM). Allerdings bestand das Ziel dieses Kapitels 5 nicht<br />
darin, sämtliche für ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte in Frage kommen<strong>de</strong> Ansätze systematisch<br />
durchzugehen. Vielmehr sollte hier gezeigt wer<strong>de</strong>n, dass für die im Kapitel 4 herausgearbeiteten<br />
Dimensionen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte jeweils Metho<strong>de</strong>n existieren, mit <strong>de</strong>nen<br />
sich diesen Mechanismen entgegenwirken lässt.<br />
304
Kapitel 6<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring als „Design für lebbare Welten“: Entwurf <strong>einer</strong> Methodik<br />
feministischer Technologiegestaltung in <strong>de</strong>r Informatik<br />
Die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit legt einen Ansatz <strong>de</strong>s „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte“<br />
vor. Es wur<strong>de</strong> ein theoretisches Konzept <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
entwickelt (Kapitel 3). Anschließend sind verschie<strong>de</strong>ne Dimensionen und Mechanismen<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte herausgearbeitet (Kapitel 4)<br />
und Vorschläge unterbreitet wor<strong>de</strong>n, wie sich diese Prozesse durch jeweils geeignete<br />
Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung vermei<strong>de</strong>n lassen bzw. jenen entgegengewirkt<br />
wer<strong>de</strong>n kann (Kapitel 5). Diese drei Kapitel stellen somit eine Grundlage für eine<br />
feministische Methodologie <strong>de</strong>r Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik dar.<br />
Abschließend wird <strong>de</strong>r in dieser Arbeit entwickelte Ansatz „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte“ insgesamt diskutiert. Zunächst wird das Potential <strong>de</strong>s Ansatzes<br />
zusammenfassend ausgelotet. Nachfolgend wer<strong>de</strong>n wesentliche Schritte <strong>de</strong>r methodischen<br />
Vorgehensweise dargelegt und mit <strong>de</strong>m Forschungsstand und <strong>de</strong>r theoretischen<br />
Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte (vgl. Kapitel 2 und 3)<br />
gegengelesen, um auf argumentative Fallstricke, theoretische Verkürzungen und Grenzen<br />
<strong>de</strong>r methodischen Konzepte hinzuweisen. Letztlich wird <strong>de</strong>r in dieser Arbeit<br />
entwickelte Entwurf <strong>einer</strong> Methodologie feministischer Technologiegestaltung in <strong>de</strong>r<br />
Informatik auf <strong>de</strong>r Folie gängiger Strategien <strong>de</strong>r Geschlechterpolitik als ein „Design für<br />
lebbare Welten“ im Sinne <strong>de</strong>r Ansätze Haraways, Butlers und Suchmans eingeordnet.<br />
Potentiale <strong>de</strong>s vorgelegten Entwurfs <strong>einer</strong> Methodologie<br />
Der in dieser Arbeit vorgelegte Ansatz <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
bil<strong>de</strong>t das Grundgerüst <strong>einer</strong> Methodologie <strong>kritisch</strong>-feministischer Technikgestaltung in<br />
<strong>de</strong>r Informatik. Er stellt InformatikerInnen, die eine Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>r von ihnen<br />
konzipierten und entwickelten Technologien und Produkten vermei<strong>de</strong>n möchten, ein<br />
breites Spektrum an Konzepten sowie eine methodische Vorgehensweise zur Verfügung.<br />
Dabei grün<strong>de</strong>n die methodischen Vorschläge zur Technikgestaltung auf <strong>einer</strong><br />
sorgfältigen Analyse von Vergeschlechtlichungsprozessen <strong>de</strong>r Artefakte.<br />
Diese Arbeit gab erstens einen systematischen Überblick über Dimensionen und<br />
Mechanismen <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte und veranschaulichte diese<br />
anhand von Fallbeispielen. Damit wur<strong>de</strong> gezeigt, dass Geschlecht in <strong>de</strong>r Tätigkeit von<br />
InformatikerInnen eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle spielt und auf diese Weise nachträglich, aber<br />
nachdrücklich die Institutionalisierung von Geschlechterforschung als ein Teilgebiet <strong>de</strong>r<br />
Disziplin Informatik legitimiert. Zweitens wur<strong>de</strong>n theoretische Konzepte vorgestellt, wie<br />
die Verhältnisse von Technologie und Gesellschaft auf <strong>de</strong>r Basis aktueller Ansätze <strong>de</strong>r<br />
sozial- und kulturwissenschaftlichen Wissenschafts- und Technikforschung gefasst<br />
wer<strong>de</strong>n können. Damit fin<strong>de</strong>n auch diejenigen SoftwareentwicklerInnen und DesignerInnen<br />
in dieser Arbeit fundierte Ansätze, die Technikgestaltung als eine gesellschafts<strong>kritisch</strong>e<br />
Intervention verstehen und dafür theoretische Grundlagen, Fallbeispiele<br />
sowie Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Umsetzung suchen. Die herausgearbeiteten Dimensionen<br />
und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung bieten zugleich Ansatzpunkte, die für eine<br />
Analyse <strong>de</strong>r Einschreibung weiterer Ungleichheitsstrukturen nützlich sein können.<br />
305
Die theoretische Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte, nach <strong>de</strong>r sich<br />
Geschlecht und Technik in einem performativen Prozess <strong>de</strong>r Ko-Materialisierung<br />
konstituieren, lässt sich jedoch primär als ein Beitrag zur feministischen Technoscience-Forschung<br />
verstehen. Denn sie ermöglicht eine feministisch-<strong>kritisch</strong>e Analyse<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichungen <strong>de</strong>s Formalen, <strong>de</strong>r ontologischen Annahmen über <strong>de</strong>n<br />
Anwendungsbereich und über das spezifisch Humane, <strong>de</strong>r Grundlagenforschung <strong>de</strong>r<br />
Informatik sowie über <strong>de</strong>ren Verwicklungen mit epistemologischen Ebenen. Damit<br />
wur<strong>de</strong>n drittens auch diejenigen Artefakte in die feministische Analyse einbezogen, die<br />
von <strong>de</strong>n bislang vorliegen<strong>de</strong>n Ansätzen <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung<br />
vielfach außer Acht gelassen wer<strong>de</strong>n.<br />
Zu<strong>de</strong>m schärften die differenzierte Analyse und <strong>de</strong>r Versuch <strong>einer</strong> Ent-Vergeschlechtlichung<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte <strong>de</strong>n Blick <strong>de</strong>r Geschlechterforschung. Denn<br />
<strong>de</strong>r Bereich <strong>de</strong>r Technologiegestaltung erfor<strong>de</strong>rt konstruktive Vorschläge, die nicht auf<br />
<strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Kritik, Analyse und Dekonstruktion stehen bleiben können. Vielmehr<br />
zwingt er dazu, über positive Alternativen zu vorhan<strong>de</strong>nen Geschlechtereinschreibungen<br />
nachzu<strong>de</strong>nken und eine Politik <strong>de</strong>r Intervention zu praktizieren, ohne dabei<br />
jedoch reflexiv-<strong>kritisch</strong>e Positionen aufzugeben. Diese Übersetzung zwischen<br />
feministischer Theorie, konkreter Kritik und technischer Gestaltung stellt eine <strong>de</strong>r<br />
größten Herausfor<strong>de</strong>rungen für das Projekt <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
dar.<br />
Die Schwierigkeit, aber zugleich auch die Notwendigkeit interdisziplinären Denkens<br />
zeigte sich bereits bei <strong>de</strong>r Analyse von Vergeschlechtlichungsprozessen <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte, für die in dieser Arbeit verschie<strong>de</strong>ne Dimensionen herausgearbeitet wur<strong>de</strong>n.<br />
Sie lassen sich <strong>einer</strong>seits danach unterschei<strong>de</strong>n, in welchem Sinne die Kategorie<br />
Geschlecht relevant ist: Wer<strong>de</strong>n durch die Technologie Ausschlüsse hergestellt, die<br />
bestimmten Personengruppen eine Nutzung erschweren o<strong>de</strong>r verunmöglichen? Wer<strong>de</strong>n<br />
bestimmte Muster strukturell-symbolischer Ungleichheit durch Technologien reproduziert,<br />
die mit <strong>de</strong>r gesellschaftlich vorherrschen<strong>de</strong>n Geschlechtordnung korrelieren?<br />
O<strong>de</strong>r kommt die Vergeschlechtlichung eher durch Abstraktion, Formalisierung, Klassifizierung<br />
bzw. aufgrund epistemologischer Annahmen zustan<strong>de</strong>? Dabei kann ferner<br />
differenziert wer<strong>de</strong>n, ob Annahmen über Frauen und Männer, über Weiblichkeit und<br />
Männlichkeit explizit in die Artefakte eingeschrieben wer<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Prozess <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>ring eher vermittelt über implizite Geschlechtseinschreibungen erfolgt.<br />
An<strong>de</strong>rerseits ließen sich unterschiedliche Ursachen und Mechanismen feststellen,<br />
durch die eine Vergeschlechtlichung <strong>de</strong>s Technikentwicklungsprozesses stattfin<strong>de</strong>n<br />
kann: Gehen Technologie<strong>de</strong>signerInnen implizit davon aus, dass NutzerInnen dieselben<br />
Kompetenzen, Interessen und Vorlieben haben wie sie selbst? Fließen Geschlechterannahmen<br />
in die Vorstellungen über die NutzerInnen und vom Anwendungskontext<br />
ein o<strong>de</strong>r bereits in die Problem<strong>de</strong>finitionen und Konzepte, die <strong>einer</strong> Technologie<br />
zugrun<strong>de</strong> liegen? Wur<strong>de</strong>n bestimmte Aspekte bei <strong>de</strong>r Analyse und Mo<strong>de</strong>llierung von<br />
Arbeit, Tätigkeiten o<strong>de</strong>r Wissen nicht berücksichtigt, die <strong>de</strong>shalb von <strong>de</strong>r<br />
entsprechen<strong>de</strong>n Technologie nicht unterstützt bzw. dargestellt wer<strong>de</strong>n? Wur<strong>de</strong> die<br />
Geschlechterpolitik <strong>de</strong>s Anwendungsfelds ignoriert? Wur<strong>de</strong> auf wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse an<strong>de</strong>rer Disziplinen zurückgegriffen, die jedoch selbst von <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n<br />
strukturell-symbolischen Geschlechterordnung durchdrungen sind? Ist die<br />
Vergeschlechtlichung ein Resultat <strong>de</strong>s Versuchs, die Realität <strong>de</strong>s Anwendungsfelds<br />
306
zw. menschlicher Handlung abzubil<strong>de</strong>n und wird damit zugleich auf epistemologische<br />
Ebenen verwiesen?<br />
Ein allgem<strong>einer</strong> Ansatz <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte muss diese<br />
vielfältigen Facetten von Geschlechtskonstruktionen beim Design <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
berücksichtigen und für <strong>de</strong>n betrachteten Fall <strong>einer</strong> Technologie konkretisieren.<br />
Deshalb wur<strong>de</strong> ein situiertes Vorgehen empfohlen, das <strong>de</strong>n passen<strong>de</strong>n Ansatzpunkt für<br />
eine feministisch-<strong>kritisch</strong>e Intervention in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung ermittelt und <strong>de</strong>ren<br />
Zielrichtung bestimmt.<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte „in a nutshell“<br />
Der methodische Vorschlag für eine feministische Technikgestaltung in <strong>de</strong>r Informatik,<br />
<strong>de</strong>n die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit unterbreitet, lässt sich grob durch eine vierschrittige Vorgehensweise<br />
beschreiben:<br />
1. Analyse: Welche Vergeschlechtlichungsprozesse und -mechanismen können in<br />
<strong>de</strong>m jeweils vorliegen<strong>de</strong>n Fall i<strong>de</strong>ntifiziert wer<strong>de</strong>n? (vgl. Kapitel 4)<br />
2. Zielbestimmung: Was soll aufgrund <strong>de</strong>r Analyse das Ergebnis eines feministischen<br />
Gestaltungsprozesses sein? (vgl. Kapitel 5.1.)<br />
3. Auswahl geeigneter Metho<strong>de</strong>n: Gibt es hierfür bereits bekannte Metho<strong>de</strong>n und<br />
Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Technologiegestaltung, die für diesen Zweck eingesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
können? Inwieweit müssen diese modifiziert o<strong>de</strong>r erweitert wer<strong>de</strong>n, um das<br />
entsprechen<strong>de</strong> De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziel zu erreichen? (vgl. Kapitel 5.2.-5.5.)<br />
4. Anwendung <strong>de</strong>r ausgewählten Metho<strong>de</strong>: Wie kann das jeweilige informatische Artefakte<br />
unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Theorie abgeleiteten <strong>kritisch</strong>en Aspekte<br />
(vgl. Kapitel 2 und 3) konzipiert und konstruiert wer<strong>de</strong>n?<br />
Diese Gesamtvorgehensweise soll noch einmal zusammenfassend anhand <strong>de</strong>r vier<br />
herausgearbeiteten Dimensionen und Mechanismen <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte beschrieben wer<strong>de</strong>n: a) <strong>de</strong>r „I-methodology“, b) <strong>de</strong>r impliziten und c)<br />
<strong>de</strong>r expliziten Einschreibungen von Geschlechterungleichheit und d) <strong>de</strong>r De-Kontextualisierung<br />
durch Formalisierung und Klassifizierung sowie ontologischer und<br />
epistemologischer Grundannahmen . Da die ersten drei Schritte in <strong>de</strong>n vorangegangenen<br />
Kapiteln bereits ausführlich diskutiert wor<strong>de</strong>n sind, sollen sie hier nur kurz<br />
dargelegt wer<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n geson<strong>de</strong>rten Beschreibung <strong>de</strong>s vierten<br />
Schrittes soll darauf aufmerksam gemacht wer<strong>de</strong>n, dass die Vorgehensweise für ein<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte nur dann produktiv gemacht wer<strong>de</strong>n kann,<br />
wenn sie <strong>kritisch</strong>-reflexiv angewen<strong>de</strong>t wird. Um Missverständnisse, argumentative Fallstricke<br />
und Verkürzungen zu vermei<strong>de</strong>n, ist es notwendig, sie vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r<br />
im Kapitel 2 und 3 dargestellten theoretischen Überlegungen zu interpretieren.<br />
a) Das erste Problem <strong>de</strong>r Technologiegestaltung, das in Kapitel 4 aus <strong>einer</strong><br />
Geschlechterforschungsperspektive i<strong>de</strong>ntifiziert wer<strong>de</strong>n konnte, ist die so genannte „Imethodology“.<br />
Technologien wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Regel in Gruppen von TechnologiegestalterInnen<br />
entwickelt, die relativ homogen zusammengesetzt sind und <strong>de</strong>shalb an<strong>de</strong>re<br />
Lebensperspektiven, Interessen und Fähigkeiten als die eigenen oftmals schwer in <strong>de</strong>n<br />
Blick bekommen. Die Annahmen, die aufgrund <strong>de</strong>ssen in die Technologie eingeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n, tendieren <strong>de</strong>shalb dazu, Menschen mit an<strong>de</strong>ren sozialen und kulturellen<br />
Hintergrün<strong>de</strong>n, an<strong>de</strong>ren Kompetenzen und Präferenzen o<strong>de</strong>r auch an<strong>de</strong>ren<br />
Geschlechtern in <strong>de</strong>r Nutzung zu behin<strong>de</strong>rn bzw. sie davon auszuschließen. Wird eine<br />
307
dadurch entstan<strong>de</strong>ne implizite Vergeschlechtlichung im ersten Schritt <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses,<br />
d.h. bei <strong>de</strong>r Analyse <strong>einer</strong> konkreten Technologie i<strong>de</strong>ntifiziert, so<br />
liegt es nahe, zunächst das Bewusstmachen von Unterschie<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>n TechnologiegestalterInnen<br />
als Ziel <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring zu bestimmen. Um <strong>de</strong>r „I-methodology“ <strong>de</strong>r<br />
TechnikgestalterInnen wirksam zu begegnen, sollten jene für die Diversität von NutzerInnen<br />
sowie <strong>de</strong>ren soziale und kulturelle Lebenswelten sensibilisiert wer<strong>de</strong>n. Dazu<br />
müssen bislang ignorierte und ausgeschlossene Perspektiven thematisiert, anerkannt<br />
und geeignet in <strong>de</strong>n Technikentwicklungsprozess integriert wer<strong>de</strong>n. Einzelne Fallstudien<br />
zeigten auf, dass das explizite Gestaltungsziel, Je<strong>de</strong> und Je<strong>de</strong>n durch das Design<br />
als NutzerIn einschließen zu wollen, jedoch nicht notwendigerweise <strong>de</strong>n gewünschten<br />
Effekt erzielt (vgl. 4.1.4.). Vielmehr ist hier ein methodisches Vorgehen erfor<strong>de</strong>rlich, um<br />
ein De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>de</strong>r betrachteten Technologie tatsächlich zu erreichen.<br />
In Kapitel 5.2. wur<strong>de</strong>n dazu die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ vorgeschlagen,<br />
die darauf ausgerichtet sind, Anfor<strong>de</strong>rungen von NutzerInnen <strong>de</strong>r tatsächlichen<br />
Zielgruppe zu ermitteln und in <strong>de</strong>n Technologiegestaltungsprozess zu integrieren.<br />
Speziell hingewiesen wur<strong>de</strong> auf „Usability Tests“, die Diskrepanzen zwischen <strong>de</strong>m NutzerInnenbild<br />
<strong>de</strong>r DesignerInnen und <strong>de</strong>n Fähigkeiten, Interessen und Vorlieben<br />
tatsächlicher NutzerInnen auf<strong>de</strong>cken können. Ethnografische Studien sind ferner<br />
geeignet, um Fehlannahmen <strong>de</strong>r DesignerInnen über die Nutzung bereits in <strong>de</strong>n frühen<br />
Phasen <strong>de</strong>r Technikentwicklung zu korrigieren, insbeson<strong>de</strong>re bei fragwürdigen<br />
Problem<strong>de</strong>finitionen, die <strong>einer</strong> Technologie zugrun<strong>de</strong> liegen. Insgesamt kann mit Hilfe<br />
<strong>de</strong>r Vorgehensweisen, die das breite Spektrum <strong>de</strong>s „User-Centered Design“ und s<strong>einer</strong><br />
vielfältigen Varianten (z.B. das Interaktions<strong>de</strong>sign) bieten, <strong>de</strong>r „I-methodology“ wirksam<br />
begegnen. Es liegen damit erprobte De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n vor, die im konkret<br />
vorliegen<strong>de</strong>n Fall geeignet ausgewählt wer<strong>de</strong>n müssen. Dabei ist es, wie insbeson<strong>de</strong>re<br />
die Diskussion <strong>de</strong>r „Personas“-Technik ver<strong>de</strong>utlicht hat (vgl. Kapitel 5.2.), relevant,<br />
welche Testpersonen und Freiwillige für <strong>de</strong>n Einsatz dieser methodischen Konzepte<br />
ausgewählt wer<strong>de</strong>n.<br />
b) Die zweite grundlegen<strong>de</strong> Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung,<br />
die in Kapitel 4 herausgearbeitet wur<strong>de</strong>, ist die <strong>de</strong>r impliziten Einschreibung<br />
<strong>de</strong>r strukturell-symbolischen Geschlechterordnung in Technologien. Diese wur<strong>de</strong> anhand<br />
von Fallstudien auf Stereotypisierungen von „Weiblichkeiten“ und „Männlichkeiten“,<br />
die Ignoranz von als „weiblich“ konnotierter „unsichtbarer Arbeit“ und die ungebrochene<br />
Fortschreibung bereits bestehen<strong>de</strong>r geschlechtskonstituieren<strong>de</strong>r Arbeitsteilung<br />
zurückgeführt und damit ausdiffererenziert.<br />
Gehen in das technische Design beson<strong>de</strong>rs extreme Annahmen über das Wesen<br />
von Frauen und Männern ein, so lassen sich diese häufig bereits mittels „Usability-<br />
Tests“ als unrealistisch i<strong>de</strong>ntifizieren. Weniger offensichtlich sind dagegen implizite Einschreibungen<br />
von Geschlechterdifferenz, die sich häufig bei Softwaresystemen zur<br />
Unterstützung typischer Frauenberufe (z.B. Sekretariat, Callcenter) fin<strong>de</strong>n, wo sie im<br />
Effekt die Tätigkeit <strong>de</strong>r Beschäftigten behin<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r ihre Arbeit nicht angemessen<br />
unterstützen. Dort sollte ein De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozess die tatsächliche Zielgruppe und<br />
ihre Anfor<strong>de</strong>rungen genau in <strong>de</strong>n Blick bekommen, um stereotypen Mustern (z.B. „Frau<br />
= technikinkompetent“) sowie <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Wahrnehmung von Tätigkeiten, die<br />
vorherrschend Frauen zugewiesen wer<strong>de</strong>n, entgegenwirken zu können (vgl. Kapitel<br />
4.2.1. und 4.2.4.). Ziel <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring ist <strong>de</strong>shalb in diesem Fall eine gleiche<br />
308
strukturell-symbolische Zuweisung von Kompetenzen und Tätigkeiten an Frauen und<br />
Männer.<br />
Um zuvor ausgeschlossene und ignorierte Aspekte von Tätigkeiten in ihrer<br />
Be<strong>de</strong>utung für <strong>de</strong>n Arbeitsprozess anzuerkennen und angemessen technisch zu unterstützen,<br />
können die in Kapitel 5.2. skizzierten Vorgehensweisen <strong>de</strong>s „User-Centered<br />
Design“ hilfreich sein. Im Kapitel 5.3. wur<strong>de</strong>n zusätzlich die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „Contextual<br />
Design“ und <strong>de</strong>s „Scenario-based Design“ beschrieben, die speziell und bereits<br />
erfolgreich dafür eingesetzt wor<strong>de</strong>n sind, die technisch zu unterstützen<strong>de</strong> Arbeit von<br />
Beschäftigten so <strong>de</strong>tailliert zu verstehen, dass stereotype Vorstellungen über NutzerInnen<br />
wi<strong>de</strong>rlegt wer<strong>de</strong>n und auch „unsichtbare Arbeit“ i<strong>de</strong>ntifiziert wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Dennoch ist damit die Problematik <strong>de</strong>r digitalen Fortschreibung struktureller<br />
Ungleichheit noch nicht vollständig gelöst. Denn selbst wenn es gelingt, <strong>de</strong>n Kontext<br />
und die Aufgaben <strong>de</strong>r NutzerInnen zu ermitteln und sie durch eine entsprechen<strong>de</strong><br />
Funktionalität und NutzerInnenführung <strong>de</strong>r Software angemessen zu unterstützen, wird<br />
die existieren<strong>de</strong> Geschlechterpolitik im Anwendungsfeld dabei nicht notwendigerweise<br />
durchkreuzt. Vielmehr laufen die bis hierher vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
Gefahr, die strukturell-symbolische Geschlechterordnung zu perpetuieren,<br />
wenn sie dazu tendieren, geschlechtskonstituieren<strong>de</strong> Arbeitsteilungen und<br />
hegemoniale Geschlechtszuweisungen bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung und technischen Gestaltung<br />
zu ignorieren. Deshalb muss eine De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie zugleich darauf zielen,<br />
vorherrschen<strong>de</strong> geschlechtlich markierte Machtverhältnisse zwischen <strong>de</strong>n AkteurInnen<br />
im Anwendungsfeld aufzubrechen. Dies setzt voraus, dass TechnologiegestalterInnen<br />
Aspekte struktureller Ungleichheit verstehen und explizit für die strukturell Benachteiligten<br />
eines technischen Gestaltungsprozesses Partei ergreifen.<br />
Für ein solches politisches Verständnis von Technologiegestaltung plädiert das<br />
„Participatory Design“ <strong>de</strong>r Skandinavischen Schule. Speziell die VertreterInnen <strong>de</strong>s<br />
„Collective Ressource Approach“ konkretisieren gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Perspektiven –<br />
wie in Kapitel 5.3. dargestellt – durch methodische Konzepte wie Organisations-<br />
Design-Spiele und Zukunftswerkstätten. Diese Ansätze wer<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>rum von<br />
feministischen ForscherInnen aufgegriffen und sind insbeson<strong>de</strong>re für die Gestaltung<br />
von Softwaresystemen, die an so genannten Frauenarbeitsplätzen eingesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
sollten, erfolgreich angewen<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n (vgl. Kapitel 5.3.).<br />
c) Als dritte Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte wur<strong>de</strong> in Kapitel<br />
4.2.5. die explizite Einschreibung <strong>de</strong>r strukturell-symbolischen Geschlechterordnung in<br />
Technologie i<strong>de</strong>ntifiziert (vgl. hierzu auch Kapitel 5.1.). Problematisch sind dabei insbeson<strong>de</strong>re<br />
digitale Repräsentationen geschlechtsstereotyper Körper und Verhaltensweisen,<br />
die zur Normalisierung von dichotomen Geschlechtern beitragen. Deshalb<br />
genügen die zuvor diskutierten Strategien in diesem Fall noch nicht, um <strong>de</strong>m Prozess<br />
<strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung wirksam begegnen zu können. Vielmehr erscheint eine<br />
Dekonstruktion von Geschlecht als einzig sinnvolles De-Gen<strong>de</strong>ring-Gestaltungsziel.<br />
Das be<strong>de</strong>utet, dass <strong>de</strong>r Gestaltungsprozess und <strong>de</strong>ssen Produkt primär auf eine<br />
Sensibilisierung für <strong>de</strong>n konstruktiven Charakter von Geschlecht auszurichten sind.<br />
Das Design <strong>de</strong>r Technologien sollte NutzerInnen dazu anregen zu reflektieren, dass<br />
Frausein bzw. Mannsein in einem Prozess <strong>de</strong>r ständigen Zuschreibung, Deutung und<br />
Performanz neu hervorgebracht wer<strong>de</strong>n muss. Auf dieser Basis ist die auch weithin<br />
309
verbreitete Annahme <strong>einer</strong> strikt binär konstituierten und unverän<strong>de</strong>rlichen körperlichen<br />
Geschlechtlichkeit durch Technologie kontinuierlich in Frage zu stellen.<br />
Für dieses De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziel wur<strong>de</strong>n in Kapitel 5.4. drei spezielle<br />
Vorgehensweisen vorgeschlagen: „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ strebt an, narrative Technologien<br />
so zu gestalten dass sie <strong>de</strong>n NutzerInnen vielfältige Selbstkonzeptionen<br />
ermöglichen, die jenseits stereotyp weiblicher o<strong>de</strong>r stereotyp männlicher I<strong>de</strong>ntitätsvorstellungen<br />
liegen. Demgegenüber zielt „Design for Experience“ darauf, dass<br />
NutzerInnen während <strong>de</strong>r Interaktion mit <strong>de</strong>m Artefakt umfassen<strong>de</strong>re, körperliche und<br />
emotionale Erfahrungen machen können. Dies lässt sich im Hinblick auf neue und<br />
viel<strong>de</strong>utige Geschlechtserfahrungen weiter <strong>de</strong>nken, etwa in Form von Computerspielen,<br />
in <strong>de</strong>nen die NutzerInnen an<strong>de</strong>re Geschlechter durch virtuellen Geschlechtsrollentausch<br />
erfahren können. Das dritte in 5.4. diskutierte methodische Konzept, das<br />
„Reflective Design“, versucht, gesellschafts<strong>kritisch</strong>e Reflektionsprozesse bei <strong>de</strong>n<br />
NutzerInnen und GestalterInnen anzuregen. Solche Denkanstöße lassen sich für ein<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring dahingehend modifizieren, dass ein Technologiegestaltungsprozess und<br />
sein Produkt das bestehen<strong>de</strong> Zweigeschlechtlichkeitssystem in Frage stellt, etwa durch<br />
verfrem<strong>de</strong>te, unein<strong>de</strong>utige bzw. brüchige Geschlechtsrepräsentationen. Insgesamt<br />
gehen die drei Metho<strong>de</strong>n nicht nur davon aus, dass Geschlechtseinschreibungen von<br />
Seiten <strong>de</strong>r TechnikentwicklerInnen vorgenommen wer<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn berücksichtigen<br />
zugleich die Konstruktionsleistungen von NutzerInnen beim Design, <strong>de</strong>ren<br />
Wahrnehmung zumeist zweigeschlechtlich vorgeprägt ist, und regen ein <strong>kritisch</strong>es<br />
Nach<strong>de</strong>nken über das heteronormative System <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit an.<br />
d) Als vierte problematische Form <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
wur<strong>de</strong> in Kapitel 4.3. aufgezeigt, dass die für die Informatik konstitutiven Tätigkeiten<br />
<strong>de</strong>s Klassifizierens, Abstrahierens und Formalisierens dazu tendieren, Setzungen und<br />
Voraussetzungen <strong>de</strong>s Technologiegestaltungsprozesses zu verbergen. Politische Konsequenzen,<br />
die als Sachzwänge erscheinen o<strong>de</strong>r als technische Notwendigkeit legitimiert<br />
wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>shalb zunächst wie<strong>de</strong>r sichtbar zu machen sind, ergeben sich in<br />
manchen Fällen aus im Gestaltungsprozess bewusst getroffenen Entscheidungen, in<br />
an<strong>de</strong>ren aus impliziten Annahmen Denn Abstraktionen, Klassifikationen und Formalismen<br />
suggerieren Objektivität und ein neutrales Forschungssubjekt. Sie stellen jedoch<br />
in ihrem Gebrauch u.a. Wissenshierarchien, vergeschlechtlichte Klassifikationen und<br />
Dichotomien her und reproduzieren damit bestehen<strong>de</strong> Macht- und Ungleichheitsverhältnisse<br />
wie die herrschen<strong>de</strong> Geschlechterordnung. Als ein generelles Ziel <strong>de</strong>s De-<br />
Gen<strong>de</strong>ring in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung wur<strong>de</strong> für solche formalen Artefakte <strong>de</strong>r<br />
Informatik die Re-Kontextualisierung, Reflektion und Revision <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> gelegten<br />
impliziten Voraussetzungen und expliziten Konzepte vorgeschlagen. Da ontologische<br />
Annahmen im Technologiegestaltungsprozess jedoch – wie anhand <strong>de</strong>r geschlechtlichen<br />
Markierung von immanenten Dichotomien beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>utlich gewor<strong>de</strong>n ist –<br />
untrennbar mit wissenschaftstheoretischen Annahmen verknüpft sind, setzt ein solcher<br />
<strong>de</strong>konstruktiver De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozess zugleich epistemologische Verschiebungen<br />
voraus, durch die die in <strong>de</strong>r Informatik und KI vorherrschen<strong>de</strong>n Objektivitätsverständnisse<br />
überwun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n könnten. Auf diese zweite Anfor<strong>de</strong>rung komme ich weiter<br />
unten zurück.<br />
Zunächst wer<strong>de</strong>n fragwürdige ontologische Annahmen über die jeweils mo<strong>de</strong>llierte<br />
„Realität“ – etwa Gen<strong>de</strong>rskripte, Konzepte <strong>de</strong>s Humanen, Kategorien und Klassifizier-<br />
310
ungen – betrachtet, die entwe<strong>de</strong>r innerhalb <strong>de</strong>r spezifischen Gruppe von Technologie<strong>de</strong>signerInnen<br />
o<strong>de</strong>r innerhalb <strong>einer</strong> gesamten Gesellschaft o<strong>de</strong>r Kultur als selbstverständlich<br />
gelten. 390 Ein De-Gen<strong>de</strong>ring erfor<strong>de</strong>rt hier erstens Techniken, um solche Annahmen<br />
aufzu<strong>de</strong>cken, zweitens theoretische Ansätze, um diese Annahmen <strong>kritisch</strong> zu<br />
reflektieren und Alternativen zu entwickeln, und drittens praktische Vorgehensweisen,<br />
um die alternativen Konzepte in <strong>de</strong>n Technologiegestaltungsprozess zu integrieren.<br />
In Kapitel 5.5. wur<strong>de</strong>n zwei methodische Konzepte zur Dekonstruktion von<br />
Vorannahmen über Softwareentwicklungsprozesse und Geschlecht in <strong>de</strong>n Diskursen<br />
<strong>de</strong>r TechnikgestalterInnen vorgestellt: „Narrative Transformation“ und „Mind Scripting“<br />
sind Verfahren, die primär auf eine Reflektion und Revision <strong>de</strong>r Problem<strong>de</strong>finitionen,<br />
sozialer Einschreibungen und impliziter Gen<strong>de</strong>rskripte in Software zielen. „Value<br />
Sensitive Design“ dagegen legt mittels <strong>einer</strong> konzeptuellen Analyse bestimmter Werte<br />
(„values“) fest, die durch <strong>de</strong>n Gestaltungsprozess explizit in die Technologie eingeschrieben<br />
wer<strong>de</strong>n sollen. Dies können Werte sein, die wie Geschlechtergerechtigkeit,<br />
Diversität o<strong>de</strong>r Gleichheit an feministische For<strong>de</strong>rungen anschlussfähig sind. Diese<br />
Metho<strong>de</strong> erscheint im Fall sogenannt technischer Verzerrungen, die beispielsweise bei<br />
<strong>de</strong>r Informationsdarstellung zum Tragen kommen können, beson<strong>de</strong>rs geeignet, aber<br />
auch bei Vergeschlechtlichungen, die aufgrund <strong>de</strong>r Transfers wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse aus an<strong>de</strong>ren Disziplinen entstehen.<br />
In Kapitel 4.3. wur<strong>de</strong> eine weitere, spezifische Form vergeschlechtlichter Annahmen<br />
über die Wirklichkeit, die in Technologie manifestiert sein können, betrachtet:<br />
Dichotomien. Diese haben in <strong>de</strong>r Informatik eine beson<strong>de</strong>re Relevanz, da sie mit <strong>de</strong>r<br />
zweiwertigen Logik <strong>de</strong>s Computers korrespondieren. Ihre Vergeschlechtlichung besteht<br />
häufig darin, dass die bei<strong>de</strong>n Pole <strong>einer</strong> Dichotomie in westlichen Denktraditionen<br />
häufig mit „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ assoziiert sind und diese Zuweisung mit<br />
<strong>einer</strong> Hierarchisierung einhergeht, durch die „<strong>de</strong>m Weiblichen“ zugeschriebene Aspekte<br />
ausgegrenzt o<strong>de</strong>r abgewertet wer<strong>de</strong>n. Um eine erneute Festschreibung solcher<br />
symbolischen Geschlechterordnungen durch Technologiegestaltung zu verhin<strong>de</strong>rn,<br />
liegt es nahe, das jeweils Ausgeschlossene, das „weiblich“ konnotiert wird, sichtbar zu<br />
machen und dann zu integrieren. Fallstudien zufolge erwies sich jedoch die<br />
Dekonstruktion von Dichotomien, die darauf zielt, <strong>de</strong>n Gegensatz prinzipiell zu<br />
unterlaufen, letztendlich als das nachhaltigere De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziel.<br />
Eine De-Konstruktion von Dichotomien in <strong>de</strong>r Technologiegestaltung erfor<strong>de</strong>rt damit,<br />
die für <strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess zugrun<strong>de</strong> gelegte Epistemologie <strong>kritisch</strong> in <strong>de</strong>n<br />
Blick zu nehmen. So <strong>de</strong>monstrierten einige Beispiele in Kapitel 4.3., dass ontologische<br />
Annahmen mit impliziten wissenschaftstheoretischen Annahmen darüber korrelieren,<br />
wer als Subjekt <strong>de</strong>s Wissens in Betracht kommt und in welchem Verhältnis Gegenstand,<br />
Mo<strong>de</strong>ll und Technologie zueinan<strong>de</strong>r stehen(vgl. Kapitel 4.3.2.). 391 Deshalb muss<br />
auf <strong>de</strong>r Ebene von Grundlagen und Grundlagenforschung ein weiteres De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Ziel formuliert wer<strong>de</strong>n: das Aufgeben <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Informatik und KI dominanten<br />
390 Solche Setzungen bei <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung, die <strong>de</strong>r Konstruktion von Technologien vorausgehen, können<br />
auch explizit von an<strong>de</strong>ren Disziplinen übernommen wor<strong>de</strong>n sein. Das ist dann problematisch, wenn <strong>de</strong>ren<br />
Erkenntnisse ebenfalls vergeschlechtlicht sind. Ein De-Gen<strong>de</strong>ring erfor<strong>de</strong>rt dann das Vorliegen<br />
feministischer Untersuchungen dieser disziplinären Erkenntnisse, vgl. hierzu auch die entsprechen<strong>de</strong>n<br />
Ausführungen in Kapitel 5.5.<br />
391 Diese prinzipiell untrennbare Verknüpfung von ontologischen mit epistemologischen Setzungen fasst<br />
Karen Barad unter <strong>de</strong>m Begriff <strong>de</strong>r „Epistem-onto-logie“, vgl. Kapitel 3.5.<br />
311
Objektivitätsverständnisse zugunsten <strong>einer</strong> konstruktivistischen Epistemologie. Dass<br />
Technikgestaltung auf <strong>de</strong>r Basis eines konstruktivistischen wissenschaftstheoretischen<br />
Verständnis möglich ist, wur<strong>de</strong> anhand <strong>de</strong>s „Design for Experience“ aufgezeigt. 392<br />
Diese Metho<strong>de</strong> unterläuft zugleich die Dichotomie von Gefühl und Vernunft, die <strong>de</strong>n<br />
herkömmlichen kognitionswissenschaftlichen Ansätzen <strong>de</strong>r Emotionsmo<strong>de</strong>llierung in<br />
<strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz-Forschung zugrun<strong>de</strong> liegt.<br />
In Kapitel 5.5. wur<strong>de</strong>n zwei weitere Techniken vorgestellt, die mit dieser<br />
Orientierung an <strong>de</strong>n Grundkonzepten technischer Bereiche, d.h. an <strong>de</strong>r Grundlagenforschung<br />
<strong>de</strong>r Informatik ansetzen: „Critical Technical Practice“ zielt auf die<br />
Invertierung von Metaphern im Diskurs eines technischen Fachgebiets. Diese Metho<strong>de</strong><br />
erscheint beson<strong>de</strong>rs für das De-Gen<strong>de</strong>ring von Dichotomien geeignet, die für die<br />
Grundlagen <strong>de</strong>r Informatik, wie etwa bestimmte Konzeptionen <strong>de</strong>s Menschen in <strong>de</strong>r KI,<br />
konstitutiv sind. Dabei setzt sie eine Überwindung traditioneller Objektivitätsverständnisse<br />
voraus. Ebenso bieten „Laborstudien“, die auf <strong>einer</strong> radikal interdisiplinären<br />
Zusammenarbeit zwischen sozial- bzw. kulturwissenschaftlichen TechnikforscherInnen<br />
und TechnologiegestalterInnen grün<strong>de</strong>n, die Möglichkeit, auf <strong>de</strong>r Ebene ontologischer<br />
und epistemologischer Annahmen in <strong>de</strong>r informatischen Grundlagenforschung <strong>kritisch</strong>feministisch<br />
zu intervenieren.<br />
Trotz all dieser Vorschläge stellt die Frage, auf welche Weise epistemologische<br />
Verschiebungen in <strong>de</strong>r informatischen Grundlagenforschung o<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>llierung<br />
methodisch erreicht bzw. unterstützt wer<strong>de</strong>n können, immer noch eine <strong>de</strong>r größten<br />
Herausfor<strong>de</strong>rungen für das hier formulierte De-Gen<strong>de</strong>ring-Programm dar.<br />
Potentielle Fallstricke und theoretische Verkürzungen<br />
Bis hierher sind die ersten drei Schritte <strong>de</strong>r durch die vorliegen<strong>de</strong> Arbeit vorgeschlagenen<br />
Methodik <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte – die Analyse <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring,<br />
die Zielbestimmung für das angestrebte De-Gen<strong>de</strong>ring und die Wahl <strong>einer</strong><br />
geeigneten Technologiegestaltungsmetho<strong>de</strong>, um das gesetzte Ziel zu erreichen – grob<br />
umrissen. Damit ist <strong>de</strong>r De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozess jedoch noch nicht abgeschlossen.<br />
Denn beim vierten Schritt, <strong>de</strong>r Anwendung <strong>de</strong>r jeweiligen Metho<strong>de</strong>n, sind potentielle<br />
argumentative Fallstricke, theoretische Verkürzungen und Grenzen <strong>de</strong>r methodischen<br />
Konzepte zu beachten. Diese wer<strong>de</strong>n anschließend kurz dargestellt, womit die<br />
vorgelegte Methodik an Erkenntnisse <strong>de</strong>r feministischen Technikforschung und <strong>de</strong>r<br />
theoretischen Konzeption <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte (vgl. Kapitel 2 und 3)<br />
zurückgebun<strong>de</strong>n wird.<br />
a) Die erste De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie, die auf die Inklusion und <strong>de</strong>n gleichen Zugang<br />
zu Technologie für eine breite Diversität von NutzerInnen setzt, birgt die Gefahr <strong>de</strong>r<br />
Essentialisierung von Geschlecht. Denn das Argument, dass bestimmte Personengruppen<br />
einen größeren Aufwand betreiben müssen als an<strong>de</strong>re, um eine Technologie<br />
für sich nutzen zu können, und dadurch insbeson<strong>de</strong>re Frauen ausgeschlossen sind,<br />
rekurriert häufig auf essentialisieren<strong>de</strong> Differenzierungen, die zwischen Frauen und<br />
Männern gemacht wer<strong>de</strong>n. So beruft sich etwa die „Discover Gen<strong>de</strong>r“-Studie auf<br />
vermeintliche körperliche und kognitive Geschlechtsunterschie<strong>de</strong>, die dadurch erneut<br />
392 Vgl. hierzu auch die in 4.3.1. diskutierten Konzeptionen feministischer Objektivität und<br />
konstruktivistischer Wissenschaftstheorie für die Informatik.<br />
312
festgeschrieben wer<strong>de</strong>n (vgl. Kapitel 2.2.). An<strong>de</strong>re Untersuchungen argumentieren<br />
damit, dass die Differenz eine strukturelle sei. Beispielsweise sind die AutorInnen <strong>de</strong>s<br />
Gen<strong>de</strong>r-Leitfa<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>s Projekts „Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming medial“ vorbildhaft bestrebt,<br />
erneute Geschlechtszuschreibungen zu vermei<strong>de</strong>n (vgl. Kapitel 2). Das zeigt, dass sich<br />
Essentialisierungen zwar durchaus intentional vermei<strong>de</strong>n lassen. Damit wer<strong>de</strong>n jedoch<br />
nicht notwendig zweigeschlechtliche Setzungen unterlaufen, die <strong>de</strong>n angewandten<br />
Metho<strong>de</strong>n und Konzepten inhärent sind, wie die Diskussion <strong>de</strong>r „I-methodology“ in<br />
Kapitel 4.1. gezeigt hat.<br />
Ein zweiter Kritikpunkt an <strong>de</strong>r ersten De-Gen<strong>de</strong>ring-Strategie bezieht sich theoretisch<br />
auf die Reichweite <strong>de</strong>r vorgeschlagenen De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>. Zum Beispiel<br />
vermag das „User-Centered Design“ die Problem<strong>de</strong>finition, Funktionalität und NutzerInnenführung<br />
<strong>einer</strong> Technologie besser an die NutzerInnen anzupassen als herkömmliche<br />
Vorgehensweisen <strong>de</strong>r Software-Entwicklung. Doch besitzt <strong>de</strong>r Ansatz nur ein<br />
beschränktes gesellschafts-, geschlechts- und wissenschafts<strong>kritisch</strong>es Potential. So<br />
wird etwa davon ausgegangen, dass Technologie für <strong>de</strong>n gewählten Kontext eine<br />
Lösung darstellt. Die Problem<strong>de</strong>finition selbst, die <strong>de</strong>r technischen Gestaltung vorausgeht,<br />
wird bei dieser Metho<strong>de</strong> nicht mit in Frage gestellt. Ferner erscheint es aufgrund<br />
<strong>de</strong>r empirischen Bezugnahme auf die NutzerInnen eher unwahrscheinlich, dass durch<br />
<strong>de</strong>n Technikgestaltungsprozess eine Dekonstruktion von Geschlecht bzw. <strong>de</strong>s<br />
Zweigeschlechtlichkeitssystems erreicht wer<strong>de</strong>n kann. Selbst wenn Personen als TestnutzerInnen<br />
ausgewählt wer<strong>de</strong>n sollten, die sich als queer verstehen, bedarf es <strong>einer</strong><br />
gegenüber <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit <strong>kritisch</strong>en Perspektive im gesamten Entwicklungsprozess,<br />
damit möglichst keine Alltagsannahmen über Frauen und Männer und<br />
damit verbun<strong>de</strong>ne hierarchische Verhältnisse in <strong>de</strong>n Artefakten vergegenständlicht<br />
wer<strong>de</strong>n. Dies ver<strong>de</strong>utlicht, dass an einem De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozess Geschlechterwissenschaftlerinnen<br />
stets beteiligt sein sollten. Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass<br />
„User Centered Design“ mit seinen empirischen Metho<strong>de</strong>n auf einem Objektivitätsverständnis<br />
grün<strong>de</strong>t, das aus <strong>de</strong>n meisten Perspektiven feministischer Epistemologie<br />
fragwürdig erscheint. In dieser Hinsicht besteht weiterer Forschungsbedarf, inwieweit<br />
die Metho<strong>de</strong> mit einem Verständnis <strong>de</strong>r Ko-Konstruktion von NutzerInnen,<br />
GestalterInnen und Produkt sowie <strong>de</strong>r von Technik und Geschlecht theoretisch fundiert<br />
wer<strong>de</strong>n kann.<br />
b) Partizipative Verfahren, die zum zweiten De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziel, nämlich Gleichheit<br />
herzustellen, beitragen, grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mgegenüber auf einem <strong>de</strong>zidiert gesellschafts<strong>kritisch</strong>en<br />
Ansatz und bekommen <strong>de</strong>shalb Ungleichheitsstrukturen – z.B. die geschlechtskonstituieren<strong>de</strong><br />
Arbeitsteilung – besser in <strong>de</strong>n Blick. Die Erfahrung zeigt<br />
jedoch, dass diese Metho<strong>de</strong>n von politisch Engagierten eingesetzt wer<strong>de</strong>n müssen, um<br />
<strong>de</strong>m politischen Anspruch auch gerecht wer<strong>de</strong>n zu können. Die Metho<strong>de</strong>n an sich<br />
führen noch nicht zum angestrebten Empowerment <strong>de</strong>r strukturell Benachteiligten.<br />
Ferner kann am „Participatory Design“-Ansatz kritisiert wer<strong>de</strong>n, dass er technik<strong>de</strong>terministisch<br />
argumentiert (vgl. Kapitel 3.1.), da emanzipatorische Ziele in Technologie<br />
eingeschrieben wer<strong>de</strong>n sollen. Er setzt eine Korrespon<strong>de</strong>nz zwischen <strong>de</strong>r Intention <strong>de</strong>r<br />
TechnikgestalterInnen und <strong>de</strong>n Wirkungen <strong>de</strong>r Technologie im Gebrauch voraus, die<br />
von vielen Studien <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung wi<strong>de</strong>rlegt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Nichts<strong>de</strong>stotrotz zeigen viele Fallbeispiele, dass sich Technologien für <strong>de</strong>n Bereich von<br />
Erwerbsarbeit mit Hilfe <strong>de</strong>s „Participatory Design“ so konstruieren lassen, dass sie für<br />
313
die NutzerInnen sinnvolle Werkzeug zur Verfügung stellen, mit <strong>de</strong>m jene ihre Aufgaben<br />
besser, leichter und effektiver erledigen und ihre betriebshierarchische Stellung und<br />
Kompetenz verbessern können. 393<br />
Kritisch zu hinterfragen sind speziell die Strategien <strong>de</strong>r Aufwertung und Sichtbarmachung<br />
weiblich konnotierter Tätigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften etc., die bei<br />
einem De-Gen<strong>de</strong>ring mittels partizipativer Metho<strong>de</strong>n häufig verfolgt wer<strong>de</strong>n. Denn<br />
diese laufen <strong>einer</strong>seits Gefahr, Geschlecht erneut festzuschreiben. An<strong>de</strong>rerseits ist das<br />
Sichtbarmachen „unsichtbarer Arbeit“ aus <strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Perspektive<br />
ambivalent zu beurteilen, da es <strong>de</strong>m Management bessere Möglichkeiten <strong>de</strong>r Kontrolle<br />
über die Beschäftigten an die Hand gibt (vgl. hierzu 4.2.3.). Diese Problematik ist ein<br />
unvermeidbares politisches Dilemma und kann nur konkret gelöst wer<strong>de</strong>n.<br />
c) Beschränkungen <strong>de</strong>r zur Dekonstruktion von Geschlecht vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n,<br />
die geschlechtsnormalisieren<strong>de</strong>n menschenähnlichen Repräsentationen entgegenwirken<br />
sollen, bestehen in <strong>de</strong>r Reichweite ihrer möglichen Anwendung. Denn sie<br />
zielen primär auf eine Gestaltung <strong>de</strong>s Interface zwischen Mensch und Maschine, welche<br />
<strong>de</strong>n NutzerInnen umfassen<strong>de</strong> Erfahrungen, Spaß und Spiel ermöglichen soll.<br />
Inwiefern methodische Ansätze zur Dekonstruktion von Geschlecht NutzerInnen auch<br />
bei ihren Arbeitsaufgaben und weiteren zu lösen<strong>de</strong>n Problemen unterstützen können,<br />
ist dagegen fragwürdig (vgl. Kapitel 5.4.). Hier bedarf es <strong>de</strong>r Entwicklung weiterer<br />
Metho<strong>de</strong>n. Doch selbst bei Technologien wie Avataren, Agenten und Spielfiguren kann<br />
das Ziel <strong>de</strong>r Dekonstruktion von Geschlecht durch für bestimmte NutzerInnen ungewöhnliche<br />
(geschlechtliche) Erfahrungen o<strong>de</strong>r die Reflektion <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Zweigeschlechtlichkeitssystems<br />
mit an<strong>de</strong>ren, zuvor bereits festgelegten Gestaltungszielen in<br />
Wi<strong>de</strong>rspruch geraten. Sie können beispielsweise im Fall anthropomorpher Softwareagenten<br />
<strong>de</strong>r intendierten Funktionalität (z.B. Informationsdarstellung, Verkaufsberatung,<br />
Lernunterstützung) entgegenstehen. Für solche Zielkonflikte sind geeignete Vorgehensweisen<br />
zu entwickeln. Ein <strong>de</strong>mgegenüber grundsätzlicheres Problem ist, dass<br />
auch das De-Gen<strong>de</strong>ring-Ziel <strong>de</strong>r Vervielfältigung und Verunein<strong>de</strong>utigung <strong>de</strong>s<br />
Geschlechts <strong>de</strong>r virtuellen Figuren an sich aus <strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>en Perspektive<br />
als neoliberale Flexibilisierungsstrategie in Frage gestellt wer<strong>de</strong>n kann (vgl. hierzu<br />
etwa Engel 2002).<br />
d) Auch bei <strong>de</strong>n spezifischen, für das De-Gen<strong>de</strong>ring von Vorannahmen, Konzepten<br />
und Grundlagenforschung vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n sind viele <strong>de</strong>r bereits angeführten<br />
Fallstricke und Verkürzungen zu beachten. So wird insbeson<strong>de</strong>re hier das<br />
Argument <strong>de</strong>r mangeln<strong>de</strong>n Wirtschaftlichkeit aufgrund zu hohen Aufwands vorgebracht<br />
wer<strong>de</strong>n, die etwa gegen Anwendung <strong>de</strong>s „Mind Scripting“ sprechen könnte. Ebenso<br />
kann <strong>de</strong>r Versuch, durch „Value Sensitive Design“ menschliche Werte bewusst in<br />
Technologie einschreiben zu wollen, aus Perspektive <strong>de</strong>r Wissenschafts- und Technikforschung<br />
als naiv beurteilt wer<strong>de</strong>n. Dagegen erfor<strong>de</strong>rn „Critical Technical Practice“<br />
und intervenieren<strong>de</strong> „Laborstudien“-Forschung ein hohes Maß an interdisziplinärer<br />
Übersetzungsarbeit und wer<strong>de</strong>n trotz<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r Praxis einige <strong>de</strong>r genannten<br />
Problematiken aufwerfen.<br />
393 Auf diese Kritik, die am gesamten De-Gen<strong>de</strong>ring-Programm geübt wer<strong>de</strong>n kann, wer<strong>de</strong> ich weiter unten<br />
noch zurückkommen.<br />
314
Grenzen in Bezug auf diese Kategorie von De-Gen<strong>de</strong>ring-Metho<strong>de</strong>n bestehen –<br />
ebenso wie bei <strong>de</strong>n Metho<strong>de</strong>n zur Dekonstruktion von Geschlecht – jedoch bislang<br />
weniger auf <strong>de</strong>r theoretischen Ebene als hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzung. So<br />
basieren die Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s „Design for Experience“ und <strong>de</strong>s „Reflective Design“, die im<br />
Zusammenhang dieser Arbeit für eine Dekonstruktion von Geschlecht angewandt wer<strong>de</strong>n<br />
sollen, zwar auf <strong>einer</strong> konstruktivistischen Epistemologie. Sie verknüpfen Technikgestaltung<br />
mit Gesellschaftstheorie und sind prinzipiell offen für feministische Theorie<br />
und Geschlechterforschung. Jedoch wur<strong>de</strong>n sie bisher noch nicht als De-Gen<strong>de</strong>ring-<br />
Metho<strong>de</strong>n eingesetzt. Erst die Erprobung und empirische Evaluation dieser Vorgehensweisen<br />
wird zeigen, ob sie zur erfolgreichen Dekonstruktion von Geschlecht bei <strong>de</strong>n<br />
betrachteten Artefakten beitragen können o<strong>de</strong>r ob vom Ziel <strong>de</strong>r „Menschenähnlichkeit“<br />
<strong>de</strong>r virtuellen Figuren – wie beim „Un<strong>de</strong>r<strong>de</strong>termined Design“ – prinzipiell abgerückt<br />
wer<strong>de</strong>n muss.<br />
Ähnliches gilt für die Metho<strong>de</strong>n zur Rekontextualisierung und Reflektion von Formalismen,<br />
zur Dekonstruktion von Dichotomien und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r technologischen Konstruktion<br />
vorausgehen<strong>de</strong>n ontologischen sowie epistemologischen Setzungen. Hier liegen bis<br />
dato kaum Erfahrungswerte für <strong>de</strong>n Einsatz <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n zum Zweck <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
vor. Zwar konnten immerhin für sämtliche Problematiken <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung,<br />
die anhand von Fallbeispielen in Kapitel 4.3. veranschaulicht wur<strong>de</strong>n, methodische<br />
Vorschläge gemacht wer<strong>de</strong>n. Dennoch besteht gera<strong>de</strong> auf dieser Ebene weiterhin<br />
ein großer Forschungsbedarf. Denn manche dieser vorgeschlagenen methodischen<br />
Konzepte wur<strong>de</strong>n zunächst für das De-Gen<strong>de</strong>ring von Anwendungstechnologien<br />
entwickelt und müssen für die Rekontextualisierung, Reflektion und Revision von<br />
Grundlagen und Grundlagenforschung noch erprobt wor<strong>de</strong>n. An<strong>de</strong>re sind auf Basis<br />
allgem<strong>einer</strong> gesellschafts<strong>kritisch</strong>er Theorien formuliert wor<strong>de</strong>n und müssen für das Ziel<br />
<strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring angepasst wer<strong>de</strong>n. Ob sich die methodischen Konzepte in <strong>de</strong>r Praxis<br />
bewähren, muss <strong>de</strong>shalb in Zukunft noch nachgewiesen wer<strong>de</strong>n. Dabei ist insbeson<strong>de</strong>re<br />
fraglich, inwieweit sich wissenschaftstheoretische Grundverständnisse in <strong>de</strong>r<br />
Informatik, die letztlich die Wurzel vieler Vergeschlechtlichungsprozesse auf <strong>de</strong>r<br />
ontologischen Ebene darstellen, mit solchen methodischen Konzepten nachhaltig<br />
verän<strong>de</strong>rn lassen.<br />
Es besteht gera<strong>de</strong> in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, feministisch-<strong>kritisch</strong> einzugreifen.<br />
Denn <strong>einer</strong>seits gewinnen Informationstechnologien, die wie das Semantic<br />
Web und formale Ontologien Ordnungen <strong>de</strong>s Wissens herstellen, die mit sozialen Ordnungen<br />
korrelieren und diese aufrechterhalten, in <strong>de</strong>r gegenwärtigen Informations-<br />
bzw. Wissensgesellschaft kontinuierlich an Relevanz. An<strong>de</strong>rerseits wer<strong>de</strong>n immer<br />
mehr Technologien mit Elementen <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz-Forschung ausgestattet,<br />
in die Annahmen über „<strong>de</strong>n Menschen“ und damit über Geschlecht eingehen. Der Vergeschlechtlichung<br />
solcher informatischen Artefake kann jedoch nur dadurch entgegengearbeitet<br />
wer<strong>de</strong>n, wenn die Verschränkung darin eingehen<strong>de</strong>r ontologischer Setzungen<br />
mit epistemologischen Annahmen reflektiert und zur Grundlage <strong>einer</strong> systematischen,<br />
feministisch-<strong>kritisch</strong>en Gestaltung gemacht wird. Die vorgelegten ersten<br />
Konzepte zu diesem herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Vorhaben wer<strong>de</strong>n in Zukunft allerdings noch<br />
weiterentwickelt und ausgebaut wer<strong>de</strong>n müssen. Ein innerhalb <strong>de</strong>r Informatik<br />
angesie<strong>de</strong>ltes „De-Gen<strong>de</strong>ring-Lab“ wäre ein geeigneter Rahmen, um die einzelnen<br />
315
Metho<strong>de</strong>n, aber auch die Gesamt-Vorgehensweise anhand aktuell zu gestalten<strong>de</strong>r<br />
Technologien zu überprüfen, zu verf<strong>einer</strong>n und zu ergänzen.<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring als „Design für lebbare Welten“<br />
Abschließend möchte ich <strong>de</strong>n in dieser Arbeit vorgelegten konzeptuellen Gesamt-<br />
Vorschlag – ungeachtet <strong>de</strong>r noch ausstehen<strong>de</strong>n empirisch-praktischen Überprüfung –<br />
an die anfangs vorgestellten theoretischen Überlegungen zurückbin<strong>de</strong>n und sie in <strong>de</strong>n<br />
Kontext aktueller Geschlechterforschungsansätze stellen. Um etwaigen Missverständnissen<br />
vorzubeugen, möchte ich betonen, dass sich das „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte“ auch in Bezug auf die generelle Intention, <strong>de</strong>r Vergeschlechtlichung <strong>informatischer</strong><br />
Artefakte entgegenzuwirken, nicht auf die im vorangegangen Kapitel dargestellten<br />
methodischen Konzepte beschränken und damit unabhängig von <strong>de</strong>m in Kapitel 3<br />
entwickelten theoretischen Verständnis <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
verstehen und nutzen lässt. Vielmehr erfor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Ansatz eine permanente Metho<strong>de</strong>nreflektion.<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring ist we<strong>de</strong>r eine absichtsvolle Einschreibung „positiver“<br />
Geschlechtsvorstellungen in Technologie noch ein Prozess <strong>de</strong>r Neutralisierung von<br />
Geschlecht. Vor allem aber sollte die Methodik nicht formalistisch als Rezeptur verstan<strong>de</strong>n<br />
wer<strong>de</strong>n, die – wird sie nur richtig angewen<strong>de</strong>t – automatisch zum gewünschten<br />
De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte führen wird.<br />
Zum einen können die vorgestellten Metho<strong>de</strong>n stets auch in <strong>einer</strong> hier nicht<br />
intendierten Weise eingesetzt wer<strong>de</strong>n. Metho<strong>de</strong>n „an sich“ können von verschie<strong>de</strong>nen<br />
Seiten vereinnahmt wer<strong>de</strong>n. So berichtete etwa die Softwaretechnikerin Fanny-Michaela<br />
Reisin bereits 1988, dass ein von ihr mitentwickeltes partizipatives Projektmo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r<br />
Softwaretechnik 394 , „in Entwicklungsprojekten zur Anwendung kommt, in <strong>de</strong>nen Ziele<br />
verfolgt wer<strong>de</strong>n, die unserem Anliegen [<strong>de</strong>r humanen Technikgestaltung, C.B.] entgegenstehen“<br />
(Reisin 1988, 114). Sie resümiert, dass es nicht möglich sei, sich vor einem<br />
solchen zweckentfrem<strong>de</strong>ten Einsatz zu schützen: „Ich bin mir darüber bewusst, dass<br />
wir uns nicht in einem herrschaftsfreien Raum bewegen. Die gesellschaftspolitisch<br />
entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Frage ist, welche Stellung wir hierin einnehmen, mit wem wir uns<br />
verbün<strong>de</strong>n und zu welchem Zweck wir Softwaresysteme entwickeln. Die Beschäftigung<br />
mit methodischen Ansätzen […] gibt darauf keine Antwort“ (ebd.).<br />
Zum Zweiten bietet das hier vorgeschlagene methodische Vorgehen zwar ein<br />
schrittweises Arbeiten sowohl in seinem Rahmenansatz als auch in Bezug auf die<br />
einzelnen methodischen Konzepte. Jedoch bestimmen diese Schritte die Technologiegestaltung<br />
nicht vollständig, son<strong>de</strong>rn geben nur Richtungen vor. Es wäre auch falsch<br />
anzunehmen, die Ziele expliziter bestimmen zu können: Denn ausgehend von <strong>de</strong>m<br />
Konzept <strong>de</strong>r performativen Ko-Materialisierung von Technik und Geschlecht (vgl.<br />
Kapitel 3.8.) können die vorgeschlagenen Metho<strong>de</strong>n immer nur kleine Verschiebungen<br />
in <strong>de</strong>n Artefakten gegenüber <strong>de</strong>m <strong>de</strong>rzeit Bestehen<strong>de</strong>n, gegenüber <strong>de</strong>r vorliegen<strong>de</strong>n<br />
Vergeschlechtlichung erzielen. Das Produkt <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses ist<br />
wie<strong>de</strong>rum zwangläufig in <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Re-Signifikation von Geschlecht durch die<br />
GestalterInnen und die NutzerInnen <strong>de</strong>r Technologie eingebun<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Interpretationsrahmen<br />
nicht revolutioniert o<strong>de</strong>r gar komplett gesprengt wer<strong>de</strong>n kann. Vielmehr<br />
394 Die Re<strong>de</strong> ist von <strong>de</strong>m methodischen Ansatz STEPS (Softwaretechnik für Evolutionäre Partizipative<br />
Systementwicklung), <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n 1980er Jahren unter <strong>de</strong>r Leitung von Prof. Christiane Floyd an <strong>de</strong>r TU<br />
Berlin entwickelt wur<strong>de</strong>.<br />
316
wer<strong>de</strong>n die an <strong>de</strong>r Herstellung und Nutzung von Technologie Beteiligten die Kategorie<br />
Geschlecht stets auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r ihnen bisher verfügbaren Zeichen und Muster<br />
<strong>de</strong>uten, die zu<strong>de</strong>m in ihrer jeweiligen Zeit, Gesellschaft, Lebenswelt etc. verankert sind.<br />
Deshalb for<strong>de</strong>rt die hier vorgeschlagene Methodik dazu auf, eine <strong>de</strong>taillierte Analyse<br />
möglicher Vergeschlechtlichungen vorzunehmen und auf dieser Basis ein explizites<br />
Ziel <strong>de</strong>s De-Gen<strong>de</strong>ring-Prozesses festzulegen, das in <strong>de</strong>r Berücksichtigung von Differenz,<br />
<strong>de</strong>r Verwirklichung <strong>de</strong>s Gleichheitsanspruchs o<strong>de</strong>r <strong>einer</strong> De-Konstruktion von<br />
Geschlecht bestehen kann (vgl. Kapitel 5.1.). Im konkreten Fall bleibt Technologiegestaltung<br />
auf Basis <strong>de</strong>r vorgeschlagenen Methodik jedoch ein offener Prozess, <strong>de</strong>r<br />
Raum für Interpretationen und Ausgestaltung lässt, wenngleich diese auch nicht<br />
beliebig sind.<br />
Zum Dritten gibt „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte“ <strong>de</strong>r technischen<br />
Gestaltung eine prinzipielle Richtung vor. Generell wer<strong>de</strong>n „<strong>de</strong>-gen<strong>de</strong>red technologies“<br />
als normatives Ziel gesetzt. Eine solche für die Konstruktion von Technologie notwendige<br />
Setzung von Nicht-Geschlechternormen, ist jedoch – wie Butler betont – stets<br />
ambivalent, <strong>de</strong>nn Normativität hat eine doppelte Be<strong>de</strong>utung: „Einerseits verweist sie<br />
auf die Ziele und Bestrebungen, die uns leiten, die Prinzipien, nach <strong>de</strong>nen wir gezwungen<br />
sind, zu han<strong>de</strong>ln o<strong>de</strong>r miteinan<strong>de</strong>r zu sprechen, die gemeinsam geteilten Vorannahmen,<br />
von <strong>de</strong>nen wir Orientierung erhalten und die unseren Handlungen die Richtung<br />
weisen. An<strong>de</strong>rerseits verweist Normativität auf <strong>de</strong>n Prozess <strong>de</strong>r Normalisierung,<br />
die Art, wie bestimmte Normen, I<strong>de</strong>en und I<strong>de</strong>ale unser verkörpertes Leben im Griff<br />
haben, zwingen<strong>de</strong> Kriterien liefern für normale ‚Männer‘ und ‚Frauen‘. Und in diesem<br />
zweiten Sinne erkennen wir, dass Normen das sind, was das ‚intelligible‘ Leben,<br />
‚wirkliche‘ Männer und ,wirkliche’ Frauen beherrscht. Und dass unklar ist, ob wir noch<br />
leben o<strong>de</strong>r leben sollten, ob unser Leben wertvoll ist o<strong>de</strong>r wertvoll gemacht war<strong>de</strong>n<br />
kann, ob unser Gen<strong>de</strong>r wirklich ist o<strong>de</strong>r jemals als wirklich betrachtet wer<strong>de</strong>n kann,<br />
wenn wir uns diesen Normen wi<strong>de</strong>rsetzen. (Butler 2011 [2004], 227f).<br />
Wir können somit we<strong>de</strong>r ohne Geschlechternormen leben, noch können wir sie so<br />
akzeptieren, wie sie sind. Dieses Paradox spitzt sich zu, wenn es darum geht,<br />
Technologien zu gestalten, <strong>de</strong>nn die Konzeption und Konstruktion <strong>informatischer</strong> Artefakte<br />
ist nur auf <strong>de</strong>r Grundlage expliziter Setzungen möglich. Butler sucht einen<br />
Ausweg aus diesem Problem, in<strong>de</strong>m sie „lebenswerte Leben“ einfor<strong>de</strong>rt (Butler 2011<br />
[2004]). Mit Haraway, die eine Konstruktion „lebbarer bzw. bewohnbarer Welten“<br />
(livable worlds) (Haraway 1995g [1994], 137) anstrebt, ließe sich diese I<strong>de</strong>e auf eine<br />
Weise auf die Technologiegestaltung übertragen, in <strong>de</strong>r Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Technologiegestaltung<br />
als politisch begriffen wer<strong>de</strong>n. Das heißt, „lebbare bzw. bewohnbare<br />
Welten“ herzustellen und technisch zu unterstützen, die für alle Beteiligten „lebenswerte<br />
Leben“ ermöglichen. Was das jedoch im Einzelfall be<strong>de</strong>utet und welche Politik,<br />
Theorie und Methodik wir brauchen, um lebbare Leben und lebbare Welten theoretisch<br />
zu fassen und praktisch aufzubauen, ist letztlich ein vorerst offener politischer<br />
Aushandlungsprozess:<br />
„Es wird immer Meinungsverschie<strong>de</strong>nheiten darüber geben, was das be<strong>de</strong>utet, und<br />
diejenigen, die behaupten, wegen dieser Verpflichtung sei die Einigung auf eine<br />
einzige politische Linie notwendig, irren sich. Aber nur <strong>de</strong>shalb, weil zu leben be<strong>de</strong>utet,<br />
ein Leben politisch zu leben, im Verhältnis zur Macht, im Verhältnis zu an<strong>de</strong>ren, in <strong>de</strong>r<br />
Übernahme von Verantwortung für eine kollektive Zukunft. Doch Verantwortung für die<br />
317
Zukunft zu übernehmen heißt nicht, im Voraus zu wissen, welche Richtung sie nehmen<br />
wird, die Zukunft und insbeson<strong>de</strong>re die Zukunft mit an<strong>de</strong>ren und für an<strong>de</strong>re eine<br />
gewisse Offeneheit und Unwissenheit verlangt.“ (Butler 2011 [2004], 358)<br />
In diesem Sinne bezieht „De-Gen<strong>de</strong>ring <strong>informatischer</strong> Artefakte“ bewusst keine<br />
Position in <strong>de</strong>r Frage, welche konkrete geschlechterpolitische Strategie bei <strong>de</strong>r<br />
Technologiegestaltung in <strong>de</strong>r Informatik zu verfolgen sei, und plädiert statt<strong>de</strong>ssen für<br />
ein problemorientiertes, situiertes Vorgehen: Im Fall drohen<strong>de</strong>n Ausschlusses bestimmter<br />
NutzerInnen tritt <strong>de</strong>r Ansatz für die Anerkennung von Differenzen ein. Läuft<br />
eine Technologie dagegen Gefahr, die strukturell-symbolische Geschlechterhierarchie<br />
zu reproduzieren, so for<strong>de</strong>rt er Gleichheit zwischen Frauen und Männern ein. Besteht<br />
die Ten<strong>de</strong>nz geschlechternormativer Wirkungen von Technologien, setzt sich De-Gen<strong>de</strong>ring<br />
<strong>informatischer</strong> Artefakte für eine Dekonstruktion von Geschlecht in und durch<br />
Technologien ein. Die größte Herausfor<strong>de</strong>rung besteht jedoch darin, das Potential <strong>de</strong>s<br />
theoretischen Zugangs dieser Arbeit, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r Konzepte „posthumanistischer<br />
Performativität“ (Barad) und „Rahmenerweitung“ (Suchman) auszuschöpfen, um in <strong>de</strong>r<br />
Technologiegestaltung und <strong>de</strong>n Grundlagen <strong>de</strong>r Informatik feministisch-<strong>kritisch</strong> zu<br />
intervenieren. Dazu sind nicht nur weitergehen<strong>de</strong> Metho<strong>de</strong>n notwendig, son<strong>de</strong>rn eine<br />
radikal interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen GeschlechterforscherInnen,<br />
TechnikforscherInnen und InformatikerInnen, welche die Grenzen zwischen <strong>de</strong>n<br />
Fächern unterminiert bzw. überschreitet.<br />
318
Literatur<br />
Aanestadt, Margunn (2003): The Camera as an Actor: Design-in-Use of Telemedicine<br />
Infrastructure on Surgery. In: Computer Supported Cooperative Work 12, 1-20<br />
Adam, Alison (1995): Embodying Knowledge. A Feminist Critique of Artificial<br />
Intelligence. In: The European Journal of Women’s Studies 2, 355-377<br />
Adam, Alison (1997): What should we do with cyberfeminism? In: Lan<strong>de</strong>r, Rachel/<br />
Adam, Alison (Eds.): Women in Computing. Exeter, UK: Intellect, 17-27<br />
Adam, Alison (1998): Artificial Knowing. Gen<strong>de</strong>r and the Thinking Machine. London<br />
u.a.: Routledge<br />
Adam, Alison (2000): Information Systems. We still need a feminist approach. In:<br />
Balka, Ellen/ Smith, Richard (Eds.): Women, Work and Computerization. Boston/<br />
Dordrecht/ London: Kluwer, 102-110<br />
Agosto, Denise E. (2004): Girls and gaming: a summary of the research with<br />
implications for practice. In: Teacher Librarian 31/3, 8-14, zitiert nach<br />
http://www.teacherlibrarian.com/tlmag/v_31/v_31_3_feature.html (letzter Zugriff<br />
am 25.2.2009)<br />
Agre, Philip (1997a): Computation and Human Experience. Cambridge: Cambridge<br />
University Press<br />
Agre, Philip (1997b): Toward a Critical Technical Practice: Lessons Learned in Trying<br />
to Reform AI. In: Bowker, Geoffrey/ Gasser, Les/ Star, Susan Leigh/ Turner, Bill<br />
(Eds.): Bridging the Great Divi<strong>de</strong>: Social Science, Technical Systems, and<br />
Cooperative Work. New Haven: Erlbaum, 131-157<br />
Agre, Philip/ Chapman, David (1987): Pengi: An Implementation of a Theory of Activity.<br />
Proceedings of the Sixth National Conference on Artificial Intelligence, Seattle,<br />
196-201<br />
Agre, Philip/ Chapman, David (1990): What are Plans for? In: Maes, Pattie (Ed.):<br />
Designing Autonomous Agents: Theory and Practice from Biology to Engineering<br />
and Back. Cambridge, Ma.: MIT Press, 17-34<br />
Ahmed, Sara (2004): The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University<br />
Press<br />
Akrich, Ma<strong>de</strong>leine (1992): The De-Scription of Technical Objects. In: Bijker, Wiebe/<br />
Law, John (Eds.): Shaping Technology/ Building Society. Studies in<br />
Sociotechnical Change. Cambridge, Mass.: MIT Press, 205-224<br />
Akrich, Ma<strong>de</strong>leine (1995): User Representations: Practices, Methods and Sociology. In:<br />
Rip, Arie/ Misa, Thomas/ Schot, Johan (Eds.): Managing Technology in Society.<br />
London/ New York: Pinter, 167-184<br />
Akrich, Ma<strong>de</strong>leine/ Latour, Bruno (1992): A summary of a Convenient Vocabulary for<br />
the Semiotics of Human and Nonhuman Assemblies. In: Bijker, Wiebe/ Law,<br />
John (Eds.): Shaping Technology/ Building Society. Cambridge, Mass.: MIT<br />
Press, 259-264<br />
319
Albrechtslund, An<strong>de</strong>rs (2007): Ethics and technology <strong>de</strong>sign. In: Ethics and Information<br />
Technology 9, 63-72<br />
Alcoff Linda/ Potter, Elisabeth (1993): Feminist Epistemologies. New York/ London:<br />
Routledge<br />
Allhutter, Doris/ Hanappi-Egger, E<strong>de</strong>ltraud (2006): The Hid<strong>de</strong>n Social Dimensions of<br />
Technologically Centered Quality Standards. Triple-Loop Learning as Process<br />
Centered Quality Approach. In: Dawson, Ray/ Georgiadou, Elli/ Linecar, Peter/<br />
Roos, Margaret/ Staples, Geoff (Eds.): Perspectives in Software Quality. The<br />
British Computer Society, 179-195<br />
Allhutter, Doris/ Hanappi-Egger, E<strong>de</strong>ltraud/ John, Sara (2008): Mind Scripting: Zur<br />
Sichtbarmachung von impliziten Geschlechtereinschreibungen in<br />
technologischen Entwicklungsprozessen. In: Schwarze, Barbara/ David,<br />
Michaela/ Belker, Bettina Charlotte (Hg.): Gen<strong>de</strong>r und Diversity in <strong>de</strong>n<br />
Ingenieurwissenschaften und <strong>de</strong>r Informatik. Bielefeld: Webler, 153-165<br />
Allmendinger, Jutta/ Fuchs, Stefan / Stebut, Janina von (1998): Berufliche Wer<strong>de</strong>gänge<br />
von Wissenschaftlerinnen in <strong>de</strong>r Max-Planck-Gesellschaft. Abschlußbericht an<br />
die Hans-Böckler-Stiftung, Projekt Nr. 96-868-4, Institut für Soziologie, Ludwig-<br />
Maximilians-Universität, München<br />
Archibald, Jaqueline/ Emms, Judy/ Grundy, Frances/ Payne, Janet/ Turner, Eva (Eds.)<br />
(2005): The Gen<strong>de</strong>r Politics of ICT. Proceedings of 6th International Women into<br />
Computing Conference 2005. Middlesex: Middlesex University Press<br />
Ardito, Carmelo/ Costabile, Maria Francesca/ Lanzilotti, Rosa (2006): Gen<strong>de</strong>r and<br />
Virtual Navigation: an Exploratory Study. In: Online Proceedings of the Workshop<br />
“Gen<strong>de</strong>r and Interaction. Real and Virtual women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006.<br />
(23-26 May, 2006 - Venice, Italy), zitiert nach<br />
http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/gen<strong>de</strong>r/papers.htm (letzter<br />
Zugriff am 24.2.2009)<br />
Asaro, Peter (2000): Transforming Society by Transforming Technology: The Science<br />
and Politics of Participatory Design. In: Accounting Management and Information<br />
Technologies 10, 257-290<br />
Austin, John (1961). How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press (dt. Zur<br />
Theorie <strong>de</strong>r Sprechakte. Stuttgart 1972)<br />
Balka, Ellen/ Smith, Richard (Eds.) (2002): Women, Work, and Computerization.<br />
Charting a Course to the Future. Boston/ Dordrecht/ London: Kluwer<br />
Barad, Karen (1996a): Agential Realism: Feminist Interventions in Un<strong>de</strong>rstanding<br />
Scientific Practices. In: Biaglioli, Mario (Ed.): The Science Studies Rea<strong>de</strong>r. New<br />
York: Routledge, 1-11<br />
Barad, Karen (1996b): Meeting the Universe Halfway. Realism and Social<br />
Constructivism without Contradiction. In: Nelson, Lynn Hankinson/ Nelson, Jack<br />
(Eds.): Feminism, Science, and the Philosophy of Science. Dordrecht, Holland:<br />
Kluwer, 161-194<br />
320
Barad, Karen (1998): Getting Real: Technoscientic Practices and the Materialization of<br />
Reality. In: Differences. Journal of Feminist Cultural Studies 10/2, 87-128<br />
Barad, Karen (2003): Posthumanist Performativity. Towards an un<strong>de</strong>rstanding of how<br />
matter comes to matter. In: Signs: Journal of Women in Culture and Society 28,<br />
801-831<br />
Barad, Karen (2007): Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the<br />
Entanglement of Matter and Meaning. Durham/ London: Duke University Press<br />
Bath, Corinna (1996): Nicht gleich - nicht an<strong>de</strong>rs. Wie läßt sich Geschlecht als soziales<br />
Klassifikationsmerkmal verän<strong>de</strong>rn? In: Koryphäe - Medium für feministische<br />
Naturwissenschaft und Technik 19, 5-9<br />
Bath, Corinna (2000): "The Virus Might Infect You" - Bewegt sich das Geschlechter-<br />
Technik-Gefüge? In: metis, Zeitschrift für historische Frauenforschung und<br />
feministische Praxis 9/17, 48-66<br />
Bath, Corinna (2001a): Was können uns Turing-Tests von Avataren sagen?<br />
Performative Aspekte virtueller Verkörperungen im Zeitalter <strong>de</strong>r Technoscience.<br />
In: Epp, Astrid/ Taubert, Niels C./ Westermann, Andrea (Hg.): Technik und<br />
I<strong>de</strong>ntität. Universität Bielefeld: IWT-Paper 26, 79-99<br />
Bath, Corinna (2001b):Für die Geschlechterforschung und -lehre in <strong>de</strong>r Informatik<br />
Sorge tragen wie Coyote? Über die Schwierigkeit, in <strong>einer</strong> Doppelstruktur<br />
zwischen Informatik und feministischen Studien zu arbeiten. In: Frauenarbeit und<br />
Informatik 23, 56-61<br />
Bath, Corinna (2002a): Gen<strong>de</strong>rforschung in <strong>de</strong>r Informatik: 10 Jahre zurück - 10 Jahre<br />
voraus? In: FIfF-Kommunikation 3, 41-46<br />
Bath, Corinna (2002b): Wie lässt sich feministische Natur- und<br />
Technikwissenschaftsforschung vermitteln? Zur Analyse <strong>de</strong>r Nachkommen von<br />
Lara Croft und Eliza. In: Alles unter einem Hut. Dokumentation <strong>de</strong>s 28.<br />
Kongresses von Frauen in Naturwissenschaft und Technik in Kassel, 302-308<br />
Bath, Corinna (2002c). Umkämpftes Territorium: Wird im Internet Geschlecht subversiv<br />
zersetzt o<strong>de</strong>r zementiert sich hier die Differenz? In: Gen<strong>de</strong>rzine <strong>de</strong>r Hochschule<br />
<strong>de</strong>r Künste Berlin<br />
Bath, Corinna (2003): Einschreibung von Geschlecht: Wie lassen sich Technologien<br />
feministisch gestalten? In: Weber, Jutta/ Bath, Corinna (Hg.): Turbulente Körper,<br />
soziale Maschinen. Feministische Studien zur Technowissenschaftskultur.<br />
Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 75-95<br />
Bath, Corinna (2005a): Wie wird die Grenze zwischen Technischem und Sozialem in<br />
<strong>de</strong>r Informatik verhan<strong>de</strong>lt? In: Gezeitenwechsel. Dokumentation <strong>de</strong>s 31.<br />
Kongresses von Frauen in Naturwissenschaft und Technik in Bremen.<br />
Ol<strong>de</strong>nburg, 62-68<br />
Bath, Corinna (2005b): Dazwischen, quer und „immer mittendrin“. Für eine<br />
feministische Gestaltung von Informationstechnologien. In: [sic!]. Zeitschrift für<br />
feministische Gangarten, 22-24<br />
321
Bath, Corinna (2006a): Sozialität mit Menschen und Maschinen. Ein Vergleich von<br />
Sozialitätskonzepten in <strong>de</strong>r Softwareagentenforschung und Robotik. In: dies./<br />
Weber, Jutta: Sozialität mit Maschinen. Anthropomorphisierung und<br />
Vergeschlechtlichung in aktueller Agenten- und Robotikforschung.<br />
Abschlussbericht <strong>de</strong>s 2004-2006 vom Österreichischen Minsterium für Bildung,<br />
Wissenschaft und Kultur geför<strong>de</strong>rten Forschungsprojekts, 133-166<br />
Bath, Corinna (2006b): Wie virtuelle Menschen sozial wer<strong>de</strong>n: Technische Mo<strong>de</strong>lle und<br />
feministische Eingriffe. In: Dokumentation <strong>de</strong>s 32. Kongresses von Frauen in<br />
Naturwissenschaft und Technik in Köln, 123-132, zitiert nach<br />
http://www.finut2006.<strong>de</strong>/Dokumentation_FiNuT_2006.pdf (letzter Zugriff am<br />
25.2.2009)<br />
Bath, Corinna (2006c): Overcoming the socio-technical divi<strong>de</strong>. A long-term hope in<br />
gen<strong>de</strong>r studies of computer science. In: TripleC – Cognition, Communication, Cooperation<br />
4/2, 303-314<br />
Bath, Corinna (2007): „Discover Gen<strong>de</strong>r“ in Forschung und Technologieentwicklung?<br />
In: Soziale Technik, Zeitschrift für sozial- und umweltverträgliche<br />
Technikgestaltung 4, 3-5<br />
Bath, Corinna (2009) Künstliche Emotionen und ihre Gegenbewegungen. O<strong>de</strong>r:<br />
Inwieweit vermögen GestalterInnen von Technologien <strong>kritisch</strong>e Ansätze <strong>einer</strong><br />
Theorie <strong>de</strong>r Informatik hervorzubringen? In: International Journal of Sustainability<br />
Communication 5 (Special Issue zur „Theorie <strong>de</strong>r Informatik”), 15-38<br />
Bath, Corinna (2010): Emotionskonzepte in <strong>de</strong>r neueren Softwareagentenforschung.<br />
Von grundlegen<strong>de</strong>r Kritik zur feministischen Technologiegestaltung? In:<br />
Mechthild Koreuber (Hg.): Geschlechterforschung in Mathematik und Informatik.<br />
Nomos, 187-204<br />
Bath, Corinna/ Kissmann, Ulrike/ Saupe, Angelika/ Törpel, Bettina (2003): Das<br />
Technische ist politisch! In: Dokumentation <strong>de</strong>s 29. Kongresses von Frauen in<br />
Naturwissenschaft und Technik in Berlin, 51-65<br />
Bath, Corinna/ Bauer, Yvonne/ Bock von Wülfingen, Bettina/ Saupe, Angelika/ Weber,<br />
Jutta (2005): Materialität <strong>de</strong>nken. Positionen und Werkzeuge. In: Bath, Corinna/<br />
Bauer, Yvonne/ Bock, Bettina/ von Wülfingen/ Saupe, Angelika/ Weber, Jutta<br />
(Hg.): Materialität <strong>de</strong>nken. Studien zur technowissenschaftlichen Verkörperung.<br />
Bielefeld: transcript, 9-29<br />
Bath, Corinna/ Weber, Jutta (2006): Sozialität mit Maschinen. Anthropomorphisierung<br />
und Vergeschlechtlichung in aktueller Agenten- und Robotikforschung.<br />
Unveröffentlichter Abschlussbericht <strong>de</strong>s bm:bwk-geför<strong>de</strong>rten Forschungsprojekts.<br />
Wien<br />
Bath, Corinna/ Schelhowe, Heidi/ Wiesner, Heike (2008): Informatik.<br />
Geschlechteraspekte <strong>einer</strong> technischen Disziplin. In: Becker, Ruth/ Kortendiek,<br />
Beate (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, 2. Aufl.,Wiesba<strong>de</strong>n:<br />
VS-Verlag, 821-833<br />
322
Bauer, Robin/ Götschel, Helene (Hg.) (2006): Gen<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Naturwissenschaften. Ein<br />
Curriculum an <strong>de</strong>r Schnittstelle <strong>de</strong>r Wissenschaftskulturen. Talheim/ Mössingen:<br />
Talheimer<br />
Baylor, Amy L. (2004): Encouraging more positive engineering stereotypes with<br />
animated interface agents. Unpublished Manuscript (zitiert nach Khan/ Angeli<br />
2007)<br />
Becker, Barbara (2000): Cyborgs, Robots und „Transhumanisten – Anmerkungen über<br />
die Wi<strong>de</strong>rständigkeit eigener und frem<strong>de</strong>r Materialität. In: Becker, Barbara/<br />
Schnei<strong>de</strong>r, Irmela (Hg.) (2000): Was vom Körper übrig bleibt. Körperlichkeit –<br />
I<strong>de</strong>ntität – Medien. Frankfurt a.M.: Campus, 41-69<br />
Becker, Barbara/ Schnei<strong>de</strong>r, Irmela (Hg.) (2000): Was vom Körper übrig bleibt.<br />
Körperlichkeit – I<strong>de</strong>ntität – Medien. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Becker-Schmidt, Regina (1998): Trennung, Verknüpfung, Vermittlung: zum<br />
feministischen Umgang mit Dichotomien. In: Knapp, Gudrun-Axeli (Hg.):<br />
Kurskorrekturen. Feminismus zwischen Kritischer Theorie und Postmo<strong>de</strong>rne.<br />
Frankfurt a.M./ New York: Campus, 84-125<br />
Beckwith, Laura/ Burnett, Margaret (2004): Gen<strong>de</strong>r: an important factor in enc-user<br />
programming. In: Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages and<br />
Human-Centric Computing 2004, 107-112<br />
Beckwith, Laura/ Burnett, Margaret/ Wie<strong>de</strong>nbeck, Susan/ Grigoreanu, Valentina (2006):<br />
Gen<strong>de</strong>r HCI: Results to Date Regarding Issues in Problem-Solving Software. In:<br />
Online Proceedings of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and Interaction. Real and Virtual<br />
women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006 (23-26 May, 2006 - Venice, Italy), zitiert<br />
nach http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/gen<strong>de</strong>r/papers.htm<br />
(letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Behnke, Roswitha (1992): Ansätze zur Frauenforschung in <strong>de</strong>r Informatik. Diplomarbeit<br />
am Fachbereich Informatik <strong>de</strong>r Universität Dortmund<br />
Belenki, Mary F./ Clinchy, Blythe M./ Goldberger, Nancy R./ Tarule, Jill M. (1989<br />
[1986]): Das an<strong>de</strong>re Denken. Persönlichkeit, Moral und Intellekt <strong>de</strong>r Frau.<br />
Frankfurt/ New York: Campus. (im. Orig.: Women’s Ways of Knowing. New York:<br />
Basic Books)<br />
Bell, Genevieve/ Blythe, Mark/ Gaver, William/ Sengers, Phoebe/ Wright, Peter (2003):<br />
Designing culturally situated technologies for the home. Conference on Computer<br />
Human Interaction 2003 Workshop Ft. Lau<strong>de</strong>rdale, Florida, USA, 1062 - 1063<br />
Bell, Genevieve/ Blythe, Mark/ Sengers, Phoebe (2005): Making by Making Strange:<br />
Defamiliarization and the Design of Domestic Technologies. In: ACM<br />
Transactions on Computer-Human Interaction 12/2, 149-173<br />
Belt, Vicki/ Richardson, Ranald/ Webster, Juliet (2002): Women, social skill and<br />
interactive service work in telephone call centers. In: New Technology, Work and<br />
Employment 17/1, 20-34<br />
323
Benthien, Claudia von/ Fleig, Anne/ Kasten, Ingrid (Hg.) (2000): Emotionalität. Zur<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Gefühle. Köln/ Weimar: Böhlau<br />
Berg, Ann-Jorunn (1999 [1994]): A Gen<strong>de</strong>red Socio-technical Construction. The Smart<br />
House. In: Wajcman, Judy/ MacKenzie, Donald (Eds.): The Social Shaping of<br />
Technology, 2nd Ed., Buckingham, Phila<strong>de</strong>lphia:Open University Press, 301-313<br />
Berg, Ann-Jorunn/ Lie, Merete (1995): Feminism and Constructivism: Do Artifacts Have<br />
Gen<strong>de</strong>r? In: Science, Technology & Human Values 20, S. 332-351<br />
Beyer, Hugh/ Holtzblatt, Karen (1998): Contextual Design. Defining Customer-<br />
Centered Systems. San Francisco: Morgan Kauffmann<br />
Bijker, Wiebe E. (1995): Of Bicycles, Bakelites and Bulbs. Cambridge, Mass.: MIT<br />
Press<br />
Bijker, Wiebe E./ Hughes, Thomas/ Pinch, Trevor J. (Eds.) (1987): The Social<br />
Construction of Technological Systems. Cambridge, Mass.: MIT Press<br />
Bijker, Wiebe E./ Law, John (1992): Do Technologies have Trajectories? In: dies.<br />
(Eds.): Shaping Technology/ Building Society. Studies in Sociotechnical Change.<br />
Cambridge, Mass.: MIT Press, 17-19<br />
Bijker, Wiebe E./ Bijsterveld, Karin (2000): Women Walking through Plans. Technology,<br />
Democracy, and Gen<strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntity. In: Technology & Culture 41/3, 485-515<br />
Bijker, Wiebe E./ Pinch, Trevor J. (2002): SCOT Answers, Other Questions. A Reply to<br />
Nick Clayton. In: Technology & Culture 43, 361-368.<br />
Biocca, Frank (1997): The cyborg’s dilemma. Progressive embodiment in virtual<br />
environments. In: Journal of Computer-Mediated Communication 3/2, zitiert nach<br />
http://jcmc.indiana.edu/vol3/issue2/ (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Bjerknes, Gro/ Bratteteig, Tone (1987): Florence in Won<strong>de</strong>rland. Systems<br />
Development with Nurses. In: Bjerknes, Gro / Ehn, Pelle / Kyng, Pelle (Eds.):<br />
Computers and Democracy: A Scandinavian Challenge. Al<strong>de</strong>rshot, UK:. Avebury,<br />
279-311<br />
Bjerknes, Gro/ Bratteteig, Tone (1994): User Participation: A Strategy for Work Life<br />
Democracy? In: Trigg, Randall/ An<strong>de</strong>rson, Susan Irwin/ Dykstra-Erickson,<br />
Elizabeth (Eds.): Proceedings of the Participatory Design Conference (PDC ’94)<br />
Palo Alto, CA: CPSR, 3-12<br />
Bjerknes, Gro/ Bratteteig, Tone (1995): User Participation and Democracy. A<br />
Discussion of Scandinavian Research on Systems Development. In:<br />
Scandinavian Journal of Information Systems 7/1, 73-98<br />
Björkman, Christina (2005): Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying<br />
Translations: Feminist Technoscience Strategies in Computer Science.<br />
Dissertation. Karlskrona, Schwe<strong>de</strong>n: Blekinge Institute of Technology<br />
Björkman, Christina/ Trojer, Lena (2006): What Does It Mean to Know Computer<br />
Science? Perspectives from Gen<strong>de</strong>r Research. In: TripleC – Cognition,<br />
Communication, Co-operation 4/2, 316-327<br />
324
Bloor, David (1991 [1976]): Knowledge and Social Imaginary. London: Routledge<br />
Blythe, Mark/ Monk, Andrew/ Overbeeke, Kees/ Wright, Peter (2003): Funology. From<br />
Usability to Enjoyment. Dordrecht u.a.: Kluwer<br />
Boal, Augusto (1979 [1974]): Theater <strong>de</strong>r Unterdrückten, Übungen und Spiele für<br />
Schauspieler und Nicht-Schauspieler. Frankfurt: Suhrkamp<br />
Bødker, Susanne (1991): Through the Interface: A Human Activity Approach to User<br />
Interface Design. Hillsdale, NJ: Erlbaum<br />
Bødker, Susanne/ Ehn, Pelle/ Kyng, Morton/ Kammersgaard, John/ Sundblad, Yngve<br />
(1987): An UTOPIAN Experience. On <strong>de</strong>sign of powerful computer-based tools<br />
for skilled graphic workers. In: Bjerknes, Gro / Ehn, Pelle / Kyng, Pelle (Eds.):<br />
Computers and Democracy: A Scandinavian Challenge. Al<strong>de</strong>rshot: Avebury, 251-<br />
278<br />
Bødker, Susanne/ Greenbaum, Joan (1993): Design of Information Systems: Thing<br />
versus People. In: Green, Eileen/ Owen, Jenny/ Pain, Den (Eds.) (1993):<br />
Gen<strong>de</strong>red by Design? Information Technology and Office Systems. London:<br />
Taylor & Francis, 53-63<br />
Bødker, Susanne/ Grønbæk/ Kyng, Morton (1993): Cooperative Design. Techniques<br />
and Experiences from the Scandinavian Scene. In: Schuler, Douglas/ Namioka,<br />
Aki (Eds.) (1993): Participatory Design. Principles and Practices. Hillsdale, NJ:<br />
Lawrence Erlbaum, 157-175<br />
Bødker, Keld/ Kensing, Finn / Simonsen, Jesper (2004): Participatory IT Design:<br />
Designing for Business and Workplace Realities. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Böhme, Gernot (1992): Natürlich Natur. Über Natur im Zeitalter ihrer technischen<br />
Reproduzierbarkeit. Frankfurt a. M: Suhrkamp<br />
Boehner, Kirsten/ David, Shay/ Kaye, Joseph ‘Jofish’/ Sengers, Phoebe (2004): Critical<br />
Technical Practice as a Methodology for Values in Design. Workshop on quality,<br />
value(s) and choice: exploring wi<strong>de</strong>r implications of HCI practice, CHI '04, zitiert<br />
nach http://alumni.media.mit.edu/~jofish/writing/chi-05-values-workshopcemcom-submission.pdf<br />
(letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Bowers, John (1992): The Politics of Formalism. In: Lea, Martin (Ed.): Contexts of<br />
Computer Mediated Communication. New York u.a.: Harvester-Wheatsheaf, 232-<br />
261<br />
Bowker, Geoffrey/ Susan Leigh Star (2000): Sorting Things Out. Classification and its<br />
Consequences. Cambridge, Mass.: MIT Press<br />
Bran<strong>de</strong>s, Uta / Schiersmann, Christiane (1986): Frauen, Männer und Computer. Eine<br />
repräsentative Untersuchung von Frauen und Männern in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik<br />
Deutschland zum Thema Computer. Hamburg: Gruner + Jahr<br />
Bråten, Stein (1973): Mo<strong>de</strong>l Monopoly and Communication: Systems Theoretical Notes<br />
on Democratization. In: Acta Sociologica 16/2, 98-107<br />
325
Bratteteig, Tone (2003): Making Change. Dealing with relations between <strong>de</strong>sign and<br />
use. Dr. Philos. Dissertation. Department of Informatics, University of Oslo<br />
Bratteteig, Tone/ Verne, Guri (1997): Feminist or merely Critical? In: Search of Gen<strong>de</strong>r<br />
Perspectives in Informatics. Paper presented at the Workshop on "Gen<strong>de</strong>r,<br />
Technology and Politics in Transition?", January 17-19 1997, TMV Oslo, zitiert<br />
nach http://publications.nr.no/fem-or-crit.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Braun, Alexan<strong>de</strong>r (2003): Chatbots in <strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong>nkommunikation. Berlin u.a.: Springer<br />
Breazeal, Cynthia (2002): Designing sociable robots. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Bredies, Katharina/ Buchmüller, Sandra/ Joost, Gesche (2008): The Gen<strong>de</strong>r<br />
Perspective in Cultural Probes. In: Proceeding of the Tenth Conference on<br />
Participatory Design 2008, zitiert nach http://idisk.mac.com/barbaraandrews-<br />
Public?view=web (letzter Zugriff am 24.2.2009), 146-149<br />
Brehm, Michelle/ Fitting, Sylvia/ Glück, Judith (2004): Orientieren sich Frauen und<br />
Männer in <strong>einer</strong> virtuellen Umgebung an<strong>de</strong>rs? In: Quaiser-Pohl, Claudia/ Jordan,<br />
Kirsten (Hg.): Warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken – und Männer<br />
ihnen Recht geben. Über Schwächen, die gar keine sind. München: Beck, 135-<br />
148<br />
Brooks, Rodney (1991): Intelligence without representation. In: Artificial Intelligence 47,<br />
139-159<br />
Brooks, Rodney (2002): Menschmaschinen. Wie uns die Zukunftstechnologien neu<br />
erschaffen. Frankfurt/ New York: Campus (im Orig.: Flesh and Machines. New<br />
York: Pantheon Books)<br />
Bruckman, Amy (1992): I<strong>de</strong>ntity Workshop. Emergent Social and Psychological<br />
Phenomena in Textbased Virtual Reality, zitiert nach<br />
http://www.cc.gatech.edu/fac/Amy.Bruckman/papers/#IW (letzter Zugriff am<br />
25.2.2009)<br />
Bruckman, Amy (1993): Gen<strong>de</strong>r Swapping on the Internet, zitiert nach<br />
http://www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/WomensStudies/Computing/Articles+Re<br />
searchPapers/gen<strong>de</strong>r-swapping (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Brunner, Cornelia/ Bennett, Dorothy/ Honey, Margaret (1998): Girls Games and<br />
Technological Desire. In: Cassell, Justine/ Jenkins, Henry (Eds.): From Barbie to<br />
Mortal Combat: Further Reflections. Cambridge, Ma.: MIT Press, 72-88<br />
Bruns, Uta (1997): Kommunikative Kompetenz in <strong>de</strong>r Informatik und die curricularen<br />
Konsequenzen. In: Informatik-Spektrum 20, 101-107<br />
Bührer, Susanne (2006): Gen<strong>de</strong>rsensible Forschungsmetho<strong>de</strong>n. In: Bührer, Susanne/<br />
Schraudner, Martina (Hg.): Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r Forschung. Wie können<br />
Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt und bewertet wer<strong>de</strong>n?<br />
Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, 167-174<br />
Bührer, Susanne/ Schraudner, Martina (Hg.) (2006): Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r<br />
Forschung. Wie können Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt und<br />
326
ewertet wer<strong>de</strong>n? Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System- und<br />
Innovationsforschung<br />
Buhr, Regina/ Buchholz, Boris (1999): Mit QWERTY ins 21. Jahrhun<strong>de</strong>rt? – Die<br />
Tastatur im Spannungsfeld zwischen Technikherstellung, Anwendung und<br />
Geschlechterverhältnis. In: Ritter, Martina (Hg.): Bits and Bytes vom Apfel <strong>de</strong>r<br />
Erkenntnis. Frauen – Technik – Männer. Münster: Westfälisches Dampfboot<br />
Burmester, Michael (2007): Usability Engineering. In: Kompendium Informations<strong>de</strong>sign.<br />
Berlin/ Hei<strong>de</strong>lberg: Springer<br />
Bussmann, Hadumod/ Hof, Renate (2005): Genus. Gen<strong>de</strong>r Studies in <strong>de</strong>n Kultur- und<br />
Sozialwissenschaften. Ein Handbuch. Erweitere Neuauflage. Stuttgart: Kröner<br />
Verlag<br />
Butler, Judith (1991 [1990]): Das Unbehagen <strong>de</strong>r Geschlechter. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp (im Orig.: Gen<strong>de</strong>r trouble. Feminism and the subversion of i<strong>de</strong>ntity.<br />
New York: Routledge)<br />
Butler, Judith (1994): ‘Gen<strong>de</strong>r as Performance’. An interview by Peter Osborne and<br />
Lynne Segal. In: Radical Philosophy 67, 32-39<br />
Butler, Judith (1995 [1993]): Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen <strong>de</strong>s<br />
Geschlechts. Berlin: Berlin Verlag (im Orig.: Bodies that matter. New York:<br />
Routledge)<br />
Butler, Judith (1998 [1997]): Haß spricht. Zur Politik <strong>de</strong>s Performativen. Berlin: Berlin<br />
Verlag (im Orig.: Exitable Speech. A Politics of the Performative. New York:<br />
Routledge)<br />
Butler, Judith (2011 [2004]): Die Macht <strong>de</strong>r Geschlechternormen. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp (im Orig.: Undoing Gen<strong>de</strong>r. New York/ London: Routledge<br />
Callon, Michel (1986): Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of<br />
the Scallops and the Fisherman of St. Brieuc Bay. In: Law, John (Ed.): Power,<br />
Action, and Belief. A New Sociology of Knowledge? London: Routledge & Kegan<br />
Paul<br />
Callon, Michel/ Latour, Bruno (1992): Don’t throw the Baby Out with the Bath School! A<br />
Reply to Collins and Yearley. In: Pickering, Andrew (Ed.): Science as Practice<br />
and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 343-368<br />
Caro, Robert (1974): The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York. New<br />
York: Random House (zitiert nach Winner 1999 [1980])<br />
Carroll, John (2000): Making Use. Scenario-based Design of Human-Computer<br />
Interactions. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Carstensen, Tanja (2007): Die interpretative Herstellung <strong>de</strong>s Internet. Eine empirische<br />
Analyse technikbezogener Deutungsmuster am Beispiel gewerkschaftlicher<br />
Diskurse. Bielefeld: Kleine<br />
Carstensen, Tanja/ Winker, Gabriele (2005): A Tool but not a Medium - Practical Use<br />
of the Internet in the Women's Movement. In: Archibald, Judy/ Emms, Judy /<br />
327
Grundy, Francis / Payne, Janet / Turner, Eva (Hg.): The Gen<strong>de</strong>r Politics of ICT.<br />
Middlesex: Middlesex University Press, 149-162<br />
Cassell, Justine (1998): Storytelling as the Nexus of Change in the Relationship<br />
between Gen<strong>de</strong>r and Technology In: Cassell, Justine/ Jenkins, Henry (Eds.):<br />
From Barbie to Mortal Kombat: Gen<strong>de</strong>r and Computer Games. Cambridge, MA:<br />
MIT Press, 298-326<br />
Cassell, Justine (2003). Gen<strong>de</strong>rizing HCI. In: Jacko, Julie/ Sears, Andrew (Eds.): The<br />
Handbook of Human-Computer Interaction. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum,<br />
402-411<br />
Cassell, Justine/ Jenkins, Henry (1998): From Barbie to Mortal Combat: Further<br />
Reflections. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Cassell, Justine/ Sullivan, John/ Prevost, Scott/ Churchill, Elisabeth (2000): Embodied<br />
Conversational Agents. Cambridge, Massachusetts: MIT Press<br />
Chapman, David/ Agre, Philip (1987): Abstract Reasoning as Emergent from Concrete<br />
Activity. In: Georgeff, Michael/ Lansky, Amy (Eds.): Reasoning about Actions and<br />
Plans. Proceedings of the 1986 Workshop at Timberline, Oregon. Los Altos, Ca.:<br />
Morgan Kaufman Publ., 411-424<br />
Clayton, Nick (2002a): Rejoin<strong>de</strong>r. In: Technology and Culture 43, 369-370<br />
Clayton, Nick (2002b): SCOT: Does It Answer? In: Technology and Culture 43, 351-<br />
360<br />
Clement, Andrew (1991): Designing without Designers: More Hid<strong>de</strong>n Skill in Office<br />
Computerization. In: Eriksson, Inger V./ Kitchenham, Barbara A./ Tij<strong>de</strong>ns, Kea G.<br />
(Eds.): Women, Work and Computerization. Amsterdam: North Holland, 15-32<br />
Clement, Andrew (1993): Looking for the <strong>de</strong>signers: Transforming the ‘invisible’<br />
infrastructure of computerized office work. In: AI & Society 7, 323-344<br />
Cockburn, Cynthia (1988 [1986]): Die Herrschaftsmaschine. Berlin/ Hamburg:<br />
Argument (im Orig.: Machinery of Dominance. Women, Men, and Technological<br />
Know How. London: Pluto Press)<br />
Cockburn, Cynthia/ Ormrod, Susan (1993): Gen<strong>de</strong>r & Technology in the Making.<br />
London u.a.: Sage<br />
Cockburn, Cynthia/ Fürst-Dilic, Ruza (Eds.) (1994): Bringing Technology Home:<br />
Gen<strong>de</strong>r and Technology in Changing Europe. Milton Keynes, Bucks: Open<br />
University Press<br />
Colburn, Timothy (2004): Methodology of Computer Science. In: Floridi, Luciano (Ed.):<br />
The Blackwell Gui<strong>de</strong> to the Philosophy of Computing and Information. Maldon,<br />
Ma. u.a.: Blackwell, 318-326<br />
Collins, Harry/ Yearley, Steven (1992): Epistemological Chicken. In: Pickering, Andrew<br />
(Ed.): Science as Practice and Culture. Chicago: University of Chicago Press,<br />
301-326<br />
328
Connell, Robert W. (1987): Gen<strong>de</strong>r and Power: Society, the Person and Sexual<br />
Politics. Stanford: Stanford University Press<br />
Consalvo, Mia (2003): It's a Queer World After All: Studying The Sims and Sexuality.<br />
Forschungsbericht, zitiert nach http://www.glaad.org/documents/csms/<br />
The_Sims.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Cooper, Alan (1999): The Inmates are Running the Asylum. Indianapolis: Sams<br />
Cowan, Ruth Schwartz (1983): More Work for Mother: The Ironies of Household<br />
Technology from Open Heath to the Microwave. New York: Basic Books<br />
Coy, Wolfgang (1992): Informatik – Eine Disziplin im Umbruch. In: Coy, Wolfgang/<br />
Nake, Frie<strong>de</strong>r/ Pflüger, Jörg-Martin/ Rolf, Arno/ Seetzen, Jürgen/ Siefkes, Dirk/<br />
Stransfeld, Reinhard (Hg.): Sichtweisen <strong>de</strong>r Informatik. Braunschweig: Vieweg, 1-<br />
9<br />
Coy, Wolfgang (1995): Automat – Werkzeug – Medium. In: Informatikspektrum 18/1,<br />
31-38<br />
Coy, Wolfgang (2004): Was ist Informatik? Zur Entstehung eines Faches an <strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>utschen Universitäten. In: Hellige, Hans-Dieter (Hg.): Geschichten <strong>de</strong>r<br />
Informatik. Visionen, Paradigmen, Leitmotive. Berlin u.a.: Springer, 473-498<br />
Coy, Wolfgang/ Nake, Frie<strong>de</strong>r/ Pflüger, Jörg-Martin/ Rolf, Arno/ Seetzen, Jürgen/<br />
Siefkes, Dirk/ Stransfeld, Reinhard (Hg.) (1992): Sichtweisen <strong>de</strong>r Informatik.<br />
Braunschweig: Vieweg<br />
Coyne, Richard (1995): Designing Information Technology in the Postmo<strong>de</strong>rn Age.<br />
From Method to Metaphor. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Crutzen, Cecile (2000): Interactie, een wereld van verschillen. Een visie op informatica<br />
vanuit gen<strong>de</strong>r studies (Interaktion, eine Welt von Verschie<strong>de</strong>nheiten. Eine Sicht<br />
auf die Informatik aus <strong>de</strong>r Perspektive <strong>de</strong>r Frauenforschung). Dissertation, Open<br />
Universitteit Ne<strong>de</strong>rland, Heerlen (hier zitiert nach <strong>de</strong>r englischsprachigen<br />
summary)<br />
Crutzen, Cecile (2003): ICT-Representations as Transformative Critical Rooms. In:<br />
Kreutzner, Gabriele/ Schelhowe, Heidi (Hg.): Agents of Change. Opla<strong>de</strong>n: Leske<br />
+ Budrich, 87-106<br />
Crutzen, Cecile (2005): Intelligent Ambience between Heaven and Hell: A Salvation?<br />
In: Archibald, Judy/ Emms, Judy/ Grundy, Francis / Payne, Janet / Turner, Eva<br />
(Hg.): The Gen<strong>de</strong>r Politics of ICT. Middlesex: Middlesex University Press, 29-50<br />
Crutzen, Cecile (2007): Das Unsichtbare und das Sichtbare <strong>de</strong>s artifiziellen Han<strong>de</strong>lns<br />
im täglichen Leben. In: Kurswechsel. Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts-<br />
und umweltpolitische Alternativen 3, 35-46<br />
Crutzen, Cecile/ Vosseberg, Karin (1999): Die Interaktion zwischen objektorientiertem<br />
Denken und feministischer Kritik – eine dynamische Verbindung. In: Dreher,<br />
Björn/ Schulz, Christoph/ Weber-Wulff, Debora (Hg.): Software Engineering im<br />
Unterricht <strong>de</strong>r Hochschulen (SEUH ’99). Stuttgart/ Leipzig: Teubner, 149-165<br />
329
Crutzen, Cecile/ Gerissen, Jack (2000): Doubting the OBJECT world. In: Balka, Ellen/<br />
Smith, Richard (Eds.): Women, Work and Computerization. Boston/ Dordrecht/<br />
London: Kluwer, 127-136<br />
Crutzen, Cecile/ Vosseberg, Karin (2002): Objektorientiertes Denken – Metho<strong>de</strong>n<br />
erlernen unter einem <strong>kritisch</strong>en Blickwinkel. In: Verein FLuMiNuT (Hg.):<br />
Wissen_schaf(f)t Wi<strong>de</strong>rstand. Dokumentation <strong>de</strong>s 27. Kongresses von Frauen in<br />
Naturwissenschaft und Technik. Wien: Milena, 155-160<br />
Cussins, Charis (1998): Ontological Choreography: Agency for Women Patients in an<br />
infertility clinic. In: Berg, Marc/ Mol, Anne-Marie (Eds.): Differences in Medicine.<br />
Durham, NC: Duke University Press, 166-201<br />
Dahlbom, Bo/ Matthiasen, Lars (1993): Computers in Context. The Philosophy and<br />
Practice in Systems Design. Cambridge: Blackwell (zitiert nach Hammel 2003)<br />
Dalmiya, Vrinda/ Alcoff, Linda (1993): Are “Old Wives’ Tales” Justified? In: Alcoff,<br />
Linda/ Potter, Elizabeth (Eds.): Feminist Epistemologies. New York/ London:<br />
Routledge, 217-244<br />
Damasio, Antonio (1994): Decartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain.<br />
New York: Grosset/ Putnam<br />
Damasio, Antonio (2000): Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung <strong>de</strong>s<br />
Bewusstseins. Berlin: List<br />
De Angeli, Antonella/ Brahnam, Sheryl (2006): Sex stereotypes and conversational<br />
agents. In: Online Proceedings of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and Interaction. Real<br />
and Virtual women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006 (23-26 May, 2006 - Venice,<br />
Italy), zitiert nach http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/gen<strong>de</strong>r/<br />
papers.htm (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Degele, Nina (2002): Einführung in die Techniksoziologie. Stuttgart: UTB<br />
De Silva, Adrian (2005): Transsexualität im Spannungsfeld juristischer und<br />
medizinischer Diskurse. In: Zeitschrift für Sexualforschung 18, 258-271<br />
De Silva, Adrian (2007): Zur Konstruktion von Geschlecht und Geschlechterregimen in<br />
<strong>de</strong>m Gen<strong>de</strong>r Recognition Act 2004 und im englischen Parlament. In: Liminalis<br />
1/1, 83-108, zitiert nach www.liminalis.<strong>de</strong>/artikel/Liminalis2007_<strong>de</strong>silva.pdf<br />
(letzter Zugriff am 25.2.2006)<br />
Deuber-Mankowsky, Astrid (2000): Lara Croft - Mo<strong>de</strong>ll, Medium, Cyberheldin. Frankfurt<br />
a.M.: Suhrkamp<br />
Dickersin, Kay/ Min, Y.I. (1993): Publication bias: the problem that won’t go away. In:<br />
Annals New Aca<strong>de</strong>my of Science 703, 135-148<br />
Dijkstra, Edsgar (1989): On the Cruelty of Really Teaching Computing Science. In:<br />
Communications of the ACM 32/12, 1398-1404<br />
Dix, Alan/ Finlay, Janet/ Abowd, Gregory D./ Beale, Russell (1993): Human-Computer<br />
Interaction. New York: Prentice Hall<br />
330
Djajadiningrat, Johan Partomo/ Gaver, William/ Frens, Joep W. (2000): Interaction<br />
Relabelling and Extreme Characters: Methods for Exploring Aesthetic<br />
Interactions. In: Proceedings of DIS ’00. New York: ACM Press, 66-71<br />
Dourish, Paul (2001): Where the Action is: The Foundation of Embodied Interaction.<br />
Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Drau<strong>de</strong>, Clau<strong>de</strong> (2006): Degen<strong>de</strong>ring the species? Gen<strong>de</strong>r studies encounter virtual<br />
humans. In: Online Proceedings of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and Interaction. Real<br />
and Virtual women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006. (23-26 May, 2006 - Venice,<br />
Italy), zitiert nach http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/gen<strong>de</strong>r/<br />
papers.htm (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Dreyfus, Hubert (1972): What Computers Can’t Do. The Limits of Artificial Intelligence.<br />
New York: Harper and Row<br />
Dreyfus, Hubert (1992): What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason.<br />
Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Du<strong>de</strong>n, Barbara (1997): Der “Welcome-Körper”. In: Das Argument 221/39/4, 485-493<br />
Dunne, Anthony/ Raby, Fiora (2001): Design Noir. The Secret Life of Electronic<br />
Objects. Basel: Birkhäuser<br />
Edge, David (1995 [1988]): The Social Shaping of Technology. In: Heap, Nick (Ed.):<br />
Information Technology and Society. A Rea<strong>de</strong>r. London u.a.: Sage, 15-32 (zuerst<br />
veröffentlicht in Edinburgh PICT Working Paper Series)<br />
Ehn, Pelle/ Kyng, Morton (1987): The Collective Resource Approach to Systems<br />
Design. In: Bjerknes, Gro/ Ehn, Pelle/ Kyng, Pelle (Eds.): Computers and<br />
Democracy: A Scandinavian Challenge. Al<strong>de</strong>rshot: Avebury, 17-57<br />
Ehn, Pelle/ Mölleryd, Bengt / Sjögren, Dan (1990): Playing in Reality. A Paradigm<br />
Case. In: Scandinavian Journal of Information Systems 2, 101-120<br />
Ehn, Pelle/ Sjögren, Dan (1991): From Systems Descriptions to Scripts in Action. In:<br />
Greenbaum, Joan/ Kyng, Morton (Eds.): Design at Work. Cooperative Design of<br />
Computer Systems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 241-268<br />
Ehrenreich, Barbara/ English, Deirdre (1978): For her own good: 150 years of experts’<br />
advice to women. Gar<strong>de</strong>n City, N.Y.: Anchor Press<br />
Eisenrie<strong>de</strong>r, Veronika (2003): Von Enten, Vampiren und Marsmenschen - Von<br />
Männlein, Weiblein und <strong>de</strong>m "An<strong>de</strong>ren". Soziologische Annäherung an I<strong>de</strong>ntität,<br />
Geschlecht und Körper in <strong>de</strong>n Weiten <strong>de</strong>s Cyberspace. München: Utz<br />
Ekman, Paul (Ed.) (1982): Emotion in the Human Face. Cambridge: Cambridge<br />
University Press<br />
Ekman, Paul/ Friesen, W. (1977): Facial Action Coding System. Palo Alto/ California:<br />
Consulting Psychologist Press<br />
Elovaara, Pirjo (2007): Between Stability and Instability – Using ANT and ANTa as<br />
Analytical Perspectives Telling Information Technology Stories. In: International<br />
331
Journal of Feminist Technoscience, zitiert nach http://feministtechnoscience.se/<br />
journal, 18 Seiten (letzter Zugriff am 29.8.07)<br />
Engel, Antke (2002): Wi<strong>de</strong>r die Ein<strong>de</strong>utigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus<br />
queerer Politik <strong>de</strong>r Repräsentation. Frankfurt/ New York: Campus<br />
Engelbart, Douglas C. (1984): Authorship provisions in augment. Reprint of<br />
COMPCON ’84 Digest, Proceedings of the COMPCON Conference, San<br />
Francisco, 1-19 (zitiert nach Hofmann 1999)<br />
Erb, Ulrike (1996): Frauenperspektiven auf die Informatik. Informatikerinnen im<br />
Spannungsfeld zwischen Distanz und Nähe. Münster: Westfälisches Dampfboot<br />
Erlemann, Christiane (2000): Frauenför<strong>de</strong>rung in technischen Studiengängen: Von <strong>de</strong>r<br />
Phantom-Gleichheit zur Geschlechterkultur. In: Müller-Wichmann, Christiane<br />
(Hg.): Frauenför<strong>de</strong>rung in Ingenieurstudiengängen – ein Schlüsselbeitrag zur<br />
Studienreform. Dokumentation eines Symposiums an <strong>de</strong>r Technischen<br />
Fachhochschule Berlin. Berlin: Technische Fachhochschule Berlin<br />
Erlemann, Martina (2010): Nanotechnologien im “Dialog” – Akzeptanzbeschaffung o<strong>de</strong>r<br />
Basis <strong>einer</strong> partizipativen Technikgestaltung? In: Lucht, Petra/ Erlemann,<br />
Martina/ Ben, Esther Ruiz (Hg.): Technologisierung gesellschaftlicher Zukünfte.<br />
Nanotechnologien in wissenschaftlicher, politischer und öffentlicher Praxis.<br />
Herbholzheim: Centaurus-Verlag, 55-73<br />
Es<strong>de</strong>rs, Karin (2003): “You make me feel like a natural woman…” Von <strong>de</strong>r (Un-)<br />
Wirklichkeit digitaler Körperbil<strong>de</strong>r. In: Weber, Jutta/ Bath, Corinna (Hg.):<br />
Turbulente Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur<br />
Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske+Budrich, 183-199<br />
Esposito, Elena (2003): Fiktion und Virtualität. In: Krämer, Sybille (Hg.): Medien -<br />
Computer - Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue Medien. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp, 269–296<br />
Faulkner, Wendy (2000a): Dualisms, hierarchies and Gen<strong>de</strong>r in Engineering. In: Social<br />
Studies of Science 30/5, 759-792<br />
Faulkner, Wendy (2000b): The power and the pleasure? A research agenda for<br />
“making gen<strong>de</strong>r stick” to engineers. In: Science, Technology and Human Values<br />
25/1, 87-119<br />
Faulkner, Wendy (2001): The technology question in feminism: A view from feminist<br />
technology studies. In: Women’s Studies International Forum 24/1, 79-95<br />
Faulkner, Wendy (2004): Strategies of Inclusion. Gen<strong>de</strong>r and the Information Society.<br />
Final Report. Edinburgh: University of Edinburgh<br />
Faulkner, Wendy (2007): ‘Nuts and Bolts and People’. Gen<strong>de</strong>r-Troubled Engineering<br />
I<strong>de</strong>ntities. In: Social Studies of Science 37/3, 331-356<br />
Faulkner, Wendy/ Lie, Merete (2007): Gen<strong>de</strong>r and the Information Society. Strategies<br />
of Inclusion. In: Gen<strong>de</strong>r, Technology and Development 11/2, 157-177<br />
332
Fausto-Sterling, Anne (1992): Building Two-Way Streets. The Case of Feminism and<br />
Science. In: National Women’s Studies Association Journal 4/3, 336-349<br />
Featherstone, Mike/ Burrows, Roger (Hg.) (1995): Cyberspace / Cyberbodies /<br />
Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment. London: Sage Publications<br />
Feldberg, Roslyn (1993): „Doing it the hard way“ Computergestützte Pflegeplanung in<br />
amerikanischen Krankenhäusern. In: Wagner, Ina (Hg.): Kooperative Medien.<br />
Informationstechnische Gestaltung mo<strong>de</strong>rner Organisationen. Frankfurt a.M.:<br />
Campus, 111-133<br />
Felt, Ulrike/ Novotny, Helga/ Taschwer, Klaus (1995): Wissenschaftsforschung. Eine<br />
Einführung. Frankfurt/ New York: Campus<br />
Flam, Helena (2002): Soziologie <strong>de</strong>r Emotionen. Eine Einführung. Konstanz: UVK<br />
Flanagan, Mary (2002): Hyperbodies, hyperknowledge: women in games, women in<br />
cyberpunk, and strategies of resistance. In: Flanagan, Mary/ Booth, Austin (Eds.):<br />
RELOAD: rethinking women + cyberculture. Cambridge, Massachusetts: MIT<br />
Press, 425-454<br />
Flanagan, Mary/ Nissenbaum, Helen/ Diamond, Jim/ Belman, Jonathan (2007): A<br />
Method for Discovering Values in Digital Games. Full paper presented at Situated<br />
Play DiGRA ’07 (Tokyo, JP September 24-28, 2007), zitiert nach<br />
http://valuesatplay.org/?page_id=8 (letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Flanagan, Mary/ Howe, Daniel/ Nissenbaum, Helen (2008): Values in Design: Theory<br />
and Practice. In: van <strong>de</strong>n Hoven, Jeroen/ Weckert, John (Eds.): Information<br />
Technology and Moral Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press,<br />
zitiert nach: http://valuesatplay.org/?page_id=8 (letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Flax, Jane (1990): Thinking in Fragments. Psychoanalyses, Feminism and<br />
Postmo<strong>de</strong>rnism in the Contemporary West. Berkeley: University of California<br />
Press (zitiert nach Gerissen/ Crutzen 2000)<br />
Flood, Robert/ Romm, Norma (1996): Diversity Management. Triple-Loop Learning.<br />
Chichester: Wiley (zitiert nach Allhutter/ Hanappi-Egger 2008)<br />
Flores, Fernando/ Graves, Michael/ Hartfield, Brad/ Winograd, Terry (1988): Computer<br />
systems and the <strong>de</strong>sign of organizational interaction. In: ACM Transactions on<br />
Information Systems 6/2, 153-172<br />
Floyd, Christiane/ Mehl, Wolf-Michael/ Reisin, Fanny-Michaela/ Schmidt, Gerhard/<br />
Wolf, Gregor (1987): SCANORAMA. Werkstattbericht Nr. 30 <strong>de</strong>r Reihe “Mensch<br />
und Technik. Sozialverträgliche Technikgestaltung“ <strong>de</strong>s Ministeriums für Arbeit,<br />
Gesundheit und Soziales <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Nordrhein-Westfalen. Ahaus, Germany<br />
Floyd, Christiane/ Reisin, Fanny-Michaela/ Schmidt, Gerhard (1989): STEPS to<br />
Software Development with Users. In: Ghezzi, Carlo/ McDermid, John A. (Eds.):<br />
European Software Engineering Conference 1989. Berlin: Springer, 48-64<br />
Floyd, Christiane/ Züllighoven, Heinz/ Bud<strong>de</strong>, Reinhard (Eds.) (1992): Software<br />
<strong>de</strong>velopment and reality construction. Berlin: Springer<br />
333
Floyd, Christiane/ Krabbel, Anita/ Ratuski, Sabine/ Wetzel, Ingrid (1997): Zur Evolution<br />
<strong>de</strong>r evolutionären Systementwicklung: Erfahrungen aus einem<br />
Krankenhausprojekt. In: Informatik-Spektrum 20, 13-2<br />
Forsythe, Diana (1993a): Engineering Knowledge. The Construction of Knowledge in<br />
Artificial Intelligence. In: Social Studies of Science 23/3, 445-477<br />
Forsythe, Diana (1993b): The Construction of Work in Artificial Intelligence. In: Science,<br />
Technology & Human Values 18/4, 460-479<br />
Frauenarbeit und Informatik (Hg.) (2006): Rundbrief Nr. 31, Oktober 2006<br />
Frey Steffen, Therese (2006): Gen<strong>de</strong>r. Leipzig: Reclam<br />
Freyer, Catrin (1993): Alles nur Bluff? Programmieren als Bestandteil <strong>de</strong>r Fachkultur in<br />
<strong>de</strong>r Informatik. In: Funken, Christiane/ Schinzel, Britta: Frauen in Mathematik und<br />
Informatik. Tagungsbericht. Wa<strong>de</strong>rn: Schloss Dagstuhl, 60-64<br />
Friedman, Batya/ Nissenbaum, Helen (1996): Bias in Computer Systems. In: ACM<br />
Transactions on Information Systems 14/3, 330-347<br />
Friedman, Batya/ Kahn, Peter/ Borning, Alan (2002): Value Sensitive Design: Theory<br />
and Methods. Technical Report 02-10-01, Dept. of Computer Science and<br />
Engineering, University of Washington, December 2002<br />
Friedman, Batya/ Kahn, Peter (2003): Human Values, Ethics, and Design. In: Jacko,<br />
Julie A./ Sears, Andrew (Eds.): The human-computer interaction handbook:<br />
Fundamentals, evolving technologies and emerging applications. Mahwah, NJ:<br />
Lawrence Erbaum Associates, 1177-1199<br />
Friedman, Batya/ Kahn, Peter/ Borning, Alan (2006): Value Sensitive Design and<br />
Information Systems. In: Zhang, Ping/ Galletta, Dennis (Eds.): Human-Computer<br />
Interaction in Management Information Systems. Foundations. New York: Sharp,<br />
348-372<br />
Friedrich, Jürgen/ Herrmann, Thomas/ Peschek, Martin/ Rolf, Arno (Hg.) (1995):<br />
Informatik und Gesellschaft. Hei<strong>de</strong>lberg/ Berlin/ Oxford: Spektrum, Aka<strong>de</strong>mischer<br />
Verlag<br />
Frougny, Christiane/ Peiffer, Jeanne (1985): Der mathematische Formalismus – eine<br />
Maschine, die Wahres ausson<strong>de</strong>rt. In: Feministische Studien 1, 61-77<br />
Fuchs, Christian/ Hofkirchner, Wolfgang (2003): Studienbuch Informatik und<br />
Gesellschaft. Nor<strong>de</strong>rstedt: Books on Demand GmbH<br />
Funken, Christiane (1998): Neue Berufspotentiale für Frauen in <strong>de</strong>r Software-<br />
Entwicklung. In: Oechtering, Veronika/ Winker, Gabriele (Hg.): Computernetze –<br />
Frauenplätze. Frauen in <strong>de</strong>r Informationsgesellschaft. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich,<br />
57-66<br />
Funken, Christiane (1999): Mustererkennung - Zur (Re)Codierung von<br />
Geschlechtszugehörigkeit im Internet. In: Freiburger FrauenStudien 1, 91-106<br />
334
Funken, Christiane (2000): Körpertext o<strong>de</strong>r Textkörper. In: Becker, Barbara/ Schnei<strong>de</strong>r,<br />
Irmela (Hg.): Was vom Körper übrig bleibt. Medialität - Körperlichkeit - I<strong>de</strong>ntität.<br />
Frankfurt a.M.: Campus, 103-129<br />
Funken, Christiane/ Schinzel, Britta (1993): Frauen in Mathematik und Informatik.<br />
Tagungsbericht. Wa<strong>de</strong>rn: Schloss Dagstuhl<br />
Gatens, Moira (1991): Feminism and Philosophy. Perspectives on Difference and<br />
Equality. Cambridge: Polity<br />
Gaver, Bill/ Dunne, Tony (1999): Projected Realities: Conceptual Design for Cultural<br />
Effect. In: Proceedings of the CHI 1999<br />
Gaver, Bill/ Dunne, Tony / Pacenti, Elena (1999): Cultural Probes. In: Interactions 1/2,<br />
21-29<br />
Gaver, William/ Beaver, Jake/ Benford, Steve (2003): Ambiguity as a Resource for<br />
Design. In: Proceedings of the CHI 2003, 233-240<br />
Gaver, William/ Boucher, Andrew/ Pennington, Sarah/ Walker, Brendan (2004):<br />
Cultural Probes and the Value of Uncertainty. In: Interactions 9/10, 53-56<br />
Geertz, Clifford (1983 [1973]): Dichte Beschreibung: Beiträge zum Verstehen kultureller<br />
Systeme. Frankfurt a.M.: Suhrkamp (amerikanisches Original 1973)<br />
Gerson, Elihu/ Star, Susan Leigh (1986): Analyzing due process in the workplace. In:<br />
ACM Transactions on Office Information Systems 4, 257-270<br />
Gesellschaft für Informatik (2008): Jahresberícht 2008, zitiert nach www.giev.<strong>de</strong>/fileadmin/redaktion/Download/jahresbericht2008.pdf<br />
(letzter Zugriff am<br />
22.1.2009)<br />
Gil<strong>de</strong>meister, Regine/ Wetterer, Angelika (1992): Wie Geschlechter gemacht wer<strong>de</strong>n.<br />
Die soziale Konstruktion <strong>de</strong>r Zweigeschlechtlichkeit und ihre Reifizierung in <strong>de</strong>r<br />
Frauenforschung. In: Knapp, Gudrun-Axeli/ Wetterer, Angelika (Hg.): Traditionen<br />
Brüche. Entwicklungen feministischer Theorie. Freiburg i. Br.: Kore, 201-254<br />
Gill, Rosalind/ Grint, Keith (1995): The Gen<strong>de</strong>r-Technology Relation. Contemporary<br />
Theory and Research. Introduction. London/ Bristol: Taylor & Francis, 1-28<br />
Glos, Jennifer/ Cassell, Justine (1997): Rosebud: Technological Toys for Storytelling.<br />
Paper presented at the CHI ’97, Atlanta, GA, zitiert nach<br />
http://www.sigchi.org/chi97/proceedings/short-talk/jwg.htm (letzter Zugriff am<br />
24.2.2009)<br />
Go, Kentaro/ Carroll, John M. (2004): The Blind Man and the Elephant: Views of<br />
Scenario-Based System Desgin. In: Interactions 11/12, 46-53<br />
Götschel, Helene (2002): Naturwissenschaftlerinnen und Technikerinnen in Bewegung.<br />
Zur Geschichte <strong>de</strong>s Kongresses Frauen in Naturwissenschaft und Technik 1977<br />
bis 1989. Mössingen-Talheim: Talheimer<br />
Gould, John/ Lewis Clayton (1985): Designing for Usability: Key Principles and what<br />
<strong>de</strong>signers think. In: Communications of the ACM 28/3, 300-311<br />
335
Graner Ray, Sheri (2004): Gen<strong>de</strong>r Inclusive Game Design: Expanding the Market.<br />
Hingham, Ma.: Charles River Media Inc.<br />
Gransee, Carmen (1998): Grenz-Bestimmungen. Erkenntnis<strong>kritisch</strong>e Anmerkungen<br />
zum Naturbegriff bei Donna Haraway. In: Knapp, Gudrun-Axeli (Hg.):<br />
Kurskorrekturen. Feminismus zwischen Kritischer Theorie und Postmo<strong>de</strong>rne.<br />
Frankfurt a.M./ New York: Campus, 126-152<br />
Gransee, Carmen (1999): Grenzbestimmungen. Zum Problem i<strong>de</strong>ntitätslogischer<br />
Konstruktionen von „Natur“ und „Geschlecht“. Tübingen: Edition Diskord<br />
Green, Eileen/ Owen, Jenny/ Pain, Den (1991): Developing Computerized Office<br />
Systems. In: Inger V. Eriksson; Barbara A. Kitchenham; Kea G. Tij<strong>de</strong>ns (Eds.):<br />
Women, Work and Computerization. Amsterdam: North-Holland 217-231<br />
Green, Eileen/Owen, Jenny/ Pain, Den (Eds) (1993a): Gen<strong>de</strong>red by Design?<br />
Information Technology and Office Systems. London/ Washington, D.C.: Taylor &<br />
Francis<br />
Green, Eileen/Owen, Jenny/ Pain, Den (1993b): ‘City Libraries’: Human-Centered<br />
Opportunities for Women? In: Green, Eileen/ Owen, Jenny/ Pain, Den (Eds.):<br />
Gen<strong>de</strong>red by Design? Information Technology and Office Systems. London/<br />
Washington, D.C.: Taylor & Francis, 127-152<br />
Greenbaum, Joan/ Kyng, Morton (Eds.) (1991): Design at Work. Cooperative Design of<br />
Computer Systems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum<br />
Gregory, Judith (2000): Sorcerer’s Apprentice. Creating the Electronic Health Record,<br />
Re-Inventing Medical Records and Patient Care. Doctoral Dissertation. San<br />
Diego: University of California<br />
Grint, Keith/ Woolgar, Steve (1995): On some Failures of Nerve in Constructivist and<br />
Feminist Analyses of Technology. In: Gill, Rosalind/ Grint, Keith (Eds.): The<br />
Gen<strong>de</strong>r-Technology Relation. Contemporary Theory and Research. London:<br />
Taylor & Francis, 48-75<br />
Grunau, Elisabeth (2004): Navigationsstrategien beim Lernen im Netz – eine Frage <strong>de</strong>s<br />
Geschlechts? In: Schmitz, Sigrid/ Schinzel, Britta (Hg.): Grenzgänge.<br />
Gen<strong>de</strong>rforschung in Informatik und Naturwissenschaften. Königstein/ Taunus:<br />
Ulrike Helmer Verlag, 99-107<br />
Grundy, Frances (1998): Computer Engineering: Engineering What? In: AISB Quarterly<br />
Issue 100, 24-31<br />
Grundy, Frances (2000a): Where is the Science in Computer Science? Paper<br />
presented at WWC2000, Vancouver, zitiert nach www.cs.keele.ac.uk/content/<br />
people/a.f.grundy/science.htm (letzter Zugriff am 16.2.2008)<br />
Grundy, Frances (2000b): Mathematics in Computing: A Help or Hindrance for<br />
Women? Paper presented at WWC2000, Vancouver, zitiert nach<br />
www.cs.keele.ac.uk/content/people/a.f.grundy/maths.htm (letzter Zugriff am<br />
16.2.2008)<br />
336
Grundy, Frances (2001): A new Conception of Computing: Interactionism replaces<br />
Objectivism, Paper presented at GASAT10, Copenhagen, zitiert nach<br />
http://www.cs.keele.ac.uk/content/people/a.f.grundy/interact.htm (letzter Zugriff<br />
am 16.2.2008)<br />
Grundy, Frances/ Köhler, Doris/ Oechtering, Veronika/ Petersen, Ute (1997): Women,<br />
Work and Computerization. Spinning a Web from the Past to Future.<br />
Proceedings of the 6 th International IFIP-Conference. Berlin u.a.: Springer<br />
Guerses, Seda (2003): Computer Training at vifu: Digging Out Curiousity. In:<br />
Kreutzner, Gabriele/ Schelhowe, Heidi (Eds.): Agents of Change. Virtuality,<br />
Gen<strong>de</strong>r and the Challenge to the Traditional University. Opla<strong>de</strong>n: Leske +<br />
Budrich, 126-131<br />
Gustavsson, Eva (2005): Virtual Servants: Stereotyping Female Front-Office<br />
Employees on the Internet. In: Gen<strong>de</strong>r, Work and Organization 12/5, 400-419<br />
Hales, Michael (1994): Where are the Designers? Styles and Design Practices, Objects<br />
of Design and Views of Users in CSCW. In: Rosenberg, Duska/ Hutchinson,<br />
Chris (Eds.): Design Issues in CSCW. London: Springer, 151-177 (zitiert nach<br />
Suchman 2002)<br />
Hammel, Martina (2003): Partizipative Softwareentwicklung im Kontext <strong>de</strong>r<br />
Geschlechterhierarchie. Frankfurt a.M.: Peter Lang<br />
Hampson, Ian/ Junor, Anne (2005): Invisible Work, invisible skills: interactive customer<br />
service as articulation work. In: New Technology, Work and Employment 20/2,<br />
166-181<br />
Hanappi-Egger, E<strong>de</strong>ltraud (2004): Diversified Project Governance. A Case of Diversity<br />
Management? In: Proceeding of the EURAM 04, St. Andrews<br />
Hanappi-Egger, E<strong>de</strong>ltraud (2007): Computer Games: Playing Gen<strong>de</strong>r, Reflecting on<br />
Gen<strong>de</strong>r. In: Zorn, Isabel/ Maaß, Susanne/ Rommes, Els/ Schirmer, Carola/<br />
Schelhowe, Heidi (Eds.): Gen<strong>de</strong>r Designs IT. Construction and Deconstruction of<br />
Information Society Technology. Wiesba<strong>de</strong>n: VS-Verlag, 149-159<br />
Hansen, Wilfred (1971): User engineering principles for interactive systems.In:<br />
American Fe<strong>de</strong>ration of Information Processing Societies Conference<br />
Proceedings, 39, 523-532<br />
Håpnes, Tove/ Rasmussen, Bente (1991): The Production of Male Power in Computer<br />
Science. In: Lehto, Anna-Marja/ Eriksson, Inger (Hg.): Proceedings of the IFIP-<br />
Conference on Women, Work and Computerization. Amsterdam: North-Holland,<br />
407-423<br />
Haraway, Donna (1989): Primate Visions: Gen<strong>de</strong>r, Race, and Nature in the World of<br />
Mo<strong>de</strong>rn Science. New York/ London: Routledge<br />
Haraway, Donna (1995a [1991]): Die Neuerfindung <strong>de</strong>r Natur. Primaten, Cyborgs und<br />
Frauen. Frankfurt a.M.: Campus (im Orig.: Simians, Cyborgs, and Women: The<br />
Reinvention of Nature. New York: Routledge)<br />
337
Haraway, Donna (1995b): Monströse Versprechen. Coyote-Geschichten zu<br />
Feminismus und Technowissenschaft. Hamburg: Argument<br />
Haraway, Donna (1995c [1985]): Ein Manifest für Cyborgs. In: dies.: Die Neuerfindung<br />
<strong>de</strong>r Natur. Frankfurt a.M.: Campus, 33-72 (im Orig.: Manifesto for Cyborgs:<br />
Science, Technology and Socialist Feminism in the 1980’s. In: Socialist Review<br />
80, 65-108)<br />
Haraway, Donna (1995d [1988]): Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im<br />
Feminismus und das Privileg <strong>einer</strong> partialen Perspektive. In: dies.: Die<br />
Neuerfindung <strong>de</strong>r Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen. Frankfurt a.M./ New<br />
York. Campus, 73-97 (im Orig.: Situated Knowledges: The Science Question in<br />
Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial Perspective. In:<br />
Feminist Studies 14/3, 575-599)<br />
Haraway, Donna (1995e [1986]): Primatologie ist Politik mit an<strong>de</strong>ren Mitteln. In: Orland,<br />
Barbara/ Scheich, Elvira (Hg.): Das Geschlecht <strong>de</strong>r Natur.Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp, 136-198 (im Orig.: Primatology is Politics by Other Means. In: Bleier,<br />
Ruth (Ed.): Feminist Approaches to Science.New York: Pergamon Press, 77-118)<br />
Haraway, Donna (1995f [1994]): Das Abnehmespiel: Ein Spiel mit Fä<strong>de</strong>n für<br />
Wissenschaft, Kultur und Feminismus. In: dies.: Monströse Versprechen. Coyote-<br />
Geschichten zu Feminismus und Technowissenschaft. Hamburg: Argument, 136-<br />
148 (im Orig.: A Game of Cats Cradle. Science Studies, Feminist Theory,<br />
Cultural Studies. In: Configurations 1, 59-71)<br />
Haraway, Donna (1995g [1992]): Monströse Versprechen. Eine Erneuerungspolitik für<br />
un/an/geeignete An<strong>de</strong>re. In: dies.: Monströse Versprechen. Coyote-Geschichten<br />
zu Feminismus und Technowissenschaft. Hamburg: Argument, 11-80 (im Orig.:<br />
Promises of the Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In:<br />
Grossberg, Lawrence/ Nelson, Cary/ Treichler, Paula A. (Eds.): Cultural Studies.<br />
New York/ London: Routledge, 295-337)<br />
Haraway, Donna (1995h [1989]): Die Biopolitik postmo<strong>de</strong>rner Körper. Konstitutionen<br />
<strong>de</strong>s Selbst im Diskurs <strong>de</strong>s Immunsystems. In: dies.: Die Neuerfindung <strong>de</strong>r Natur.<br />
Frankfurt a.M.: Campus, 160-199 (im Orig.: The Biopolitics of Postmo<strong>de</strong>rn<br />
Bodies. Determinations of Self in the Immune System Discourse. In: Differences<br />
1/1, 3-43)<br />
Haraway, Donna (1996): Anspruchsloser Zeuge@Zweites Jahrtausend.<br />
FrauMann©trifft Oncomouse Leviathan und die vier Jots: Die Tatsachen<br />
verdrehen. In: Scheich, Elvira (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische<br />
Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie. Hamburg: Hamburger Edition, 347-389<br />
Haraway, Donna (1997): Mo<strong>de</strong>st_Witness@Second_Millennium.<br />
FemaleMale©_Meets_OncoMouse. New York/ London: Routledge<br />
Haraway, Donna (2000): Birth of the Kennel. Lecture at the European Graduate<br />
School, zitiert nach http://www.egs.edu/faculty/haraway/haraway-birth-of-thekennel-2000.html<br />
(letzter Zugriff am 29.8.07)<br />
338
Haraway, Donna (2003): The Companion Species Manifesto. Dogs, People and<br />
Significant Otherness. Chicago: Pricky Paradigm Press<br />
Harding, Sandra (1990 [1986]): Feministische Wissenschaftstheorie. Zum Verhältnis<br />
von Wissenschaft und sozialem Geschlecht. Berlin: Argument Verlag (im Orig.:<br />
The Science Question in Feminism. Ithaca/ London: Cornell University Press)<br />
Harding, Sandra (1994): Das Geschlecht <strong>de</strong>s Wissens: Frauen <strong>de</strong>nken die<br />
Wissenschaft neu .Frankfurt a.M.: Campus (im Orig. 1991)<br />
Hartmann, Susann/ Schecker, Horst/ Rethfeld, Johannes (2005): Mädchen und<br />
Roboter – Ein Weg zur Physik? In: Pitton, Anja (Hg): Tagungsband <strong>de</strong>r<br />
Jahrestagung in Hei<strong>de</strong>lberg 2004 <strong>de</strong>r Gesellschaft für Didaktik <strong>de</strong>r Chemie und<br />
Physik – Relevanz fachdidaktischer Forschungsergebnisse für die Lehrerbildung.<br />
Münster: Lit Verlag, 357-359<br />
Haug, Frigga (1990): Erinnerungsarbeit. Hamburg: Argument-Verlag<br />
Haug, Frigga (1999): Vorlesungen zur Einführung in die Erinnerungsarbeit. Hamburg:<br />
Argument-Verlag<br />
Hayles, Katherine (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics,<br />
Literature, and Informatics: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and<br />
Informatics. Chicago/ London: University of Chicago Press<br />
Hayles, Katherine (2003): Computing the Human. In: Weber, Jutta/ Bath, Corinna<br />
(Hg.): Turbulente Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur<br />
Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 99-118<br />
Hayles, Katherine (2006): Unfinished Work. From Cyborg to Cognisphere. In: Theory,<br />
Culture & Society, Vol. 23(7-8), 159-166;<br />
Hecht, Maike/ Maaß, Susanne (2008): Teaching Participatory Design. In: Proceedings<br />
of the Tenth Conference on Participatory Design 2008, zitiert nach<br />
http://idisk.mac.com/barbaraandrews-Public?view=web (letzter Zugriff am<br />
24.2.2009), 166-169<br />
Heinsohn, Dorit (2006): Zweibahnstraßen zwischen Gen<strong>de</strong>r Studies und<br />
Naturwissenschaften. In: Bauer, Robin/ Götschel, Helene (Hg.): Gen<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n<br />
Naturwissenschaften. Ein Curriculum an <strong>de</strong>r Schnittstelle <strong>de</strong>r<br />
Wissenschaftskulturen. Talheim/ Mössingen: Talheimer, 40-50<br />
Heintz, Bettina (1993): Die Herrschaft <strong>de</strong>r Regel. Zur Grundlagengeschichte <strong>de</strong>s<br />
Computers. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Heintz, Bettina (1994): Die Gesellschaft in <strong>de</strong>r Maschine – Überlegungen zum<br />
Verhältnis von Informatik und Soziologie. In: Kreowski, Hans-Jörg/ Risse,<br />
Thomas/ Spillner, Andreas/ Streibl, Ralf/ Vosseberg, Karin (Hg.): Realität und<br />
Utopien <strong>de</strong>r Informatik. Münster: Agenda, 12-31<br />
Hekman, Susan (1990): Gen<strong>de</strong>r and Knowledge. Elements of a Postmo<strong>de</strong>rn Feminism.<br />
Oxford: Polity Press<br />
339
Helduser, Urte/ Marx, Daniela/ Paulitz, Tanja/ Pühl, Katharina (Hg.) (2004): un<strong>de</strong>r<br />
construction? Konstruktivistische Perspektiven in feministischer Theorie und<br />
Forschungspraxis. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Hellige, Hans-Dieter (Hg.) (2004): Geschichten <strong>de</strong>r Informatik. Visionen, Paradigmen,<br />
Leitmotive. Berlin u.a.: Springer<br />
Helmreich, Stefan (1998): Silicon Second Nature. Culturing Artificial Life in the Digital<br />
World. Berkeley: University of California Press<br />
Henriksen, Dixi Louise (2002): Locating virtual field sites and a dispersed object of<br />
research. In: Scandinavian Journal of Information Systems 14/2, 31-45<br />
Henwood, Flis (2000): From the Women Question to the Technology Question in<br />
Feminism. Rethinking Gen<strong>de</strong>r Equality in It Education. In: The European Journal<br />
of Women’s Studies 7/2, 209-227<br />
Henwood, Flis/ Wyatt, Sally/ Miller, Nod/ Senker, Peter (2000): Critical Perspectives on<br />
Technologies, In/equalities and the Information Society. In: Wyatt, Sally/<br />
Henwood, Flis/ Miller, Nod/ Senker, Peter (Eds.): Technology and In/equality.<br />
Questioning the Information Society. London/ New York: Routledge, 1-18<br />
Herczeg, Michael (1994): Software-Ergonomie. Grundlagen <strong>de</strong>r Mensch-Computer-<br />
Kommunikation. Bonn/ Paris/ Reading, Mass: Addison-Wesley<br />
Herring, Susan (2000): Gen<strong>de</strong>r Differences in CMC: Findings and Implications. In:<br />
CPSR Newsletter 18/ 1, zitiert nach http://cpsr.org/issues/womenintech/herring/<br />
(letzter Zugriff am 11.5.08)<br />
Hochschild, Arlie Russell (1983): The Managed Heart: the Commercialization of<br />
Human Feeling. Berkeley u.a.: University of California Press<br />
Hoffmann, Ute (1987): Computerfrauen. Welchen Anteil haben Frauen an<br />
Computergeschichte und -arbeit? München: Hampp<br />
Hofmann, Jeanette (1997): Über Nutzerbil<strong>de</strong>r in Textverarbeitungsprogrammen – Drei<br />
Fallbeispiele. In: Meinolf, Dierkes (Hg.): Technikgenese. Befun<strong>de</strong> aus einem<br />
Forschungsprogramm. Berlin: Edition Sigma, 71-97<br />
Hofmann, Jeanette (1999): Writers, texts and writing acts: gen<strong>de</strong>red user images in<br />
word processing software. In: Wajcman, Judy/ MacKenzie, Donald (Eds.): The<br />
Social Shaping of Technology, 2nd Ed. Buckingham, Phila<strong>de</strong>lphia: Open<br />
University Press, 222-243<br />
Höök, Kristina (2004): User-Centered Design and Evaluation of Affective Interfaces. In:<br />
Ruttkay, Zsófia/ Pelachaud, Catherine (Eds.): From Brows to Trust. Evaluating<br />
Embodied Conversational Agents. Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer, 127-160<br />
Höök, Kristina/ Sengers, Phoebe/ An<strong>de</strong>rsson, Gerd (2003): Sense and<br />
sensibility:evaluation and interactive art. In: Proceedings of the SIGCHI<br />
conference on Human factors in computing systems, 241-248<br />
Höök, Kristina/ Isbister, Katherine/ <strong>de</strong> Rosis, Fiorella/ Laaksolahti, Jarmo/ Krenn,<br />
Brigitte (2004): HUMAINE D9b, Preliminary Plans for Exemplars: Usability,<br />
340
Version 1.0, zitiert nach http://emotion-research.net/projects/humaine/<br />
<strong>de</strong>liverables/D9b.pdf/view (letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Holtgreve, Ursula (1991): Frauenundtechnik – Überlegungen zu <strong>einer</strong> Denkschrift, in:<br />
beiträge zur feministischen theorie und praxis 14/29, 155-160<br />
Holtzblatt, Karen/ Wen<strong>de</strong>ll, Jessamyn Burns/ Wood, Shelley (2005): Rapid Contextual<br />
Design: A How-to Gui<strong>de</strong> to Key Techniques for User-Centered Design. San<br />
Francisco: Morgan Kaufmann<br />
Hone, Kate (2006): Empathic Agents to reduce user frustration: The effects of varying<br />
agent characteristics. In: Interacting with Computers 18/2, 227-245<br />
Horton, Sarah (2005): Access by Design. A Gui<strong>de</strong> to Universal Usability for Web<br />
Designers. Berkeley, Ca.: New Ri<strong>de</strong>rs Press<br />
Hubbard, Ruth (1995): Profitable Promises. Essays on Women, Science and Health.<br />
Monroe, Maine: Common Courage Press<br />
Huff, Chuck (2002): Gen<strong>de</strong>r, Software Design, and Occupational Equity. In: SIGCSE<br />
Bulletin 34/2, 112-115<br />
Huff, Chuck/ Cooper, Joel (1987): Sex bias in educational software. The effect of<br />
<strong>de</strong>signers’ stereotypes on the software they <strong>de</strong>sign. In: Journal of Applied Social<br />
Psychology 17, 139-155<br />
Isbister, Katherine/ Doyle, Patrick (2004): The Blind Man and the Elephant revisited.<br />
Evaluating interdisciplinary ECA Research. In: Ruttkay, Zsófia/ Pelachaud,<br />
Catherine (Eds.): From Brows to Trust. Evaluating Embodied Conversational<br />
Agents. Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer, 3-26<br />
Introna, Lucas/ Helen Nissenbaum (2000): Shaping the Web: Why the Politics of<br />
Search Engines Matters. In: The Information Society 16/3, 1-17<br />
Jacobsen, Ivar/ Booch, Grady/ Rumbaugh, James (1999): The Unified Software<br />
Development Process. Amsterdam: Addison-Wesley<br />
Jacko, Julie A./ Sears, Andrew (Eds.) (2002): The human-computer interaction<br />
handbook: Fundamentals, evolving technologies and emerging applications.<br />
Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates<br />
Jacko, Julie A./ Sears, Andrew (2008): The human-computer interaction handbook:<br />
Fundamentals, evolving technologies and emerging applications. Mahwah, NJ:<br />
Lawrence Erbaum Associates, 2 nd Ed.<br />
Jaggar, Alison (1989): Love and knowledge. Emotion in Feminist Epistemology. In:<br />
Jaggar, Alison/ Bordo, Susan (Eds.): Gen<strong>de</strong>r/ Body/ Knowledge: Feminist<br />
Reconstructions of Being and Knowing. New Brunswick, N.J: Rutgers University<br />
Press, 145-171<br />
Janshen, Doris (Hg.) (1990): Hat die Technik ein Geschlecht? Berlin: Orlanda<br />
Jantzen, Gitte/ Jensen, Jans (1993): Powerplay – Power, Violence and Gen<strong>de</strong>r in<br />
Vi<strong>de</strong>o Games. In: AI & Society 7/4, 368-385<br />
341
Jenkins, Henry (2001): From Barbie to Mortal Combat: Further Reflections, zitiert nach<br />
http://culturalpolicy.uchicago.edu/conf2001/papers/jenkins.html (letzter Zugriff am<br />
25.2.2009)<br />
Jenkins, Henry/ Cassell, Justine (2008): From Quake Girls to Desperate Housewives:<br />
A Deca<strong>de</strong> of Gen<strong>de</strong>r and Computer Games. In: Kafai, Yasmin/ Heeter, Carrie/<br />
Denner, Jill/ Sun, Jennifer (Eds.): Beyond Barbie and Mortal Kombat: New<br />
Perspectives on Gen<strong>de</strong>r and Gaming. Cambridge, Ma.: MIT Press, hier zitiert<br />
nach http://www.soc.northwestern.edu/justine/publications/Jenkins_Cassell%20<br />
BBMK_Forward.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Jensen, Casper Bruun (2004): Researching Partially Existing Objects. Working Paper<br />
No.4, Centre for STS Studies, Department for Information and Media Studies.<br />
Aarhus University, zitiert nach http://www.brics.dk/fileadmin/user_upload/<br />
JENSEN_1.PDF (letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Joerges, Bernward (1999a): Die Brücken <strong>de</strong>s Robert Moses: Stille Post in <strong>de</strong>r Stadt-<br />
und Techniksoziologie. In: Leviathan 27, 43-63<br />
Joerges, Bernward (1999b): Do Politics Have Artefacts? In: Social Studies of Science<br />
29/3, 411-431<br />
Joerges, Bernward (1999c): Scams Cannot be busted. Reply to Woolgar & Cooper. In:<br />
Social Studies of Science 29/3, 450-57<br />
John, Sara (2006): Un/realistically embodied: The gen<strong>de</strong>red conceptions of realistic<br />
game <strong>de</strong>sign. In: Online Proceedings of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and Interaction.<br />
Real and Virtual women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006 (23-26 May, 2006 -<br />
Venice, Italy), zitiert nach http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/<br />
gen<strong>de</strong>r/papers.htm (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
John, Sara/ Allhutter, Doris (2007): Zur Ausblendung sozialer Dimensionen im<br />
Qualitätsbegriff <strong>de</strong>r Informatik. In: Allhutter, Doris/ Pernicka, Susanne (Hg.):<br />
Sozialwissenschaftliche Technikforschung zwischen Anpassung und Kritik. In:<br />
Kurswechsel 3, 26-34<br />
Johnson, Jeff (1989): The Xerox Star: A retrospective. In: IEEE Computer 22/9, 11-28<br />
(zitiert nach Hofmann 1999)<br />
Johnstone, Justine (2007): Technology as Empowerment: a Capability Approach to<br />
Computer Ethics. In: Ethics and Information Technology 9, 73-87<br />
Joost, Gesche (o.J.): Gen<strong>de</strong>raspekte in <strong>de</strong>r Designausbildung, zitiert nach<br />
http://www.hawk-hhg.<strong>de</strong>/hawk/hochschule/media/Gen<strong>de</strong>raspekte_in_<strong>de</strong>r_Design<br />
ausbildung_v0.2.pdf (letzter Zugriff am 24.2.2009)<br />
Jungk, Robert/ Müllert, Norbert (1989): Zukunftswerkstätten. Mit Phantasie gegen<br />
Routine und Resignation. München: Heyne<br />
Kaiser, Anelis/ Kuenzli Esther/ Nitsch, Cordula (2004): Does sex / gen<strong>de</strong>r influence<br />
language processing? In: NeuroImage 22, Supl.1. Abstr. No MO39<br />
342
Kaiser, Anelis/ Kuenzli Esther/ Zappatore, Daniela/ Nitsch, Cordula (2007): On females’<br />
lateral and males’ bilateral activation during language production: A fMRI study.<br />
In: International Journal of Psychophysiology 63, 192-198<br />
Kaiser, Anelis/ Haller, Sven/ Schmitz, Sigrid/ Nitsch, Cordula (2009): On sex/gen<strong>de</strong>r<br />
related similarities and differences in fMRI language research: A commentary. In<br />
Brain Research Reviews 61(2), 49-59<br />
Keller, Evelyn Fox (1986 [1985]): Liebe, Macht und Erkenntnis. Männliche o<strong>de</strong>r<br />
weibliche Wissenschaft? München/ Wien: Hanser (im Orig.: Reflections on<br />
Gen<strong>de</strong>r and Science. New Hven, London: Yale University Press)<br />
Keller, Evelyn Fox (1989 [1982]): Feminismus und Wissenschaft. In: List, Elisabeth/<br />
Stu<strong>de</strong>r, Herlin<strong>de</strong> (Hg. ): Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp, 281-300 (Orig. in: Signs. Journal of Women in Culture and Society<br />
7/3, 589-602)<br />
Keller, Evelyn Fox (1995 [1983]): Barbara McClintock. Die Erfin<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>r spingen<strong>de</strong>n<br />
Gene. Basel/ Boston/ Berlin: Birkhäuser (im Orig.: A Feeling for the Organism.<br />
New York: Freeman & Co.)<br />
Kensing, Finn (1987): Generation of Visions in Systems Development. In: Docherty,<br />
Peter/ Fuchs-Kittowski, Klaus/ Kolm, Paul/ Mathiassen, Lars (Eds.): Systems<br />
Design for human <strong>de</strong>velopment and productivity – Participation and Beyond.<br />
Amsterdam: North-Holland, 41-55<br />
Kensing, Finn/ Madsen, Kim Halkov (1991): Generating Visions. Future Workshops<br />
and Metaphorical Design. In: Greenbaum, Joan/ Kyng, Morton (Eds.) (1991):<br />
Design at Work. Cooperative Design of Computer Systems. Hillsdale, NJ:<br />
Lawrence Erlbaum<br />
Khan, Rabia/ De Angeli, Antonella (2007): Mapping the Demografics of Virtual<br />
Humans. In: HCI Adjunct Proceedings, 149-152<br />
Kim, Yangee/ Baylor, Amy L./ Shen, E. (2007): Pedagogical agents as learning<br />
companions: The impact of agent affect and gen<strong>de</strong>r. In: Journal of Computer-<br />
Assisted Learning (JCAL) 23/3, 220-234<br />
Kimpeler, Simone (2006): Fallbeispiel “IPerG – Integriertes Projekt über Pervasive<br />
Gaming“. In: Bührer, Susanne/ Schraudner, Martina (Hg.) (2006): Gen<strong>de</strong>r-<br />
Aspekte in <strong>de</strong>r Forschung. Wie können Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in Forschungsvorhaben<br />
erkannt und bewertet wer<strong>de</strong>n? Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System- und<br />
Innovationsforschung, 57-67<br />
Klawe, Maria (2001): Refreshing the Nerds. In: Communications of the ACM 44,/7, 67-<br />
68<br />
Kleinsmith, Andrea/ Bianchi-Berthouze, Nadia/ Berthouze, Luc (2006): An Effect of<br />
Gen<strong>de</strong>r in the Interpretation of Affective Cues in Avatars. In: Online Proceedings<br />
of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and Interaction. Real and Virtual women in a male<br />
world” <strong>de</strong>r AVI 2006. (23-26 May, 2006 - Venice, Italy), zitiert nach<br />
343
http://www.informatics.manchester.ac.uk/~antonella/gen<strong>de</strong>r/papers.htm (letzter<br />
Zugriff am 25.2.2009)<br />
Kline, Ronald/ Pinch, Trevor (1996): Users as Agents of Technological Change: The<br />
Social Construction of the Automobile in Rural United States. In: Technology &<br />
Culture 37, 763-795<br />
Klinger, Cornelia (1995): Beredtes Schweigen und verschwiegenes Sprechen. Genus<br />
im Diskurs <strong>de</strong>r Philosophie. In: Bußmann, Hadumod/ Hof, Renate (Hg.): Genus.<br />
Zur Geschlechterdifferenz in <strong>de</strong>n Kulturwissenschaften. Stuttgart: Kröner, 34-59<br />
Klinger, Cornelia (2005): Feministische Theorie zwischen Lektüre und Kritik <strong>de</strong>s<br />
philosophischen Kanons. In: Bussmann, Hadumod/ Hof, Renate: Genus. Gen<strong>de</strong>r<br />
Studies in <strong>de</strong>n Kultur- und Sozialwissenschaften. Ein Handbuch,. Erweitere<br />
Neuauflage. Stuttgart: Kröner Verlag, 328-364<br />
Knapp, Gudrun-Axeli (1989): Männliche Technik-Weibliche Frau? Zur Analyse <strong>einer</strong><br />
problematischen Beziehung. In: Becker, Dietmar/ Becker-Schmidt, Regine/<br />
Knapp, Gudrun-Axeli: Zeitbil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Technik. Bonn: Dietz, 193-253<br />
Knapp, Gudrun-Axeli (1998): Postmo<strong>de</strong>rne Theorie o<strong>de</strong>r Theorie <strong>de</strong>r Postmo<strong>de</strong>rne?<br />
Anmerkungen aus feministischer Sicht. In: dies. (Hg.): Kurskorrekturen.<br />
Feminismus zwischen Kritischer Theorie und Postmo<strong>de</strong>rne. Frankfurt a.M./ New<br />
York: Campus, 25-88<br />
Knapp, Gudrun-Axeli (2000): Konstruktion und Dekonstruktion von Geschlecht. In:<br />
Becker-Schmidt, Regina/ dies. (Hg.): Feministische Theorien zur Einführung.<br />
Hamburg: Junius, 63-102<br />
Knorr-Cetina, Karin (1984 [1981]): Die Fabrikation <strong>de</strong>r Erkenntnis. Frankfurt a.M.:<br />
Suhrkamp (im Orig.: The manufacture of knowledge. Oxford: Pergamon)<br />
Knorr-Cetina, Karin (1995): Laboratory Studies. The Cultural Approach to the Study of<br />
Science. In: Jasanoff, Sheila/Merkle, Gerald/Petersen, James/Pinch, Trevor<br />
(Eds.): Handbook of Science and Technology Studies. Thousand Oaks, Ca.:<br />
Sage, 140-166<br />
Krabbel, Anita (1988): Feministische Kritik an <strong>de</strong>r Informatik. In: Frauen und Informatik.<br />
Anspruch und Realität. Mitteilung Nr. 155/88 <strong>de</strong>s Fachbereichs Informatik <strong>de</strong>r<br />
Universität Hamburg, 18-21<br />
Krenn, Brigitte/ Gstrein, Erich (2006): On female and male avatars: data from a webbased<br />
flirting community. In: Online Proceedings of the Workshop “Gen<strong>de</strong>r and<br />
Interaction. Real and Virtual women in a male world” <strong>de</strong>r AVI 2006. (23-26 May,<br />
2006 - Venice, Italy), zitiert nach http://www.informatics.manchester.ac.uk/<br />
~antonella/gen<strong>de</strong>r/papers.htm (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Kreowski, Hans-Jörg (2008): Informatik und Gesellschaft. Verflechtungen und<br />
Perspektiven. Berlin: LIT Verlag<br />
Kreutzner, Gabriele/ Schelhowe, Heidi (Eds.) (2003): Agents of Change. Virtuality,<br />
Gen<strong>de</strong>r and the Challenge to the Traditional University. Opla<strong>de</strong>n: Leske +<br />
Budrich<br />
344
Kreutzner, Gabriele/ Schelhowe, Heidi/ Schelkle, Barbara (2003): Driven by User-<br />
Orientation, Participation and Interaction: vifu – Virtual Women’s University<br />
(www.vifu.<strong>de</strong>) In: Kreutzner, Gabriele/ Schelhowe, Heidi (Eds.): Agents of<br />
Change. Virtuality, Gen<strong>de</strong>r and the Challenge to the Traditional University.<br />
Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 109-123<br />
Krummheuer, Antonia (2007): Herausfor<strong>de</strong>rungen künstlicher Handlungsträgerschaft.<br />
Frotzelattacken in hybri<strong>de</strong>n Austauschprozessen von Menschen und virtuellen<br />
Agenten. In: Greif, Hajo/ Mitrea, Oana/ Werner, Matthias (Hg.): Information und<br />
Gesellschaft. Technologien <strong>einer</strong> sozialen Beziehung. Wiesba<strong>de</strong>n: VS-Verlag,<br />
73-95<br />
Kuhn, Sara/ Muller, Michael (Eds.) (1993): Special Issue on Participatory Design.<br />
Communications of the ACM 36/4<br />
Kuhnt, Beate (1998): Software als systemische Intervention in Organisationen.<br />
Dissertation an <strong>de</strong>r Universität Zürich (zitiert nach Hammel 2003)<br />
Kumbruck, Christel (1990): Die binäre Herrschaft. Intuition und logisches Prinzip.<br />
München: Profil<br />
Landström, Catharina (2007): Queering feminist technology studies. In: Feminist<br />
Theory 8/1, 7-26<br />
Larsson, Anna/ Nerén, Carina (2005): Gen<strong>de</strong>r Aspects on Computer Game Avatars.<br />
SICS Technical Report T2005:06, zitiert nach ftp://ftp.sics.se/pub/SICSreports/Reports/SICS-T--2005-06--SE.pdf<br />
(letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Latour, Bruno (1987): Science in Action. How to Follow Scientist and Engineers<br />
through Society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press<br />
Latour, Bruno (1991): Technology is Society Ma<strong>de</strong> Durable, in: Law, John (Ed.): A<br />
Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination. London/<br />
New York: Routledge, 103-131<br />
Latour, Bruno (1996a [1993]): Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers<br />
<strong>de</strong>r Wissenschaften. Berlin: Aka<strong>de</strong>mie-Verlag (im Orig. La Clef <strong>de</strong> Berlin. Et<br />
autres le ons d un amateur <strong>de</strong> sciences. Paris : Editions La D couverte)<br />
Latour, Bruno (1996b): On actor-network theory. A few clarifications. In: Soziale Welt,<br />
Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis 4, 369-381<br />
Latour, Bruno (1998 [1991]): Wir sind nie mo<strong>de</strong>rn gewesen. Versuch <strong>einer</strong><br />
symmetrischen Anthropologie. Frankfurt a.M.: Fischer (im Orig.: Nous n’avons<br />
jamais t mo<strong>de</strong>rnes. Essai d’anthropologie sym trique. Paris: La Decouverte)<br />
Latour, Bruno (2001 [1999]): Das Parlament <strong>de</strong>r Dinge. Für eine politische Ökologie.<br />
Frankfurt a.M.: Suhrkamp (im Orig.: Politiques <strong>de</strong> la nature. Comment faire entrer<br />
les sciences en d mocratie. Paris: La D couverte)<br />
Latour, Bruno (2002 [1999]): Die Hoffnung <strong>de</strong>r Pandora. Frankfurt a.M.: Suhrkamp (im<br />
Orig.: Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge:<br />
Harvard University Press)<br />
345
Latour, Bruno (2004): Which politics for which artifacts? In: Domus 4, zitiert nach<br />
http://www.bruno-latour.fr/presse/presse_art/GB-06%20DOMUS%2006-04.html<br />
(letzter Zugriff am 23.3.07)<br />
Latour, Bruno (2006 [1986]): Drawing things together. Die Macht <strong>de</strong>r unverän<strong>de</strong>rlich<br />
mobile Elemente. In: Bellinger, Andréa/ Krieger, David (Hg.): ANThology. Ein<br />
einführen<strong>de</strong>s Handbuch zur Akteur-Netzwerk-Theorie. Bielefeld: transcript, 259-<br />
307 (im Orig.: Visualization and cognition. Thinking with eyes and hands. In:<br />
Knowledge and Society: Studies in the Sociology of culture past and present 6,<br />
1-40)<br />
Latour, Bruno/ Woolgar, Steve (1979): Laboratory Life. The Social Construction<br />
Scientific Facts. Beverly Hills, Ca.: Sage<br />
Laurel, Brenda (1991): Computers as theatre. Reading, Mass. [u.a.]: Addison-Wesley<br />
Law, John (1987): Technology and Heterogeneous Engineering. The Case of the<br />
Portugese Expansion. In: Bijker, Wiebe E./Hughes, Thomas P./Pinch, Trevor J.<br />
(Eds.): The Social Construction of Technological Systems. Cambridge, Mass.:<br />
MIT Press, 111-134<br />
Law, John/ Hassard, John (Eds.) (1999): Actor-Network Theory and After. Oxford:<br />
Blackwell<br />
Lee, Eun-Ju (2003): Effects of "gen<strong>de</strong>r" of the computer on informational social<br />
influence: the mo<strong>de</strong>rating role of task type. In: International Journal of Human-<br />
Computer Studies 58/4, 347 - 362<br />
Lei<strong>de</strong>rmann, Frank/ Pieper, Michael/ Weber, Harald (2001): Design for All. Konzepte,<br />
Umsetzungen, Herausfor<strong>de</strong>rungen. In: Oberquelle, Horst/ Oppermann, Reinhard/<br />
Krause, Jürgen (Hg.): Mensch & Computer. Stuttgart: Teubner, 389-390<br />
Lenat, Douglas/ Guha, R (1990): Building Large Knowledge-Based Systems.<br />
Representation and Inference in the Cyc Project. Reading, Ma.: Addison-Wesley<br />
(zitiert nach Adam 1998)<br />
Lettow, Susanne (2003): Vom Humanismus zum Posthumanismus? Konstruktionen<br />
von Technologie, Politik und Geschlechterverhältnissen. In: Weber, Jutta/ Bath,<br />
Corinna (Hg.): Turbulente Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur<br />
Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 47-63<br />
Lie, Merete (1995): Technology and Masculinity. The Case of the Computer. In:<br />
European Journal of Women’s Studies 2/3, 379-394<br />
Lie, Merete/ Sørensen, Knut (Eds.) (1996): Making Technology Our Own?<br />
Domesticating Technology into Everyday Life. Oslo: Scandinavian University<br />
Press<br />
List, Elisabeth (1994): Wissen<strong>de</strong> Körper – Wissenskörper – Maschinenkörper. Zur<br />
Semiotik <strong>de</strong>r Leiblichkeit. In: Die Philosophint 4, 9-26<br />
List, Elisabeth (1997): Vom Enigma <strong>de</strong>s Leibes zum Simulakrum <strong>de</strong>r Maschine. Das<br />
Verschwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lebendigen aus <strong>de</strong>r telematischen Kultur. In: List, Elisabeth/<br />
346
Fiala, Erwin (Hg.): Leib Maschine Bild. Körperdiskurse <strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rne und<br />
Postmo<strong>de</strong>rne. Wien: Passagen-Verlag<br />
Lloyd, Genevieve (1984): The Man of Reason: 'Male' and 'Female' in Western<br />
Philosophy. London/ New York: Routledge<br />
Löchel, Elfrie<strong>de</strong> (1994): Auf zu neuen Ufern. Tagungsbericht: Frauensichten auf die<br />
Informatik. Wechselwirkung 67/6, 45-61<br />
Lohan, Maria (2000): Constructive Tensions in Feminist Technology Studies. In: Social<br />
Studies of Science 30/6, 895-916<br />
Lohan, Maria/ Faulkner, Wendy (2004): Masculinities and Technologies. In: Men and<br />
Masculinities 6/4, 319-329<br />
Longino, Helen (1990): Science as Social Knowledge. Princeton: Princeton University<br />
Press<br />
Lorber, Judith (1999 [1994]): Gen<strong>de</strong>r-Paradoxien. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich (im Orig.:<br />
Paradoxes of gen<strong>de</strong>r. New Haven:Yale University Press)<br />
Lorber, Judith (2000): Using Gen<strong>de</strong>r to Undo Gen<strong>de</strong>r. A feminist <strong>de</strong>gen<strong>de</strong>ring<br />
movement. In: Feminist Theory 1/1, 79-95<br />
Lorber, Judith (2004): Man muss bei Gen<strong>de</strong>r ansetzen, um Gen<strong>de</strong>r zu <strong>de</strong>montieren.<br />
Feministische Theorie und Degen<strong>de</strong>ring. In: Zeitschrift für Frauenforschung und<br />
Geschlechterstudien 2+3, 9-24<br />
Lübke, Valeska (2005): CyberGen<strong>de</strong>r. Geschlecht und Körper im Internet. Königstein/<br />
Taunus: Ulrike Helmer<br />
Luff, Paul/ Hindmarsh, Jon/ Heath, Christian (Eds.) (2000): Workplace Studies:<br />
Recovering Work Practice and Information System Design. Cambridge, UK:<br />
Cambridge University Press<br />
Lynch, Michael (1985): Art and Artifact in Laboratory Science. A Study of Shop Work<br />
and Shop Talk in a Research Laboratory. London: Routledge and Kegan Paul<br />
Maaß, Susanne (1993): Software-Ergonomie-Ausbildung in Informatik-Studiengängen<br />
bun<strong>de</strong>s<strong>de</strong>utscher Universitäten. In: Informatik-Spektrum 16/1, 25-30<br />
Maaß, Susanne (2003). Technikgestaltung im Kontext. Grenzgänge und<br />
Verbindungen. In: Thiessen, Barbara/ Heinz, Kathrin (Hg.): Feministische<br />
Forschung – Nachhaltige Einsprüche. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 211-235<br />
Maaß, Susanne/ Theissing, Florian/ Zallmann, Margita (2002): Unterstützung von<br />
Interaktionsarbeit im Callcenter. Neue Fragen für die arbeitsorientierte<br />
Softwareentwicklung. In: i-com. Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien<br />
3, 4-11<br />
Maaß, Susanne/ Wiesner, Heike (2006): Programmieren, Mathe und ein bisschen<br />
Hardware ... Wen lockt dies Bild <strong>de</strong>r Informatik? In: Informatik Spektrum 29/2,<br />
125-132<br />
347
Maaß, Susanne/ Rommes, Els (2007): Uncovering the Invisible: Gen<strong>de</strong>r-Sensitive<br />
Analysis of Call Center Work and Software. In: Zorn, Isabel/ Maaß, Susanne/<br />
Rommes, Els/ Schirmer, Carola/ Schelhowe, Heidi (Eds.) (2007): Gen<strong>de</strong>r<br />
Designs IT. Construction and Deconstruction of Information Society Technology.<br />
Wiesba<strong>de</strong>n: VS-Verlag, 97-108<br />
Maaß, Susanne/ Rommes, Els / Schirmer, Carola / Zorn, Isabel (2007): Gen<strong>de</strong>r<br />
Research and IT Construction. Concepts for Challenging Partnership. In: Zorn,<br />
Isabel/ Maaß, Susanne / Rommes, Els/ Schirmer, Carola/ Schelhowe, Heidi<br />
(Hg.): Gen<strong>de</strong>r Designs IT. Construction and Deconstruction of Information<br />
Society Technology. Wiesba<strong>de</strong>n: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 9-32<br />
Mackay, Hugh/ Carne, Chris/ Beynon-Davies/ Tudhope, Doug (2000): Reconfiguring<br />
the User. Using Rapid Application Development. In: Social Studies of Science 30/<br />
5, 735-57<br />
MacKenzie, Donald / Wajcman, Judy (Eds.) (1995): The Social Shaping of Technology,<br />
How the Refrigerator Gots its Hum. Buckingham, Phila<strong>de</strong>lphia: Open University<br />
Press<br />
MacKenzie, Donald / Wajcman, Judy (Eds.) (1999): The Social Shaping of Technology,<br />
2nd Ed. Buckingham, Phila<strong>de</strong>lphia: Open University Press (Erste Auflage 1985)<br />
MacNaghten, Phil/ Kearnes, Matthew/ Wynne, Brian (2005): Nanotechnology,<br />
Governance, and Public Deliberation: What Role for the Social Sciences? In:<br />
Science Communication 27/2, 268-291<br />
Madsen, Kim Halskov (1994): A Gui<strong>de</strong> to Metaphorial Design. In: Communications of<br />
the ACM 37/12, 57 - 62<br />
Mahn, Anne (1997): Informatische Berufsfähigkeit. In: Informatik Spektrum 20/2, 88-94<br />
Mahn, Anne/ Brauer, Wilfried (1997): Informatik: Selbstverständnis -<br />
Anwendungsbezüge - Curricula (Editorial). In: Informatik Spektrum 20/2, 71-72<br />
Marcus, Aaron (1993): Human Communication Issues in advanced UIs. In:<br />
Communications of the ACM 36/4, 100-109 (zitiert nach Preece et al. 2002)<br />
Margolis, Jane/ Fisher, Allan/ Miller, Faye (1999): Caring about Connections: Gen<strong>de</strong>r<br />
and Computing. In: Technology and Society 18/4, 13-20<br />
Margolis, Jane/ Fisher, Allan (2002): Unlocking the Clubhouse. Women in Computing.<br />
Cambridge, London: MIT Press<br />
Mateas, Michael/ Salvador, Tony / Scholtz, Jean/ Sorensen, Doug (1996): Engineering<br />
ethnography at the home. Conference companion on Human factors in<br />
computing system. ACM, 283-284<br />
Mason, Roy (1983): Xanadu: The Computerized Home of Tomorrow and How it Can<br />
Be Yours Today. Washington D.C.:Acropolis (zitiert nach Hofmann 1999)<br />
348
Maurer, Hermann (2007): Google - Freund o<strong>de</strong>r Feind? In: Informatik Spektrum 30/4,<br />
273-278<br />
McCarthy, John/ Wright, Peter (2004): Technology as Experience, Cambridge, Ma.:<br />
MIT Press<br />
McDonald, Sharon/ Spencer, Linda (2000): Gen<strong>de</strong>r Differences in Webnavigation. In:<br />
Ellen Balka/ Smith, Richard (Eds.): Women, Work, and Computerization. IFIP<br />
2000. Boston/ Dordrecht/ London:Kluwer, 174-181<br />
McGraw, Karen/ Harbison, Karan (1997): User-Centered Requirements: The Scenario-<br />
Based Engineering Process.New Haven: Lawrence Erlbaum<br />
Messerschmidt, Janina (2007): Donna Haraway und ihre Rezeption in Deutschland.<br />
Magisterarbeit am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie <strong>de</strong>r Universität<br />
Hannover<br />
Mies, Maria (1984): Frauenforschung o<strong>de</strong>r feministische Forschung? Die Debatte um<br />
feministische Wissenschaft und Methodologie. In: Beiträge zur feministischen<br />
Theorie und Praxis. Band II, 7-25<br />
Mies, Maria (1990 [1984]): Die Debatte um die „Methodischen Postulate zur<br />
Frauenforschung“. In: Zentraleinrichtung für Frauenstudien und Frauenforschung<br />
an <strong>de</strong>r Freien Universität Berlin (Hg.): Metho<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Frauenforschung, 2.<br />
Auflage. Frankfurt a.M.: Fischer, 165-197<br />
Millett, Lynette/ Friedman, Batya/ Felten, Edward (2001): Cookies and Web Browser<br />
Design: Toward realizing informed consent online. In: Proceedings of the<br />
Conference on Human Factors in Computer Systems (CHI 2001), 46-52<br />
Minh-ha, Trinh (1986): She, The Inappropriate/d Other. In: Discourse. No 8, S. 1-37<br />
Minsky, Marvin (2006): The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial<br />
Intelligence, and the Future of the Human Mind. New York: Simon Schuster<br />
Mittelstraß, Jürgen (2003): Glanz und Elend <strong>de</strong>r Geisteswissenschaften. In: Kühne-<br />
Bertram, Gudrun/ Lessing, Hans-Ulrich/ Steenblock, Volker (Hg.): Kultur<br />
verstehen. Zur Geschichte und Theorie <strong>de</strong>r Geisteswissenschaften. Würzburg:<br />
Königshausen und Neumann, 35-49<br />
Mogensen, Preben (1991): Towards a Provotyping Approach in Systems Development.<br />
In: Scandinavian Journal of Information Systems 3, 31-53<br />
Moggridge, Bill (2006): Designing Interactions. Cambridge, Mass.: MIT Press<br />
Moreno, Kristen/ Person, Natalie/ Adcock, Amy/ Van Eck, Richard/Jackson, G. Tanner/<br />
Marineau, Johanna (2002): Etiquette and efficacy in animated pedagogical<br />
agents: The role of stereotypes. In: Working Notes of the 2002 AAAI Fall<br />
Symposium on Etiquette for Human Computer Work. AAAI Press<br />
Morris, J. Andrews/ Feldman, Daniel C. (1996): The Dimensions, Antece<strong>de</strong>nts and<br />
Consequences of Emotional Labour. In: Aca<strong>de</strong>my of Management Journal 21,<br />
989-1010 (zitiert nach Hampson/ Junor 2005)<br />
349
Muller, Michael (1991): PICTIVE – an exploration on Participatory Design. In:<br />
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing<br />
Systems. New Orleans: ACM Press, 225-231<br />
Muller, Michael (2003): Participatory Design. The third Space of HCI. In: Jacko, Julie/<br />
Sears, Andrew (Eds.): The Human-Computer Interaction Handbook. Mawah, NJ:<br />
Lawrence Erlbaum, 1051-1068<br />
Mumford, Enid (1987): Sociotechnical Systems Design. In: Bjerknes, Gro/ Ehn, Pelle/<br />
Kyng, Pelle (Eds.): Computers and Democracy: A Scandinavian Challenge.<br />
Al<strong>de</strong>rshot. Avebury, 59-76<br />
Nake, Frie<strong>de</strong>r/ Rolf, Arno/ Siefkes, Dirk (Hg.) (2001): Informatik. Aufregung zu <strong>einer</strong><br />
Disziplin. Arbeitstagung mit ungewissem Ausgang in Heppenheim 2001, Bericht<br />
235, Fachbereich Informatik <strong>de</strong>r Universität Hamburg<br />
Nake, Frie<strong>de</strong>r/ Rolf, Arno/ Siefkes, Dirk (Hg.) (2002): Wozu Informatik? Theorie<br />
zwischen I<strong>de</strong>ologie, Utopie und Phantasie. Bericht Nr. 2002-25 <strong>de</strong>r Fakultät IV,<br />
Elektrotechnik und Informatik, <strong>de</strong>r Technischen Universität Berlin<br />
Nake, Frie<strong>de</strong>r/ Rolf, Arno/ Siefkes, Dirk (Hg.) (2004): Informatik zwischen Konstruktion<br />
und Verwertung. Bericht Nr. 01/04 <strong>de</strong>s Fachbereichs Mathematik & Informatik <strong>de</strong>r<br />
Universität Bremen, 14-19<br />
Nardi, Bonnie A./ Engeström, Yrjö (1999): A Web on the Wind. The Structure of<br />
Invisible Work. Introduction to the Special Issue. In: Computer Supported<br />
Cooperative Work 8, 1-8<br />
Nass, Clifford/ Moon, Youngme/ Morkes, John/ Kim, Eun-Young/ Fogg, B. J. (1997):<br />
Computers are social actors: A review of current research. In Friedman, Batya<br />
(Ed.): Moral and ethical issues in human-computer interaction. Stanford, CA:<br />
CSLI Press, 137-162<br />
Neumann, John von (1958): The Computer and the Brain. New Haven: Yale University<br />
Press<br />
Nicoleyczik, Katrin (2004): NormKörper: „Geschlecht“ und „Rasse“ in biomedizinischen<br />
Bil<strong>de</strong>rn. In: Schmitz, Sigrid/ Schinzel, Britta (2004): Grenzgänge.<br />
Gen<strong>de</strong>rforschung in Informatik und Naturwissenschaften. Königstein/ Taunus:<br />
Ulrike Helmer, 133-148<br />
Nie<strong>de</strong>rsächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Hg.) (1994):<br />
Frauenför<strong>de</strong>rung ist Hochschulreform – Frauenforschung ist Wissenschaftskritik.<br />
Bericht <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rsächsischen Kommission zur För<strong>de</strong>rung von Frauenforschung<br />
und zur För<strong>de</strong>rung von Frauen in Forschung und Lehre. Hannover<br />
Nielsen, Jakob (1994): Usability Engineering. San Franscisco: Morgan Kauffmann<br />
Publishers<br />
Nielsen, Jakob/ Loranger, Hoa (2006): Web Usability. München: Addison-Wesley<br />
Norman, Donald (2004): Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things.<br />
New York: Basic Books<br />
350
Norman, Donald/ Draper, Stephen (1986): User Centered System Design: New<br />
Perspectives on Human-computer Interaction. Hillsdale, NJ/ London: Lawrence<br />
Erlbaum<br />
Nowak, Kristine/ Rauh, Christian (2005): The Influence of the Avatar on Online<br />
Perceptions of Anthropomorphism, Androgyny, Credibility, Homophily, and<br />
Attraction. In: Journal of Computer-Mediated Comunication 11/1, Article 8<br />
Nussbaum, Martha (2001): Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. New<br />
York: Cambridge University Press<br />
obn (o.J.): www.obn.org (letzter Zugriff am 11.05.08)<br />
Oechtering, Veronika/ Winker, Gabriele (Hg.) (1998): Computerplätze Frauennetze.<br />
Frauen in <strong>de</strong>r Informationsgesellschaft. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich<br />
Oost, Ellen van (1995): Over ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ dingen. In: Brouns, Margo/<br />
Verloo, Mieke/ Grünell, Marianne (Eds.): Vrouwenstudien in <strong>de</strong> jaren negentig, ee<br />
kennismaking vanuit verschillen<strong>de</strong> disciplines. Busson: Coutinho, 287-312 (zitiert<br />
nach Rommes 2002)<br />
Oost, Ellen van (2000): Making the Computer Masculine. In: Balka, Ellen/ Smith,<br />
Richard (Eds.): Women, Work and Computerization. Boston/ Dordrecht/<br />
London:Kluwer, 9-16<br />
Oost, Ellen van (2003): Materialized Gen<strong>de</strong>r: How Shavers Configure the Users’<br />
Femininity and Masculinity. In: Oudshoorn, Nelly/ Pinch, Trevor (Eds.): How<br />
Users Matter. The Co-Construction of Users and Technology. Cambridge, Ma.:<br />
MIT Press, 193-208<br />
Orland, Barbara/ Rössler, Mechthild (1995): Women in Science – Gen<strong>de</strong>r in Science.<br />
Ansätze feministischer Naturwissenschaftskritk im Überblick. In: Orland, Barbara/<br />
Scheich, Elvira (Hg.): Das Geschlecht <strong>de</strong>r Natur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 13-<br />
63<br />
Orr, Julian (1996): Talking about Machines. An Ethnography of the Mo<strong>de</strong>rn Job. Ithica,<br />
N.Y.: ILR Press<br />
Ortony, Andrew (2002): On making believable emotional agents believable. In: Trappl,<br />
Robert/ Petta, Paolo/ Payr, Sabine (Eds.) (2002): Emotions in Humans and<br />
Artifacts. Cambridge, Ma.: MIT Press, 189-211<br />
Ortony, Andrew / Clore, Gerald/ Collins, Andrew (1988): The Cognitive Structure of<br />
Emotions. Cambridge, Ma.: Cambridge University Press<br />
Oudshoorn, Nelly (1996): Gen<strong>de</strong>rscripts en technologie. Noodslot of uitdaging? In:<br />
Tijdschrift voor Vrouwenstudies 4, 350-367 (zitiert nach Rommes 2002)<br />
Oudshoorn, Nelly/ Pinch, Trevor (Eds.) (2003a): How Users matter. The Co-<br />
Construction of Users and Technology. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Oudshoorn, Nelly/ Pinch, Trevor (2003b): Introduction. How Users and Non-Users<br />
Matter. In: dies. (Eds.): How Users matter. The Co-Construction of Users and<br />
Technology, Cambridge, Ma.: MIT Press, 1-25<br />
351
Oudshoorn, Nelly/ Rommes, Els/ Stienstra, Marcelle (2004): Configuring the User as<br />
Everybody: Gen<strong>de</strong>r and the Design Cultures in Information and Communication<br />
Technologies. In: Science, Technology & Human Values 29/1, 30-63<br />
Pain, Den/ Owen, Jenny/ Franklin, Ian/ Green, Eileen (1993): Human-Centered<br />
Systems Design: A Review of Trends within the Broa<strong>de</strong>r Systems Development<br />
Context. In: Green, Eileen/ Owen, Jenny/ Pain, Den (Eds.): Gen<strong>de</strong>red by<br />
Design? Information Technology and Office Systems. London/ Washington, D.C.:<br />
Taylor & Francis, 11-30<br />
Paiva, Ana (2000): Affective Interactions: Towards a New Generation of Computer<br />
Interfaces. Berlin: Springer<br />
Parnas, David (1990): Education for Computer Professionals. In: IEEE Computer 23/1,<br />
17-22<br />
Paulitz, Tanja (2005): Netzsubjektivitäten. Konstruktion von Vernetzung als<br />
Technologien <strong>de</strong>s Selbst. Münster: Westfälisches Dampfboot<br />
Paulitz, Tanja/ Weber, Susanne (1999): Die Re<strong>de</strong> über Netze. In: Drossou, Olga/ van<br />
Haar<strong>de</strong>n, Kurt/ Hensche, Detlev (Hg.): Machtfragen <strong>de</strong>r Informationsgesellschaft.<br />
Marburg: BdWi, 285-298<br />
Pease, Allan/ Pease, Barbara (2000): Warum Männer nicht zuhören und Frauen<br />
schlecht einparken. Ganz natürliche Erklärungen für eigentlich unerklärliche<br />
Schwächen. München: Ullstein<br />
Picard, Rosalind (1997): Affective Computing. Cambridge, Ma: MIT Press<br />
Picard, Rosalind (2002): What Does it Mean for a Computer to “Have” Emotions? In:<br />
Trappl, Robert/ Petta, Paolo/ Payr, Sabine (Eds.): Emotions in Humans and<br />
Artifacts. Cambridge, Ma.: MIT Press, 213-235<br />
Pinch, Trevor J./ Bijker, Wiebe E. (1987): The Social Construction of Facts and<br />
Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology<br />
Might Benefit of Each Other, in: Bijker, Wiebe E./ Hughes, Thomas P./ Pinch,<br />
Trevor J. (Eds.): The Social Construction of Technological Systems. Cambridge,<br />
Mass.: MIT Press, 17-50.<br />
Polanyi, Michael (1985): Implizites Wissen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp<br />
Preece, Jennifer/ Rogers, Yvonne/ Sharp, Helen (2002): Interaction Design. Beyond<br />
Human-Computer Interaction. New York: John Wiley & Sons<br />
Preece, Jennifer/ Rogers, Yvonne/ Sharp, Helen (2007): Interaction Design. Beyond<br />
Human-Computer Interaction. 2nd Ed. New York: John Wiley & Sons<br />
Preim, Bernhard (1999): Entwicklung interaktiver Systeme: Grundlagen, Fallbeispiele<br />
und innovative Anwendungsfel<strong>de</strong>r. Berlin: Springer<br />
Pritsch, Sylvia (2000): Marianne meets Lara Croft. Weibliche Allegorien nationaler und<br />
transnationaler I<strong>de</strong>ntitäten. In: iz3w. Juli, 42-46<br />
Pruitt, John/ Adlin, Tamara (2006): The Personae Lifecycle. Keeping People in Mind<br />
throughout Product Design. San Francisco: Morgan Kauffmann<br />
352
Quaiser-Pohl, Claudia/ Jordan, Kirsten (Hg.) (2004): Warum Frauen glauben, sie<br />
könnten nicht einparken – und Männer ihnen Recht geben. Über Schwächen, die<br />
gar keine sind. München: Beck<br />
Rainfurth, Claudia (2006): Fallbeispiel „Entwicklung eines Pflegeroboters“. In: Bührer,<br />
Susanne/ Schraudner, Martina (Hg.): Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r Forschung. Wie<br />
können Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt und bewertet wer<strong>de</strong>n?<br />
Karlsruhe : Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, 115-120<br />
Rammert, Werner (1998): Technikvergessenheit <strong>de</strong>r Soziologie? Eine Erinnerung als<br />
Einleitung. In: <strong>de</strong>rs. (Hrsg.): Technik und Sozialtheorie. Frankfurt a.M.: Campus,<br />
9-28<br />
Rammert, Werner (2007): Technografie trifft Theorie: Forschungsperspektiven <strong>einer</strong><br />
Soziologie <strong>de</strong>r Technik. TUTS Working Paper 1-2007, Technische Universität<br />
Berlin, Institut für Soziologie, Fachgebiet Techniksoziologie, zitiert nach www2.tuberlin.<strong>de</strong>/~soziologie/Tuts/Wp/TUTS_WP_1_2007.pdf<br />
(letzter Zugriff am<br />
24.2.2009)<br />
Rammert, Werner/ Schlese, Michael/ Wagner, Gerald/ Wehner, Josef/ Weingarten,<br />
Rüdiger (1998): Wissensmaschinen. Soziale Konstruktion eines technischen<br />
Mediums. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Rammert, Werner/ Schulz-Schaeffer, Ingo (Hg.) (2002a): Können Maschinen han<strong>de</strong>ln?<br />
Soziologische Beiträge zum Verhältnis von Mensch und Technik. Frankfurt a.M./<br />
New York: Campus<br />
Rammert, Werner/ Schulz-Schaeffer, Ingo (2002b): Technik und Han<strong>de</strong>ln. Wenn<br />
soziales Han<strong>de</strong>ln sich auf menschliches Verhalten und technische Abläufe<br />
verteilt. In: dies. (Hg.): Können Maschinen han<strong>de</strong>ln? Soziologische Beiträge zum<br />
Verhältnis von Mensch und Technik. Frankfurt a.M./ New York: Campus, 11-64<br />
Rammert, Werner/ Schubert, Cornelius (Hg.) (2006): Technografie. Zur Mikrosoziologie<br />
<strong>de</strong>r Technik. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Rasmussen, Bente (1997): Girls and Computer Science. “It’s not me. I’m not interested<br />
in sitting behind a machine all day” In: Grundy, Frances/ Köhler, Doris/<br />
Oechtering, Veronika/ Petersen, Ute (Eds.): Women, Work and Computerization.<br />
Proceedings of the 6th International IFIP-Conference. Berlin/ Hei<strong>de</strong>lberg/ New<br />
York, 379-386<br />
Reeves, Byron/ Nass, Clifford (1996): The Media Equation. How people treat<br />
Computers, Television, and New Media like Real People and Places. Chicago:<br />
University of Chicago Press<br />
Reiche, Claudia/ Sick, Andrea (Hg.) (2002): Technics of Cyberfeminism.<br />
Bremen: Thealit<br />
Reid, Elisabeth (1994): I<strong>de</strong>ntity and the Cyborg Body. In: Cultural Formations in Text-<br />
Based Virtual Realities (Thesis at Cultural Studies Program, Department of<br />
English, University of Melbourne, January 1994), 75-95, zitiert nach:<br />
http://www.zacha.net/articles/reid.html (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
353
Reinecke, Leonard/ Trepte, Sabine/ Behr, Katharina-Maria (2007): Why Girls Play.<br />
Results of a Qualitative Interview Study with Female Vi<strong>de</strong>o Game Players.<br />
Hamburger Forschungsbericht zur Sozialpsychologie, 77. Hamburg: Universität<br />
Hamburg, Arbeitsbereich Sozialpsychologie., zitiert nach http://www.unihamburg.<strong>de</strong>/fachbereiche-einrichtungen/fb16/absozpsy/HAFOS_77.pdf<br />
(letzter<br />
Zugriff am 25.2.2009)<br />
Reisin, Fanny-Michaela (1988a): Menschenzentrierte Softwareentwicklung. Ein<br />
weibliches Anliegen. In: Schöll, Ingrid/ Küller, Ina (Hg.): Micro sisters.<br />
Digitalisierung <strong>de</strong>s Alltags – Frauen und Computer. Berlin: Elefantenpress, 63-66<br />
Reisin, Fanny-Michaela (1988b): STEPS – Auf neuen Wegen <strong>de</strong>r Softwaretechnik. In:<br />
Kitzing, Rudolf/ Lin<strong>de</strong>r-Kostka, Ursula/ Obermeier, Fritz (Hg.): Schöne neue<br />
Computerwelt. Zur gesellschaftlichen Verantwortung <strong>de</strong>r Informatiker. Berlin.<br />
Elefantenpress, 111-114<br />
Richard, Birgit (2004): Sheroes. Gen<strong>de</strong>rspiele im virtuellen Raum. Bielefeld: Transcript<br />
Richard, Birgit (o.J.): Girls who got the game. Die Konstruktion von weiblichen<br />
Repräsentationsbil<strong>de</strong>rn in Computerspielen. Unveröffentlichter Abschlussbericht<br />
<strong>de</strong>s 1999-2001 vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst<br />
geför<strong>de</strong>rten Forschungsprojekts<br />
Robinson, Mike (1991): Computer supported co-operative work. Cases and concepts.<br />
In: Hendriks, Paul (Ed.): Groupware ’91 Proceedings. Utrecht: SERC, 1-27<br />
Rohracher, Harald (Ed.) (2005): User Involvement in Innovation Processes. Strategies<br />
and Limitations from a Socio-Technical Perspective. München/ Wien: Profil<br />
Rohracher (2006): The Mutual Shaping of Design and Use. Innovations for Sustainable<br />
Buildings as a Process of Social Learning. München/ Wien: Profil<br />
Roloff, Christine (1989): Von <strong>de</strong>r Schmiegsamkeit zur Einmischung.<br />
Professionalisierung <strong>de</strong>r Chemikerinnen und Informatikerinnen. Pfaffenweiler:<br />
Centaurus<br />
Rommes, Els (2000): Gen<strong>de</strong>red User Representations. Design of a Digital City’. In:<br />
Balka, Ellen/ Smith, Richard (Eds.): Women, Work, and Computerization.<br />
Charting a Course to the Future. Boston/ Dordrecht/ London:Kluwer, 137-145<br />
Rommes, Els (2002): Gen<strong>de</strong>r Scripts and the Internet. The Design and Use of<br />
Amsterdam's Digital City. Ensche<strong>de</strong>: Twente University Press<br />
Rommes, Els (2004): Gen<strong>de</strong>r Sensitive Design Methods. In: Faulkner, Wendy (2004):<br />
Strategies of Inclusion. Gen<strong>de</strong>r and the Information Society. Final Report.<br />
Edinburgh: University of Edinburgh, 54-57<br />
Rommes, Els/ van Oost, Ellen/ Oudshorn, Nelly (1999): Gen<strong>de</strong>r in the Design of the<br />
Digital City of Amsterdam. In: Information, Communication & Society 2/4, 476-<br />
495<br />
354
Rossiter, Margaret (1993): The Matilda Effect in Science. In: Social Studies of Science<br />
23, 325-341<br />
Rosson, Mary/ Carroll, John (2002): Usabilitiy Engineering. Scenario-based<br />
Development of Human-Computer Interaction. San Francisco: Morgan Kaufmann<br />
Rübenstrunk, Gert (1998): Emotionale Computer, zitiert nach<br />
http://www.ruebenstrunk.<strong>de</strong>/emocompstart.htm (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Ruiz Ben, Esther (2004): Arbeit und Geschlecht in <strong>de</strong>r Informatik. Expertise im Rahmen<br />
<strong>de</strong>s vom BMBF geför<strong>de</strong>rten Projekts GENDA – Netzwerk feministische<br />
Arbeitsforschung. Marburg, zitiert nach http://www.gendanetz.<strong>de</strong>/files/<br />
document49.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Ruttkay, Zsófia/ Pelachaud, Catherine (Eds.) (2004): From Brows to Trust. Evaluating<br />
Embodied Conversational Agents. Dordrecht/ Boston/ London: Kluwer<br />
Russell, Stuart/ Norvig, Peter (1995): Artificial Intelligence. A Mo<strong>de</strong>rn Approach. Upper<br />
Saddle River, NJ: Prentice Hall<br />
Saupe, Angelika (1998): Mythos Cyborg – Zur Politik <strong>de</strong>r Dekonstruktion<br />
technologischer Rationalität. In: Freiburger FrauenStudien 4/1, 167-188<br />
Saupe, Angelika (2002): Verlebendigung <strong>de</strong>r Technik. Perspektiven im feministischen<br />
Technikdiskurs. Bielefeld: Kleine Verlag<br />
Schachtner, Christina/ Winker, Gabriele (Hg.) (2005): Virtuelle Räume - neue<br />
Öffentlichkeiten. Frauennetze im Internet. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Schaffert, Sebastian/ Bry, François/ Baumeister, Joachim/ Kiesel, Malte (2007):<br />
Semantic Wiki. In: Informatik Spektrum 30/6, 434-439<br />
Schavan, Annette (2007): Der feine Unterschied. In: Die ZEIT 17, 19.4.2007<br />
Scheich, Elvira (1993): Naturbeherrschung und Weiblichkeit: Denkformen und<br />
Phantasmen <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Naturwissenschaften. Pfaffenweiler: Centaurus<br />
Schelhowe, Heidi (Hg.) (1989a): Frauenwelt-Computerräume. Berlin, Hei<strong>de</strong>lberg:<br />
Springer<br />
Schelhowe, Heidi (1989b): Frauenspezifische Zugänge zur und Umgangsweisen mit<br />
Computertechnologie. Werkstattbericht Nr. 74 <strong>de</strong>s Ministeriums für Arbeit,<br />
Gesundheit und Soziales <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf<br />
Schelhowe, Heidi (1993): Frauenforschung kann nicht in <strong>de</strong>r Pflege <strong>einer</strong> weiblichen<br />
Informatikkultur bestehen. Einige Thesen zur Dekonstruktion liebgewonnener<br />
Vorurteile. In: InfoTech 5/3, 11-14<br />
Schelhowe, Heidi (1997): Das Medium aus <strong>de</strong>r Maschine. Zur Metamorphose <strong>de</strong>s<br />
Computers. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Schelhowe, Heidi (2001): Offene Technologie – offene Kulturen. Zur Gen<strong>de</strong>rfrage im<br />
Projekt Virtuelle Frauenuniversität (vifu): In: FIfF-Kommunikation 3, 14-18<br />
Schelhowe, Heidi (2004): Paradigms of Computing Science: The Necessity for<br />
Methodological Diversity: In: Gen<strong>de</strong>r, Technology and Development 3, 321-334<br />
355
Schelhowe, Heidi/ Büschenfeldt, Maika/ Zorn, Isabel (2005): Das Sekretariat-<br />
Assistenz-Netzwerk (S-A-N) als Beispiel <strong>einer</strong> webgestützten Plattform für eine<br />
"Community of Practice". In: Impulse aus <strong>de</strong>r Forschung Universität Bremen, 10-<br />
13<br />
Schiebinger, Londa (1999): Frauen forschen an<strong>de</strong>rs. Wie weiblich ist die<br />
Wissenschaft? München: Beck (im. Orig.: Has Feminism Changed Science?<br />
Cambridge, Ma.:Harvard University Press)<br />
Schiersmann, Christiane (1987): Computerkultur und weiblicher<br />
Lebenszusammenhang. Zugangsweisen von Frauen und Mädchen zu neuen<br />
Technologien (hrsg. vom Bun<strong>de</strong>sministerium für Bildung und Wissenschaft) Bad<br />
Honnef: Bock<br />
Schinzel, Britta (1992): Informatik und weibliche Kultur. In: Coy, Wolfgang/ Nake,<br />
Frie<strong>de</strong>r/ Pflüger, Jörg-Martin / Rolf, Arno / Seetzen, Jürgen/ Siefkes, Dirk/<br />
Stransfeld, Reinhard (Hg.): Sichtweisen <strong>de</strong>r Informatik. Braunschweig: Vieweg,<br />
249-275<br />
Schinzel, Britta (1993): Warum Frauenforschung in Naturwissenschaft und Technik?<br />
Bericht 4/1993 <strong>de</strong>s Instituts für Informatik und Gesellschaft <strong>de</strong>r Albrecht-Ludwigs-<br />
Universität Freiburg<br />
Schinzel, Britta (1999): Informatik, vergeschlechtlicht durch Kultur und Strukturen,<br />
ihrerseits vergeschlechtlichend durch die Gestaltung ihrer Artefakte. In: Janshen,<br />
Doris (Hg.): Frauen über Wissenschaften. Weinheim/ München: Juventa, 61-81<br />
Schinzel, Britta (2000): Cross Country Computer Science Stu<strong>de</strong>nts’ Study. In: CD<br />
Proceedings of the Women, Work and Computerization Conference 2000.<br />
Vancouver<br />
Schinzel, Britta/ Kleinn, Karin/ Wegerle, Andrea/ Zimmer, Christine (1998): Das<br />
Studium <strong>de</strong>r Informatik aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r Stu<strong>de</strong>ntinnen und Stu<strong>de</strong>nten. In:<br />
Zeitschrift für Frauenforschung 16/3, 76-93<br />
Schinzel, Britta/ Papart, Nadja/ Westermayer, Til (1999): Informatik und<br />
Geschlechterdifferenz. Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft.<br />
Tübingen: Universität Tübingen<br />
Schl<strong>einer</strong>, Anne-Marie (2001): Does Lara Croft Wear Fake Polygons? Gen<strong>de</strong>r and<br />
Gen<strong>de</strong>r-Subversions in Computer Adventure Games. In: Leonardo 34/3, 221-227<br />
Schmidt, Kjeld/ Bannon, Liam (1992): Taking CSCW seriously: Supporting Articulation<br />
Work. In: Computer Supported Cooperative Work 1, 7-41<br />
Schmitt, Bettina (1993): Neue Wege – Alte Barrieren. Beteiligungschancen von Frauen<br />
in <strong>de</strong>r Informatik. Berlin: Edition Sigma<br />
Schmitz, Sigrid (1997): Gen<strong>de</strong>r-Related Strategies in Environmental Development:<br />
Effects of Anxiety on Wayfinding in and Representation of a Tree-Dimensional<br />
Space. In: Journal of Environmental Psychology 17, 215-228<br />
356
Schmitz, Sigrid (2003): Neue Körper, neue Normen? Der verän<strong>de</strong>rte Blick durch biomedizinische<br />
Körperbil<strong>de</strong>r. In: Weber, Jutta/ Bath, Corinna (Hrsg.): Turbulente<br />
Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur<br />
Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske+Budrich<br />
Schmitz, Sigrid (2004): Wie kommt das Geschlecht ins Gehirn? In: Forum<br />
Wissenschaft 21/4, 9-13<br />
Schmitz, Sigrid/ Schinzel, Britta (Hg.) (2004): Grenzgänge. Gen<strong>de</strong>rforschung in<br />
Informatik und Naturwissenschaften. Königstein/ Taunus: Ulrike Helmer Verlag<br />
Schmitz, Sigrid/ Nikoleyczik, Katrin (2004) Angst im Raum? Schicksal o<strong>de</strong>r Erfahrung.<br />
In: Quaiser-Pohl, Claudia/ Jordan, Kirsten (Hg.): Warum Frauen glauben, sie<br />
könnten nicht einparken – und Männer ihnen Recht geben. Über Schwächen, die<br />
gar keine sind. München: Beck, 158-169<br />
Schön, Donald (1983): The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action.<br />
New York: Basic Books<br />
Schraudner, Martina (2006): Beispiele für Gen<strong>de</strong>r- und Diversity-Aspekte. In: Bührer,<br />
Susanne/ Schraudner, Martina (Hg.): Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r Forschung. Wie<br />
können Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in Forschungsvorhaben erkannt und bewertet wer<strong>de</strong>n?<br />
Karlsruhe: Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, 5-10<br />
Schraudner, Martina/ Lukoschat, Helga (Hg.) (2006): Gen<strong>de</strong>r als Innovationspotential<br />
in Forschung und Entwicklung. München: Fraunhofer Institut für System- und<br />
Innovationsforschung<br />
Schroe<strong>de</strong>r, Ralph (2002): Social interaction in virtual environments: Key issues,<br />
common themes, and a framework for research. In: Schroe<strong>de</strong>r, Ralph (Ed.): The<br />
Social Life of Avatars. Presence and Interaction in Virtual Environments. London:<br />
Springer, 1-18<br />
Schuler, Douglas/ Namioka, Aki (Eds.) (1993): Participatory Design. Principles and<br />
Practices. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum<br />
Schulz-Schaeffer, Ingo (1994): Informatik als Designwissenschaft. techniksoziologische<br />
Überlegungen zur Entwicklung gestaltungsorientierter Konstruktionsstile im<br />
Software-Engineering. In: Hellige, Hans Dieter (Hg.): Leitbil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Informatik-<br />
und Computer-Entwicklung. Artec-Paper Nr. 33. Forschungszentrum Arbeit und<br />
Technik. Universität Bremen, 277-303<br />
Schwartz Cowan, Ruth (1983): More work for Mother. The Ironies of Household<br />
Technology from the Open Hearth to the Microwave. New York: Basic Books<br />
Schwartz Cowan, Ruth (1985): The industrial revolution of the home. In: McKenzie,<br />
Donald/ Wajcman, Judy (Eds.): The Social Shaping of Technology. How the<br />
Refrigerator Gots its Hum. Milton Keynes, Phila<strong>de</strong>lphia: Open University Press,<br />
181-201<br />
Schwarze, Barbara/ David, Michaela/ Belker, Bettina Charlotte (2008): Gen<strong>de</strong>r und<br />
Diversity in Ingenieurwissenschaften und Informatik: Praxiskonzepte in Lehre und<br />
Forschung. Bielefeld: Universitätsverlag Webler<br />
357
Sengers, Phoebe (2003): The engineering of experience. In: Blythe, Mark/ Monk,<br />
Andrew/ Overbeeke, Kees/ Wright, Peter (Eds.): Funology. From Usability to<br />
Enjoyment. Dordrecht u.a.: Kluwer, 19-29<br />
Sengers, Phoebe (2005): Reflective Design and HCI. Interview geführt von Mads<br />
Bødker, zitiert nach http://www1.itu.dk/sw39318.asp (letzter Zugriff am 8.10.08)<br />
Sengers, Phoebe/ Liesendahl, Rainer/ Magar, Werner/ Seibert, Christoph/ Müller,<br />
Boris/ Joachims, Thorston/ Geng, Weidong/ Mårtensson, Pia/ Höök, Kristina<br />
(2002): The Enigmatics of Affect. In: Proceedings of the 4th conference on<br />
Designing interactive systems (DIS ‘02), 87-98<br />
Sengers, Phoebe/ Boehner, Kirsten/ Gay, Geri/ Kaye, Joseph ‚Jofish’/ Mateas, Michael/<br />
Gaver, Bill/ Höök, Kristina (2004): Experience as Interpretation. In: Paper at the<br />
CHI 2004 Workshop “Cross-dressing and bor<strong>de</strong>r crossing: exploring experience<br />
methods across disciplines”, zitiert nach http://www.sfu.ca/~rwakkary/<br />
chi2004_workshop/ (letzter Zugriff am 13.6.2008)<br />
Sengers, Phoebe/ Kirsten Boehner/ Shay David/ Joseph ‚Jofish’ Kaye (2005):<br />
Reflective Design. In: Bertelsen, Olav W./ Bouvin, Niels Olof/ Krogh, Peter G./<br />
Kyng, Morten (Eds.): Critical Computing – Between Sense and Sensibility. Red<br />
Hook, N.Y: Aarhus: Curran, 49-58<br />
Shannon, Clau<strong>de</strong>/ Weaver, Warren (1963): The mathematical theory of<br />
communication. Urbana/ Chicago: University of Illinois Press<br />
Shapin, Steven (1989): The Invisible Technician. In: American Scientist 77, 554-563<br />
Sharp, Darren/ Salomon, Mandy (2008): User-led Innovation. A New Framework for<br />
Co-creating Business and Social Value, zitiert nach<br />
http://smartinternet.com.au/ArticleDocuments/121/User_Led_Innovation_A_New<br />
_Framework_for_Co-creating_Business_and_Social_Value.pdf.aspx (letzter<br />
Zugriff am 18.2.2009)<br />
Sherron, Catherine (2000): Constructing Common Sense. In: Balka, Ellen/ Smith,<br />
Richard (Eds.): Women, Work and Computerization. Boston/ Dordrecht/ London:<br />
Kluwer, 111-118<br />
Shnei<strong>de</strong>rman, Ben (2000): Universal Usability. In: Communications of the ACM 43/5,<br />
84-91<br />
Siefkes, Dirk/ Eulenhöfer, Peter/ Stach, Heike/ Städtler, Klaus (1998): Sozialgeschichte<br />
<strong>de</strong>r Informatik. Kulturelle Praktiken und Orientierungen. Wiesba<strong>de</strong>n: Deutscher<br />
Universitätsverlag<br />
Singer, Mona (1998): Technologik und Geschlechtsi<strong>de</strong>ntität. Fragen feministischer<br />
Technikkritik. In: Hug, Theo (Hg.): Technologiekritik und Medienpädagogik.<br />
Baltmannsweiler: Schnei<strong>de</strong>r<br />
Singer, Mona (2003): Wir sind immer mittendrin. Technik und Gesellschaft als<br />
Koproduktion. In: Graumann, Sigrid/ Schnei<strong>de</strong>r, Ingrid (Hg.): Verkörperte Technik<br />
– Entkörperte Frau. Frankfurt/ New York: Campus, 110-124<br />
358
Singer, Mona (2004): The truth is not out there. Konstruktivismus, Realismus und<br />
Technowissenschaften. In: Helduser, Urte/ Marx, Daniela/ Paulitz, Tanja/ Pühl,<br />
Katharina (Hg.): un<strong>de</strong>r construction? Konstruktivistische Perspektiven in<br />
feministischer Theorie und Forschungspraxis. Frankfurt a.M./ New York:<br />
Campus, 80-90<br />
Singer, Mona (2005): Geteilte Wahrheit. Feministische Epistemologie,<br />
Wissenssoziologie und Cultural Studies. Wien: Löcker<br />
Sollfrank, Cornelia (1999): Female Extension. In: netz.kunst. Jahrbuch ’98/’99 <strong>de</strong>s<br />
Instituts für mo<strong>de</strong>rne Kunst Nürnberg<br />
Sørensen, Knut (2004): Cultural Politics of Technology: Combining Critical and<br />
Constructive Interventions? In: Science, Technology & Human Values 29/2, 184-<br />
190<br />
Soufoulis, Zoe (2002): Cyberquake – Haraways Manifesto. In: Zentrum für<br />
interdisziplinäre Geschlechterforschung (Hg.): Cyberfeminismus. Feministische<br />
Visionen mit Netz und ohne Bo<strong>de</strong>n? Bulletin Texte 24, HU Berlin, 54-72<br />
Stach, Heike (2001): Zwischen Organismus und Notation. Zur kulturellen Konstruktion<br />
<strong>de</strong>s Computer-Programms. Wiesba<strong>de</strong>n: Deutscher Universitätsverlag<br />
Star, Susan Leigh (1991a): Invisible Work and Silenced Dialogs in Knowledge Representation.<br />
In: Eriksson/ Inger V./ Kitchenham, Barbara A./ Tij<strong>de</strong>ns, Kea G. (Eds.):<br />
Women, Work and Computerization. Amsterdam:North Holland, 81-92<br />
Star, Susan Leigh (1991b): Power, technology and the phenomenology of conventions:<br />
On being allergic to onions In: Law, John (Ed.): A Sociology of monsters. Essays<br />
on power, technology, and domination. London/ New York: Routledge, 26-56<br />
Star, Susan Leigh (1994): Misplaced Concretism and Concrete Situations. Feminism,<br />
Method and Information Technology. In: Gen<strong>de</strong>r-Nature-Culture Feminist<br />
Research Network, Working Paper 11, O<strong>de</strong>nse University (Zitiert nach Bratteteig/<br />
Verne 1997)<br />
Star, Susan Leigh (1995): The politics of formal representation. In: dies. (Ed.):<br />
Ecologies of Knowledge. New York: State University Press of New York<br />
Star, Susan Leigh (2002): Infrastructure and Ethnographic Practice. Working on the<br />
Fringes. In: Scandinavian Journal of Information Systems 14/2, 107-122<br />
Star, Susan Leigh/ Strauss, Anselm (1999): Layers of Silence, Arenas of Voice: The<br />
Ecology of Visible and Invisible Work. In Computer Supported Cooperative Work<br />
8, 9-30<br />
Steels, Luc/ Brooks, Rodney (Eds) (1995): The `Artificial Life' route to `Artificial<br />
Intelligence'. Building Embodied, Situated Agents. New Haven: Lawrence<br />
Erlbaum Associates<br />
Stein, Lynn Andrea (1999): Challenging the Computational Metaphor: Implications for<br />
how we think. In: Cybernetics and Systems 30, 473-507<br />
359
Stephani<strong>de</strong>s, Constantine (Ed.) (2001): User Interfaces for all. Concepts, Methods, and<br />
Tools. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum<br />
Stewart, James/ Williams, Robin (2005): The Wrong Trousers? Beyond the Design<br />
Fallacy: Social Learning and the User. In: Rohracher, Harald (Ed.): User<br />
Involvement in Innovation Processes. Strategies and Limitations from a Socio-<br />
Technical Perspective. München/ Wien: Profil, 39-71<br />
Stone, Sandy (Allucquere Rosanne) (1991): Will the Real Body Please Stand Up? In:<br />
Benedikt, Michael (Hg.): Cyberspace: First Steps. Cambridge Mass.: MIT Press<br />
Stone, Sandy (Allucquère Rosanne) (1995): The War of Desire and Technology at the<br />
Close of the Mechanical Age. Cambridge, Massachusetts: MIT<br />
Strauss, Anselm (1985): Work and the Division of Labour. In: The Sociological<br />
Quarterly 26, 1-19<br />
Strauss, Anselm (1993): Continual Permutations of Action. New York: Aldine<br />
DeGruyter<br />
Subrahmanyarn, Kavary/ Greenfield, Patricia (1998): Computer Games for Girls: What<br />
makes them play. In: Cassell, Justine/ Jenkins, Henry (Eds.): From Barbie to<br />
Mortal Combat: Further Reflections. Cambridge, Ma.: MIT Press, 46-71<br />
Suchman, Lucy (1987): Plans and Situated Action. The Problem of Human-Machine<br />
Communication. Cambridge: Cambridge University Press<br />
Suchman, Lucy (1994): Do categories have politics? The language/action perspective<br />
reconsi<strong>de</strong>red. In: Computer Supported Cooperative Work 2, 177-190<br />
Suchman, Lucy (1995): Making Work Visible. In: Communications of the ACM 38/9, 56-<br />
63<br />
Suchman, Lucy (1996): Supporting Articulation Work. In Kling, Rob (Ed.):<br />
Computerization and Controversy: Value Conflicts and Social Choices, 2nd<br />
Edition. San Diego: Aca<strong>de</strong>mic Press, 407-423<br />
Suchman. Lucy (2000): Embodied Practices of Engineering Work. In: Mind, Culture,<br />
and Activity 7, 1&2, 4-18<br />
Suchman, Lucy (2002a): Located Accountabilities in Technology Production. In:<br />
Scandinavian Journal of Information Systems 14/2. 91-105 395<br />
Suchman, Lucy (2002b): Replicants and Irreductions. Affective Encounters at the<br />
Interface. Vortrag auf <strong>de</strong>r Tagung <strong>de</strong>r European Association for the Study of<br />
Science and Technology in York, UK am 2. August 2002<br />
Suchman. Lucy (2002c): Human/Machine Reconsi<strong>de</strong>red. Veröffentlicht vom<br />
Department of Sociology, Lancaster University, zitiert nach<br />
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/soc040ls.html (letzter Zugriff am 28.8.02)<br />
395 Frühere Versionen dieses Artikels erschienen unter <strong>de</strong>m Titel „Working Relations of Technology<br />
Production and Use“ in: Computer Supported Cooperative Work, 1994, 2, 21-39 sowie in gekürzter Form<br />
in: MacKenzie, Donald / Wajcman (1999) (Eds.), The Social Shaping of Technology, 2nd Ed. Buckingham,<br />
Phila<strong>de</strong>lphia, 258-265<br />
360
Suchman. Lucy (2003): Figuring ‘Service’ in Discourses of ICT: The Case of Software<br />
Agents. In: Weber, Jutta/ Bath, Corinna (Hg.): Turbulente Körper, soziale<br />
Maschinen. Feministische Studien zur Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n:<br />
Leske + Budrich, 65-74<br />
Suchman. Lucy (2004): Figuring Personhood in the Science of the Artificial. Published<br />
by the Department of Sociology, Lancaster University, zitiert nach<br />
http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/suchman-figuring-personhood.pdf<br />
(letzter Zugriff am 1.11.05)<br />
Suchman. Lucy (2007), Human-Machine Reconfigurations. Plans and Situated Action<br />
2nd Edition, Cambridge: Cambridge University Press<br />
Suchman, Lucy (2008): Feminist STS and the Sciences of the Artificial. In: Hackett,<br />
Edward/ Amsterdamska, Olga/ Lynch, Michael/ Wajcman, Judy (Eds.): The<br />
Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition. Cambridge, Ma.:<br />
MIT Press, 139-163<br />
Suchman, Lucy/ Jordan, Brigitte (1989): Computerization and Women's Knowledge. In:<br />
Tij<strong>de</strong>ns, Kea/ Jennings, Mary/ Wagner, Ina/ Weggelaar, Margaret (Eds.): Women,<br />
Work and Computerization. Amsterdam:, North Holland, 153-160<br />
Teasley, Barbee/ Leventhal, Laura/ Blumenthal, Brad/ Instone, Keith/ Stone, Daryl<br />
(1994): Cultural Diversity in User Interface Design. In: SIGCHI Bulletin 26/1, 36-<br />
40<br />
Temm, Tatiana Butovitsch (2008): If You Meet the Expectations of Women, You<br />
Exceed the Expectations of Men: How Volvo Designed a Car for Women<br />
Customers and Ma<strong>de</strong> World Headlines. In: Schiebinger, Londa (Ed.): Gen<strong>de</strong>red<br />
Innovations in Science and Engineering. Stanford: Stanford University Press,<br />
131-149<br />
Teubner, Ulrike (1997): Ein Frauenfachbereich Informatik an <strong>de</strong>r Fachhochschule<br />
Darmstadt – als Beispiel <strong>einer</strong> paradoxen Intervention. In: Metz-Göckel, Sigrid/<br />
Steck, Felicitas (Hrsg.): Frauenuniversitäten. Initiativen und Reformprojekte im<br />
internationalen Vergleich. Opla<strong>de</strong>n: Leske+Budrich, 114-135<br />
The Virtual Knowledge Studio (2008): Messy Shapes of Knowledge. In: Hackett,<br />
Edward/ Amsterdamska, Olga/ Lynch, Michael/ Wajcman, Judy (Eds.): The<br />
Handbook of Science and Technology Studies. Third Edition, 319-351<br />
Törpel, Bettina (2000). Self-employed labor meets co<strong>de</strong>termination - Participatory<br />
Design in network organizations. In: Cherkasky, Todd/ Greenbaum, Joan/<br />
Mambrey, Peter/ Pors, Jens Kaaber (Eds.): Proceedings of the Participatory<br />
Design Conference, Nov. 28 - Dec. 1, 2000, in New York, NY, USA. Palo Alto,<br />
CA: CPSR Press, 184-191<br />
Törpel, Bettina (2003a): Erzählen von IT-Unterstützung? Vom Umgang mit<br />
fragmentierten Interessen in <strong>de</strong>r Angewandten Informationstechnik. In:<br />
Hirschfel<strong>de</strong>r, Gunther/ Huber, Birgit (Hg.): Die Virtualisierung <strong>de</strong>r Arbeit. Zur<br />
Ethnographie neuer Arbeits- und Organisationsformen. Frankfurt a.M.: Campus,<br />
471-498<br />
361
Törpel, Bettina (2003b): Interest and narration in Applied Information Technology - a<br />
strange combination? Or: From freelancer networks to stories for Participatory<br />
Design. Second Tampere Conference on Narrative, I<strong>de</strong>ology and Myth, June 26-<br />
28, 2003, zitiert nach http://www.uta.fi/conference/narrative/papers.html (letzter<br />
Zugriff am 24.2.2009)<br />
Törpel, Bettina (2004): Narrative Transformation: Designing Work Means by Telling<br />
Stories. In: Bertelsen, Olav W./ Korpela, Mikku/ Mursu, Anja (Eds.): ATIT -<br />
Proceedings of the first International Workshop on Activity Theory based practical<br />
methods for IT <strong>de</strong>sign, 2-3 September 2004, Copenhagen, Denmark. Århus,<br />
Denmark: DAIMI Technical Report #PB-574, 122-133<br />
Törpel, Bettina (2005): Participatory Design: A multi-voiced effort. In: Bertelsen, Olav<br />
W./ Bouvin, Niels Olof / Krogh, Peter G./ Kyng, Morten (Eds.): Critical Computing<br />
– Between Sense and Sensibility. New York: ACM, 177-181<br />
Törpel, Bettina (2007): The politics of the participatory <strong>de</strong>sign game. In: Tiainen, Tarja/<br />
Isomäki, Hannakaisa/ Korpela, Mikko/ Mursu, Anja/ Paakki, Minna-Kristiina<br />
Paakki/ Pekkola, Samuli (Eds.): Proceedings of 30th Information Systems<br />
Research Seminar in Scandinavia, IRIS30 (11.-14.8.2007, Murikka, Tampere,<br />
Finland) - Mo<strong>de</strong>ls, Methods and new messages, Department of Computer<br />
Sciences, University of Tampere, Finland, zitiert nach<br />
http://www.cs.uta.fi/reports/dsarja/D-2007-9.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Törpel, Bettina (2008): Contextual Design in Information Systems – A Participatory<br />
Approach Based on Un<strong>de</strong>rstanding Practices, Meanings and Challenges?<br />
Erscheint in: Proceedings of the Mediterranean Conference of Information<br />
Systems 23-26 October 2008. Hammamet, Tunisia, Paper 16,<br />
http://aisel.aisnet.org/mcis2008/16<br />
Törpel, Bettina/ Poschen, Meik (2002): Improving infrastructures by transforming<br />
narratives. In: Bin<strong>de</strong>r, Thomas/ Gregory, Judith/ Wagner, Ina (Eds.), Proceedings<br />
of the Participatory Design Conference, Malmö, Swe<strong>de</strong>n, 23-25 June 2002. Palo<br />
Alto, CA: Computer Professionals for Social Responsibility, 248-253<br />
Törpel, Bettina/ Wulf, Volker/ Kahler, Helge (2002): Participatory organizational and<br />
technological innovation in fragmented work environments. In: Dittrich, Yvonne/<br />
Floyd, Christiane/ Klischewski, Ralf (Eds.): Social Thinking. Software Practice.<br />
Cambridge: MIT Press, 331-356<br />
Tomkins, Silvan (1962): Affect, Imaginary, Consciousness. The Positive Affects. New<br />
York: Springer<br />
Trappl, Robert/ Petta, Paolo/ Payr, Sabine (Eds.) (2002): Emotions in Humans and<br />
Artifacts. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Traweek, Sharon (1988): Beamtimes and Lifetimes. The World of High Energy<br />
Physicists. Cambridge, Ma.: Harvard University Press<br />
Trepte, Sabine/ Reinecke, Leonard/ Behr, Katharina-Maria (2009): Creating virtual alter<br />
egos or super-heroines? Gamers’ Strategies of Avatar Creation in Terms of<br />
Gen<strong>de</strong>r and Sex. http://www.irma-international.org/viewtitle/3955/<br />
362
Tudor, Leslie Gayle (1993): A participatory <strong>de</strong>sign technique for high-level risk analysis,<br />
critique and redsign. The CARD method. In: Proceedings of the Human Facots<br />
and Ergonomics Society 1993. Seattle, 295-299<br />
Turkle, Sherry (1986 [1984]): Die Wunschmaschine. Der Computer als zweites Ich.<br />
Reinbek: bei Hamburg: Rowohlt (Orig.: The Second Self. Computers and the<br />
Human Spirit. New York: Simon & Schuster)<br />
Turkle, Sherry (1998 [1995]): Leben im Netz. I<strong>de</strong>ntität im Zeitalter <strong>de</strong>s Internet. Reinbek<br />
bei Hamburg: Rowohlt (im. Orig.: Life on the Screen. I<strong>de</strong>ntity in the Age of the<br />
Internet. New York: Simon & Schuster)<br />
Turkle, Sherry / Papert, Seymour (1990): Epistemological Pluralism. Styles and Voices<br />
within the Computer Culture. In: Signs, 128-157<br />
Vehviläinen, Marja (1991): Gen<strong>de</strong>r in Information Systems Development – A Women<br />
Office Worker’s Standpoint. In: Eriksson, Inger V./ Kitchenham, Barbara A./<br />
Tij<strong>de</strong>ns, Kea G. (Hg.): Proceedings of the IFIP-Conference on Women, Work and<br />
Computerization in Helsinki. Amsterdam:, North-Holland , 247-262<br />
Vetter, Danilo (2006): Gen<strong>de</strong>r@Wiki: Zum Entwurf eines Fachwikis <strong>de</strong>r Frauen- und<br />
Geschlechterforschung, zitiert nach http://www2.gen<strong>de</strong>r.huberlin.<strong>de</strong>/gen<strong>de</strong>rwiki/wp-content/uploads/2006/10/Vetter%20Danilo%20-<br />
%20Gen<strong>de</strong>r@Wiki%20-%20Zum%20Entwurf%20eines%20Fachwikis%20….pdf<br />
(letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Viller, Stephen/ Sommerville, Ian (1999): Coherence: an approach to representing<br />
ethnographic analyses to systems <strong>de</strong>sign. In: Human-Computer Interaction 14/1,<br />
9-41<br />
VNS Matrix (1991): Cyberfeminist Manifesto for the 21th Century, zitiert nach<br />
http://sysx.org/vns/ (letzter Zugriff am 11.05.08)<br />
Vosseberg, Karin (2002): Informatica Feminale – ein Beispiel für einen <strong>kritisch</strong>en<br />
transformativen Raum. In: Verein FLuMiNuT (Hg.): Wissen_schaf(f)t Wi<strong>de</strong>rstand.<br />
Dokumentation <strong>de</strong>s 27. Kongresses von Frauen in Naturwissenschaft und<br />
Technik. Wien: Milena, 432-437<br />
Vosseberg, Karin/ Schelhowe, Heidi/ Erb, Ulrike/ Oeltjen, Wiebke/ Zallmann, Margita<br />
(2006): 20 Jahre Frauenforschung in <strong>de</strong>r Informatik – ein subjektiver Blick zurück<br />
und dann nach vorn. In: Frauenarbeit und Informatik 21, Oktober 2006, 22-26<br />
Wächter, Christine (2003): Technik-Bildung und Geschlecht. München, Wien: Profil<br />
Waern, Annika/ Larsson, Anna/ Nerén, Carina (2005): Hypersexual avatars: who wants<br />
them? In: Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on<br />
Advances in computer entertainment technology in Valencia. Spain, 238 - 241<br />
Wagner, Ina (1989): Regulierung von Krankenhausarbeit. Ein Vergleich <strong>de</strong>s<br />
Computereinsatzes in Österreich, Frankreich und <strong>de</strong>n USA aus <strong>de</strong>r Perspektive<br />
<strong>de</strong>r Organisation von Pflegearbeit und Labortätigkeiten. In: Journal für<br />
Sozialforschung 29/2, 165-180<br />
363
Wagner, Ina (1991): Transparenz o<strong>de</strong>r Ambiguität? Kulturspezifische Formen <strong>de</strong>r<br />
Aneignung von Informationstechniken im Krankenhaus. In: Zeitschrift für<br />
Soziologie 20/4, 275-289<br />
Wagner, Ina (1993): Women’s Voice. The Case of Nursing Information Systems. In: AI<br />
& Society 7/4, 295-310<br />
Wagner, Ina (1994): Connecting Communities of Practice: Feminism, Science, and<br />
Technology. In: Women’s Studies International Forum 17/2-3, 257-265<br />
Wajcman, Judy (1994 [1991]): Technik und Geschlecht. Die feministische<br />
Technik<strong>de</strong>batte. Frankfurt a.M.: Campus (im Orig. Feminism confronts<br />
technology. Cambridge, UK: Polity Press)<br />
Wajcman, Judy (2004): TechnoFeminism. Cambridge, UK : Polity Press<br />
Wajcman, Judy (2007): From Women and Technology to Gen<strong>de</strong>red Technoscience. In:<br />
Information, Communication & Society 10/3, 287-298<br />
Weber, Jutta (1998): Feminismus & Konstruktivismus. O<strong>de</strong>r: Verlockungen unendlicher<br />
Rekombination. Zur Netzwerktheorie bei Donna Haraway. In: Das Argument.<br />
Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften 227/5, 699-712<br />
Weber, Jutta (2001): Ironie, Erotik und Techno-Politik. Cyberfeminismus als Virus in<br />
<strong>de</strong>r neuen Weltordnung? In: Die Philosophin 24, 81-97<br />
Weber, Jutta (2003a): Umkämpfte Be<strong>de</strong>utungen. Naturkonzepte im Zeitalter <strong>de</strong>r<br />
Technoscience. Frankfurt a.M.: Campus<br />
Weber, Jutta (2003b): Turbulente Körper und emergente Maschinen. Über<br />
Körperkonzepte in neuerer Robotik und Technokritik. In: Weber, Jutta/ Bath,<br />
Corinna (Hg.): Turbulente Körper, soziale Maschinen. Feministische Studien zur<br />
Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich, 119-136<br />
Weber, Jutta (2003c): Artificial Life und neuere Robotik. In: FIFF-Kommunikation -<br />
Bioinformatik 1, 41-45<br />
Weber, Jutta (2005a): Die Produktion <strong>de</strong>s Unerwarteten. Materialität und Körperpolitik<br />
in <strong>de</strong>r Künstlichen Intelligenz. In: Bath, Corinna/ Bauer, Yvonne/ Bock von<br />
Wülfingen, Bettina/ Saupe, Angelika/ Weber, Jutta (Hg.): Materialität <strong>de</strong>nken.<br />
Studien zur technologischen Verkörperung. Transcript: Bielefeld, 59-83<br />
Weber, Jutta (2005b): Helpless Machines and True Loving Caregivers. A Feminist<br />
Critique of Recent Trends in Human-Robot Interaction. In: Journal of Information,<br />
Communication and Ethics in Society 3/4, Paper 6<br />
Weber, Jutta (2006): Gen<strong>de</strong>r-Aspekte in <strong>de</strong>r Robotik und ECA-Forschung. In: Bath,<br />
Corinna/ Weber, Jutta (Hg.): Sozialität mit Maschinen. Unveröffentlichter<br />
Abschlussbericht zum Forschungprojekt. Wien, 66-88<br />
Weber, Jutta/ Bath, Corinna (Hg.) (2003): Turbulente Körper, soziale Maschinen.<br />
Feministische Studien zur Technowissenschaftskultur. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich<br />
364
Weber, Jutta/ Bath, Corinna (2005): "Social" Robots & "Emotional" Software Agents:<br />
Gen<strong>de</strong>ring Processes and De-gen<strong>de</strong>ring Strategies for "Technologies in the<br />
Making" In: Archibald Jaqueline/ Emms, Judy/ Grundy, Frances/ Payne, Janet/<br />
Turner, Eva (Eds.): The Gen<strong>de</strong>r Politics of ICT. Proceedings of 6th International<br />
Women into Computing Conference 2005, 121-131<br />
Weber, Rachel (1999): Manufactoring Gen<strong>de</strong>r in a military cockpit <strong>de</strong>sign. In: Wajcman,<br />
Judy/ MacKenzie, Donald (Eds.): The Social Shaping of Technology, 2nd Ed.<br />
Buckingham/ Phila<strong>de</strong>lphia:Open University Press, 372-381<br />
Weber-Wulff, Debbie (2000): Combating the Co<strong>de</strong> Warrior: A Different Sort of<br />
Programming Instruction. Proceedings of the ITiCSE 2000, Helsinki Finland, July<br />
11-13, 2000, zitiert nach http://public.tfh-berlin.<strong>de</strong>/~weberwu/papers/sigcsewarrior.htm<br />
(letzter Zugriff am 11.05.08)<br />
Webster, Juliet (1993): From the Word Processor to the Micro: Gen<strong>de</strong>r Issues in the<br />
Development of Information Technology in the Office. In: Green, Eileen/ Owen,<br />
Jenny/ Pain, Den (Eds.): Gen<strong>de</strong>red by Design? Information Technology and<br />
Office Systems. London: Taylor & Francis, 111-123<br />
Webster, Juliet (1995): What do we know about gen<strong>de</strong>r and information technology at<br />
work?. A discussion of selected feminist research. In: The European Journal of<br />
Women’s Studies 2/3, 315-335<br />
Webster, Juliet (1996): Shaping Women’s Work. Gen<strong>de</strong>r, Employment and Information<br />
Technology. London/ New York: Longman<br />
Wegner, Peter (1997): Why interaction is more powerful than algorithms. In:<br />
Communications of the ACM, 80-91<br />
Weizenbaum, Joseph (1994 [1976]): Die Macht <strong>de</strong>r Computer und die Ohnmacht <strong>de</strong>r<br />
Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp (Im Orig.: Computer power and human<br />
reason. San Francisco: W. H. Freeman)<br />
Weller, Ines (2002): Mo<strong>de</strong>llierung und Bilanzierung von Stoffströmen. Gen<strong>de</strong>r als ‚Eye-<br />
Opener’ für Abstraktionen und Entkontextualisierung. In: Zentrum für<br />
feministische Studien (Hg.): Körper und Geschlecht. Bremer-Ol<strong>de</strong>nburger<br />
Vorlesungen zur Frauen- und Geschlechterforschung.Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich,<br />
181-192<br />
West, Candace/ Zimmerman, Don (1987): Doing Gen<strong>de</strong>r. In: Gen<strong>de</strong>r & Society 1, 125-<br />
151<br />
West, Candace/ Fenstermaker, Sarah (1995): Doing Difference. In: Gen<strong>de</strong>r & Society<br />
91, 8-37<br />
Wetterer, Angelika (Hg) (1992): Profession und Geschlecht. Zur Marginalität von<br />
Frauen in hochqualifizierten Berufen. Frankfurt a. M./ New York: Campus<br />
Wetterer, Angelika (Hg) (1995): Die soziale Konstruktion von Geschlecht in<br />
Professionalisierungsprozessen. Frankfurt a. M./ New York: Campus<br />
365
Wharton, Cathleen/ Rieman, John/ Lewis, Clayton/ Polson, Peter (1994): The cognitive<br />
walkthrough method. A practitioner’s gui<strong>de</strong>. In: Nielsen, Jacob/ Mack, Robert L.<br />
(Eds.): Usability Inspection Methods. New York:John Wiley & Sons, 105-140<br />
Wichterich, Christa (1995): Die Rückkehr <strong>de</strong>r weisen Frauen. In: Schultz, Irmgard/<br />
Weller, Ines (Hg.): Gen<strong>de</strong>r & Environment. Ökologie und die Gestaltungsmacht<br />
<strong>de</strong>r Frauen. Frankfurt a.M.: IKO - Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 106-<br />
130<br />
Wiesner, Heike (2002): Die Inszenierung <strong>de</strong>r Geschlechter in <strong>de</strong>n<br />
Naturwissenschaften. Wissenschafts- und Geschlechterforschung im Dialog.<br />
Frankfurt a. M./ New York: Campus<br />
Wiesner, Heike (2004): Handlungsträgerschaft von Robotern. Robotik zur För<strong>de</strong>rung<br />
von Chancengleichheit im schulischen Bildungsbereich. In: Historische<br />
Sozialforschung 29/4, 120-153<br />
Wiesner, Heike (2007): Neue Lehr- und Lernkonzepte in <strong>de</strong>r Wirtschaftsinformatik.<br />
Chancen und Möglichkeiten <strong>einer</strong> geschlechterbewussten Lehrkonzeption im<br />
Themenfeld „Wissensmanagement und eLearning“. In: Cur<strong>de</strong>s, Beate/ Marx,<br />
Sabine / Schleier. Ulrike / Wiesner, Heike (Hg.): Gen<strong>de</strong>r lehren – Gen<strong>de</strong>r lernen<br />
in <strong>de</strong>r Hochschule. Konzepte und Praxisberichte. Ol<strong>de</strong>nburg: BIS-Verlag, 127-<br />
158<br />
Wiesner, Heike (2008): Web 2.0 in Aktion – o<strong>de</strong>r wie verän<strong>de</strong>rn und gen<strong>de</strong>rn WIKIS<br />
Bildungs- und Arbeitskontexte. In: Zeitschrift für Hochschulforschung 3/2, 132-<br />
143<br />
Wiesner, Heike/ Zorn, Isabel/ Schelhowe, Heidi/ Baier, Barbara/ Ebkes, Ida (2004a):<br />
Gen<strong>de</strong>raspekte im E-Learning. In: Bildungsserver Hessen, zitiert nach<br />
http://lernarchiv.bildung.hessen.<strong>de</strong>/medien/medienkompetenz/gen<strong>de</strong>r/e-Learning/<br />
edu_13801.html (letzter Zugriff am 26.2.2009)<br />
Wiesner, Heike/ Kamphans, Marion/ Schelhowe, Heidi/ Metz-Göckel, Sigrid/ Zorn,<br />
Isabel/ Drag, Anna/ Peter, Ulrike/Schottmüller, Helmut (2004b): Leitfa<strong>de</strong>n zur<br />
Umsetzung <strong>de</strong>s Gen<strong>de</strong>r Mainstreaming in <strong>de</strong>n „Neue Medien in <strong>de</strong>r Bildung-<br />
För<strong>de</strong>rbereich Hochschule“, zitiert nach www.heike-wiesner.<strong>de</strong>/?download=<br />
GMLeitfa<strong>de</strong>n_21072004.pdf (letzter Zugriff am 25.2.2009)<br />
Wiesner-St<strong>einer</strong>, Andreas/ Wiesner, Heike/ Schelhowe, Heidi (2006): Technik als<br />
didaktischer Akteur: Robotik zur För<strong>de</strong>rung von Technikinteresse. In: Gransee,<br />
Carmen (Hg.): Hochschulinnovation. Gen<strong>de</strong>r-Initiativen in <strong>de</strong>r Technik. Hamburg:<br />
LIT-Verlag, 89-113<br />
Wilding, Faith (o.J.): Where is Feminism in Cyberfeminism?, zitiert nach<br />
www.obn.org/cfun<strong>de</strong>f/faith_<strong>de</strong>f.html (letzter Zugriff am 11.05.08)<br />
Wildman, Daniel/ White, Ellen/ Muller, Michael (1993): Interface Metaphors. In:<br />
INTERCHI’93 Tutorial, 93-105<br />
366
Willis, Sarah (1997): The Moral Or<strong>de</strong>r of an Information System. In: Grundy, Frances/<br />
Köhler, Doris/ Oechtering, Veronica/ Petersen, Ulrike (Eds.): Women, Work and<br />
Computerization. Proceedings of the 6 th International IFIP-Conference. Berlin/<br />
Hei<strong>de</strong>lberg/ New York:Springer, 151-161<br />
Wilson, Melanie (2002): Making nursing visible? Gen<strong>de</strong>r, technology and the care plan<br />
as script. In: Information, Technology and People 15/2, 139-158<br />
Winker, Gabriele (1995): Büro, Computer, Geschlechterhierarchie. Frauenför<strong>de</strong>rliche<br />
Arbeitsgestaltung im Schreibbereich. Opla<strong>de</strong>n: Leske + Budrich<br />
Winker, Gabriele (1997): Flexible Arbeit in <strong>de</strong>r Informationsgesellschaft – neue<br />
Chancen für neue Lebensentwürfe. In: Bath, Corinna/ Kleinen, Barbara (Hg.):<br />
Frauen in <strong>de</strong>r Informationsgesellschaft. Fliegen o<strong>de</strong>r Spinnen im Netz?<br />
Mössingen-Talheim: Talheimer, 89-107<br />
Winker, Gabriele (2005): Ko-Materialisierung von vergeschlechtlichten Körpern und<br />
technisierten Artefakten: Der Fall Internet. In: Fun<strong>de</strong>r, Maria/ Dörhöfer, Steffen/<br />
Rauch, Christian (Hg.): Jenseits <strong>de</strong>r Geschlechterdifferenz?<br />
Geschlechterverhältnisse in <strong>de</strong>r Informations- und Wissensgesellschaft.<br />
München/ Mering: Hampp, 157-178<br />
Winner, Langdon (1993): Upon Opening the Black Box and Finding it Empty: Social<br />
Constructivism and the Philosophy of Technolgy. In: Science, Technology &<br />
Human Values 18/3, 362-378<br />
Winner, Langdon (1999 [1980]): Do Artefacts Have Politics? In: MacKenzie, Donald/<br />
Wajcman, Judy (Eds.) (1999): The Social Shaping of Technology, 2nd Edition.<br />
Buckingham, Phila<strong>de</strong>lphia: Open University Press, 28-40 (zuerst erschienen in:<br />
Daedalus 109 (1980), 121-136; weitere Nachdrucke erschienen in: <strong>de</strong>rs. (1986):<br />
The Whale and the Reactor, Chicago: University of Chicago Press sowie<br />
MacKenzie, Donald/ Wajcman, Judy (Eds.) (1985): The Social Shaping of<br />
Technology. Milton Keynes: Open University Press, 26-38)<br />
Winograd, Terry/ Flores, Fernando (1989 [1986]): Erkenntnis - Maschinen - Verstehen:<br />
zur Neugestaltung von Computersystemen. Berlin: Rotbuch (im Orig.<br />
Un<strong>de</strong>rstanding Computers and Cognition. Norwood, NJ: Ablex)<br />
Wolffram, Andrea (2005): Ko-Konstruktionen von Gen<strong>de</strong>r und Technik im Alltag. In:<br />
Rebsamen, Heidi/ Gloor, Sandra/ Huber, Anita/ Näf, Nicole/ Schmid, Christa/<br />
Schweizer, Sabine (Eds.): Finut04. no limits?! Dokumentation <strong>de</strong>s 30.<br />
Kongresses von „Frauen in Naturwissenschaft und Technik“ in Winterthur. Bern:<br />
Staatssekretariat für Bildung und Forschung, 206-209<br />
Woodfield, Ruth (1998): Working Women and Social Labour. RUSEL Working Paper<br />
No. 23, Department of Politics, University of Exeter (zitiert nach Belt et al. 2002)<br />
Woolgar, Steve (1991a): The Turn to Technology in the Social Studies of Science. In:<br />
Science, Technology & Human Values 16/1, 20-50<br />
367
Woolgar, Steve (1991b): Configuring the user: the case of usability trials. In: Law, John<br />
(Ed.): A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination.<br />
London/ New York: Routledge, 58-99<br />
Woolgar, Steve/ Cooper, Geoff (1999): Do Artefacts Have Ambilvalence? Moses’<br />
Bridges, Winner’s Bridges and other Urban Legends in S&TS. In: Social Studies<br />
of Science 29/3, 433-449<br />
Wouters, Paul/ Beaulieu, Anne (2007): Critical Accountability: Dilemmas for<br />
Interventionist Studies of e-Science. In: Journal of Computer Mediated<br />
Communication 12/2, article 12<br />
Wray-Bliss, Edward (2001): Representing Customer Service: Telephones and Texts.<br />
In: Sturdy, Andrew/ Griguilis, Irena/ Willmott, Hugh (Eds.): Customer Service:<br />
Empowerment and Entrapment. Houndsmill: Palgrave, 38-59<br />
Wright/ Mc Carthy (2004): Technology as Experience. Cambridge, Ma.: MIT Press<br />
Yourdan, Edward/ Argila, Carl (1996): Case Studies in Object Oriented Analysis and<br />
Design. Upper Saddle River: Yourdon Press<br />
Zapf, Dieter (2002): Emotion Work and Psychological Well-Being. In: Human Resource<br />
Management Review 12, 237-268<br />
Zanbaka, Catherine/ Goolkasian, Paula/ Hodges, Larry (2006): Can a virtual cat<br />
persua<strong>de</strong> you? The role of gen<strong>de</strong>r and realism in speaker pervasiveness. In:<br />
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing<br />
Systems 2006, 1153-1162<br />
Zorn, Isabel/ Wiesner, Heike/ Schelhowe, Heidi/ Baier, Barbara/ Ebkes, Ida (2004):<br />
Good Practice für die gen<strong>de</strong>rgerechte Gestaltung digitaler Lernmodule. In:<br />
Carstensen, Doris/ Barrios, Beate (Hg.): Campus 2004 – Kommen die digitalen<br />
Medien an <strong>de</strong>n Hochschulen in die Jahre? Münster: Waxmann, 112-122<br />
Zorn, Isabel/ Susanne Maaß/ Els Rommes/ Carola Schirmer/ Heidi Schelhowe (Eds.):<br />
(2007): Gen<strong>de</strong>r Designs IT. Construction and Deconstruction of Information<br />
Society Technology. Wiesba<strong>de</strong>n: VS-Verlag<br />
368
Mein beson<strong>de</strong>rer Dank gilt<br />
Danksagung<br />
� meinen bei<strong>de</strong>n Betreuerinnen Prof. Dr. Susanne Maaß und Prof. Dr. Heidi Schelhowe für<br />
ihre Unterstützung und Geduld<br />
� Angelika Saupe, Bettina Bock von Wülfingen und Susanne Lettow für Kommentare und<br />
Diskussionen zu wesentlichen Teilen <strong>de</strong>r Arbeit<br />
� Bettina Törpel für intensive regelmäßige Diskussionen über Participatory Design<br />
� Adrian <strong>de</strong> Silva, Barbara Moldt, Carola Schirmer, Ilona Weinreich, Tanja Paulitz und<br />
Torsten Wöllmann für Anmerkungen und Korrekturen zu einzelnen Kapiteln<br />
� Martina Erlemann für Diskussionen über die sozialwissenschaftliche Wissenschafts- und<br />
Technikforschung<br />
� Bianca Prietl für ihre prompte Bereitschaft, mich in <strong>de</strong>r Endphase insbeson<strong>de</strong>re bei <strong>de</strong>r<br />
Erstellung <strong>de</strong>s Literaturverzeichnisses, bei Korrekturen und letzten Än<strong>de</strong>rungen zu<br />
unterstützen<br />
� Stefan Feitl für die sorgfältige Formatierung und Zusammenführung wi<strong>de</strong>rständiger<br />
Word-Dokumente<br />
� <strong>de</strong>m „Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society“ (IAS-STS)<br />
Graz für ein siebenmonatiges Stipendium, einen angenehmen Arbeitsplatz und eine<br />
inspirieren<strong>de</strong> Arbeitsatmosphäre<br />
� <strong>de</strong>m Centrum für Sozialforschung <strong>de</strong>r Karl-Franzens-Universität Graz für die freundlich<br />
Aufnahme als Gastwissenschaftlerin<br />
� m<strong>einer</strong> Schwester Heidi Canditt und meinem Schwager Peter Canditt sowie allen<br />
FreundInnen für ihre liebevolle Unterstützung auf <strong>de</strong>n vielfältigsten Ebenen, die für die<br />
Erstellung <strong>einer</strong> Dissertation erfor<strong>de</strong>rlich sind.<br />
Diese Arbeit hätte jedoch ohne Arbeitsgruppen, Netzwerke und weitere Diskussionszusammenhänge<br />
nicht entstehen können. Danken möchte ich in dieser Hinsicht speziell<br />
� Prof. Dr. Dirk Siefkes und s<strong>einer</strong> Arbeitsgruppe (1993-1995), die mir zeigten, dass die<br />
Informatik eine Disziplin ist, in <strong>de</strong>r die Reflektion <strong>de</strong>r eigenen Geschichte, <strong>de</strong>r Grundlagen<br />
und wissenschaftstheoretischen Annahmen – im Gegensatz zu meinem Studienfach<br />
Mathematik – einen Platz hat<br />
� <strong>de</strong>n Teilnehmerinnen <strong>de</strong>r Kongresse von Frauen in Naturwissenschaft und Technik<br />
(1987-2006) sowie <strong>de</strong>n Mitfrauen <strong>de</strong>s gleichnamigen Vereins (1994-2009), unter <strong>de</strong>nen<br />
ich Gleichgesinnte fand<br />
� <strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Arbeitskreises feministische Naturwissenschaftsforschung und -kritik<br />
(1994-2003), die mich wesentlich darin unterstützt haben, zu wagen, einen Weg<br />
„zwischen“ <strong>de</strong>n Disziplinen und wissenschaftlichen Fachkulturen zu gehen<br />
369
� <strong>de</strong>n KollegInnen am Studiengang Informatik <strong>de</strong>r Universität Bremen (1998-2003), die mir<br />
zeigten, dass und wie Informatik <strong>kritisch</strong> betrieben wer<strong>de</strong>n kann<br />
� <strong>de</strong>r Regionalgruppe Bremen <strong>de</strong>r Fachgruppe „Frauenarbeit und Informatik“ <strong>de</strong>r<br />
Gesellschaft für Informatik e.V. (1998-2009), die mich in (vor allem auch in die lokalen)<br />
Traditionen feministischer Ansätze in <strong>de</strong>r Informatik eingeführt und mich fachlich wie<br />
strukturell stets beraten und unterstützt haben<br />
� <strong>de</strong>m Projekt feministische Theorien im Nordverbund (ProfeTiN) (1999-2005), in <strong>de</strong>m ich<br />
lernte, traditionelle Grenzen zwischen <strong>de</strong>n Wissenschaften radikal zu überschreiten<br />
� <strong>de</strong>n Studieren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r von mir angebotenen Lehrveranstaltungen (1993-2007), von<br />
<strong>de</strong>nen ich viel über ihre Motivation für und ihre Sichtweisen auf die Informatik gelernt<br />
habe<br />
� <strong>de</strong>n TeilnehmerInnen vieler einschlägiger Tagungen und <strong>de</strong>n ZuhörerInnen m<strong>einer</strong><br />
Vorträge, die mir oft sehr wesentliche Impulse gegeben haben, wie ich mein Denken<br />
weiter entwickeln kann.<br />
370