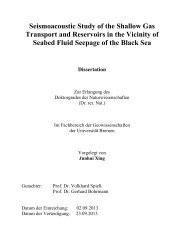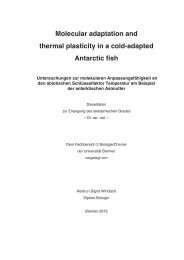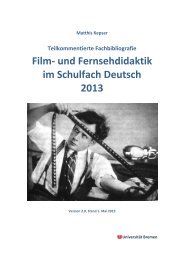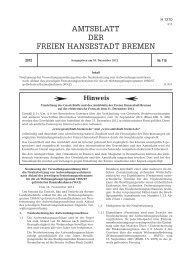de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dass soziale Verhaltensnormen gegen Technologien austauschbar wer<strong>de</strong>n. „Die<br />
Verkehrsampel ersetzt <strong>de</strong>n Polizisten und steht für die Steuerung und Disziplinierung<br />
<strong>de</strong>r VerkehrsteilnehmerInnen. Technische Artefakte sind <strong>de</strong>mnach Stellvertreter bzw.<br />
‚Leutnants‘ – das heißt diejenigen, die einen Ort im Auftrag von jemand an<strong>de</strong>rs halten<br />
‚lieu- tenants‘“ (Singer 2003, 114) zitiert Singer Latours Position. Bekannt ist sein<br />
Beispiel <strong>de</strong>s Berliner Schlüssels (Latour 1996a [1993]). Ausgangspunkt dieses<br />
Beispiels ist das Problem, dass viele HausbesitzerInnen und BewohnerInnen<br />
wünschen, dass die Haustür über Nacht abgeschlossen ist. Die MieterInnen halten sich<br />
jedoch nicht immer an diesen Teil <strong>de</strong>r Hausordnung. Statt nun aufwendige Überwachungen<br />
und teuere Disziplinierungsstrategien einzusetzen (z.B. eine WärterIn anzustellen<br />
und die Nichtbefolgung zu sanktionieren, bis hin zur Kündigung), wur<strong>de</strong> ein<br />
Schlüssel kreiert, <strong>de</strong>r sich nach <strong>de</strong>m Aufschließen nur dann wie<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Tür herausziehen<br />
lässt, wenn diese abgeschlossen wird. Bettina Heintz interpretiert dieses Beispiel<br />
dahingehend, dass dieses Artefakt gewissermaßen die Materialisierung <strong>de</strong>s<br />
Befehls ‚Türe immer abschließen‘ sei und zu s<strong>einer</strong> Befolgung zwinge. „Statt Erziehung<br />
und Disziplinierung – ein technischer Sachzwang.“ (Heintz 1994, 13). Das Technische<br />
wird also auch hier als zutiefst Soziales verstan<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung wur<strong>de</strong>n zwei Konzepte entwickelt,<br />
die das Verhältnis von Technik und Gesellschaft stärker miteinan<strong>de</strong>r verwoben konzipieren:<br />
das sozialkonstruktivistische, in <strong>de</strong>n 1980er Jahren von Bijker, Hughes und<br />
Pinch entwickelte „Social Construction of Technology“ (SCOT) sowie noch stärker die<br />
poststrukturalistisch bzw. semiotisch argumentieren<strong>de</strong> Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT),<br />
zu <strong>de</strong>ren Hauptvertretern Michel Callon, Bruno Latour und John Law zählen. Der<br />
Ansatz <strong>de</strong>r „Social Construction of Technology“ ist von <strong>de</strong>r Wissenssoziologie inspiriert<br />
und betont die „interpretative Flexibilität“ von Technologien, die besagt, dass<br />
Technologien keine inhärente Be<strong>de</strong>utung mit festen Grenzen haben. Unterschiedliche<br />
soziale Gruppen, die für die Gestaltung <strong>einer</strong> Technologie relevant sind, gäben einem<br />
Artefakt verschie<strong>de</strong>ne Be<strong>de</strong>utungen. Dabei <strong>de</strong>finierten sich „sozial relevante Gruppen“<br />
darüber, dass sie eine gemeinsame Interpretation <strong>de</strong>s Artefakts teilten.<br />
Ein klassisches Beispiel, anhand <strong>de</strong>ssen <strong>de</strong>r SCOT-Ansatz eingeführt wur<strong>de</strong>, ist die<br />
Entwicklung <strong>de</strong>s Fahrrad bis zu <strong>de</strong>r Form, in <strong>de</strong>r wir es heutzutage kennen. Ausgehend<br />
vom Hochrad entwickelten Gruppen wie Frauenvereine, sportbegeisterte junge Männer<br />
o<strong>de</strong>r Ingenieure En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts unterschiedliche Visionen, wie dieses<br />
Artefakt zu nutzen sei. An<strong>de</strong>rs ausgedrückt hatten diese Gruppen, die auf die technologische<br />
Entwicklung Einfluss nahmen, unterschiedliche Problem<strong>de</strong>finitionen. Die einen<br />
sahen darin ein alltägliches Fortbewegungsmittel, die an<strong>de</strong>ren ein Sportgerät o<strong>de</strong>r<br />
einen speziellen Hobbygegenstand. Pinch und Bijker (1987) arbeiteten heraus, dass<br />
das gegenwärtige Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Fahrrads sozial ausgehan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Die bis heute<br />
gültige Interpretation <strong>de</strong>s Artefakts entstand durch einen nichtlinearen Aushandlungsprozess<br />
über verschie<strong>de</strong>ne Anfor<strong>de</strong>rungen, die das Fahrrad erfüllen sollte, welche zu<br />
jeweils neuen Varianten <strong>de</strong>s Designs führten. Ein relativ niedriges Fahrrad mit Gummireifen<br />
vermochte zwischen <strong>de</strong>n Ansprüchen an Sportlichkeit und an Sicherheit zu<br />
vermitteln. Bei diesem Mo<strong>de</strong>ll, das sich letztendlich durchsetzen konnte, sah keine <strong>de</strong>r<br />
„sozial relevanten Gruppen“ mehr einen Handlungsbedarf, weitere Verän<strong>de</strong>rungen<br />
vorzunehmen, obwohl dieses nicht die technisch beste Lösung war. Vielmehr seien<br />
alternative Gestaltungsoptionen im Verlauf <strong>de</strong>s Prozesses ausgeschlossen wor<strong>de</strong>n.<br />
44