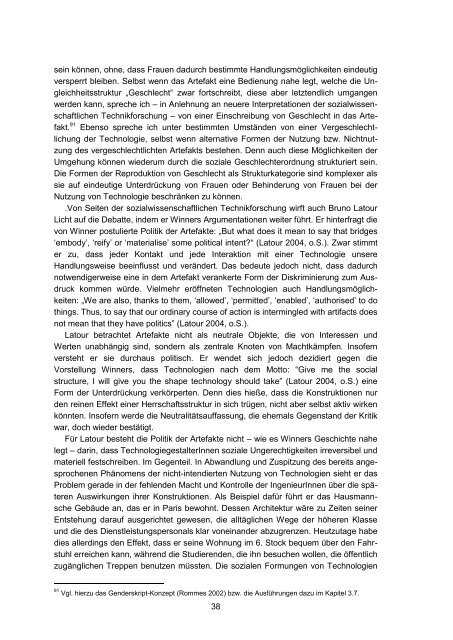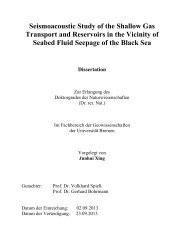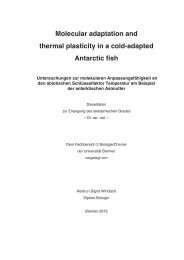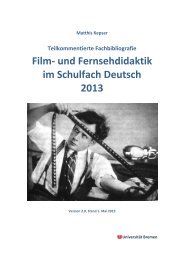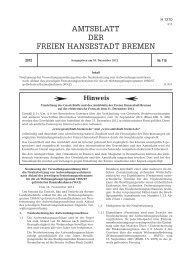de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
de-gendering informatischer artefakte: grundlagen einer kritisch ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sein können, ohne, dass Frauen dadurch bestimmte Handlungsmöglichkeiten ein<strong>de</strong>utig<br />
versperrt bleiben. Selbst wenn das Artefakt eine Bedienung nahe legt, welche die Ungleichheitsstruktur<br />
„Geschlecht“ zwar fortschreibt, diese aber letztendlich umgangen<br />
wer<strong>de</strong>n kann, spreche ich – in Anlehnung an neuere Interpretationen <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen<br />
Technikforschung – von <strong>einer</strong> Einschreibung von Geschlecht in das Artefakt.<br />
91 Ebenso spreche ich unter bestimmten Umstän<strong>de</strong>n von <strong>einer</strong> Vergeschlechtlichung<br />
<strong>de</strong>r Technologie, selbst wenn alternative Formen <strong>de</strong>r Nutzung bzw. Nichtnutzung<br />
<strong>de</strong>s vergeschlechtlichten Artefakts bestehen. Denn auch diese Möglichkeiten <strong>de</strong>r<br />
Umgehung können wie<strong>de</strong>rum durch die soziale Geschlechterordnung strukturiert sein.<br />
Die Formen <strong>de</strong>r Reproduktion von Geschlecht als Strukturkategorie sind komplexer als<br />
sie auf ein<strong>de</strong>utige Unterdrückung von Frauen o<strong>de</strong>r Behin<strong>de</strong>rung von Frauen bei <strong>de</strong>r<br />
Nutzung von Technologie beschränken zu können.<br />
.Von Seiten <strong>de</strong>r sozialwissenschaftlichen Technikforschung wirft auch Bruno Latour<br />
Licht auf die Debatte, in<strong>de</strong>m er Winners Argumentationen weiter führt. Er hinterfragt die<br />
von Winner postulierte Politik <strong>de</strong>r Artefakte: „But what does it mean to say that bridges<br />
‘embody’, ‘reify’ or ‘materialise’ some political intent?“ (Latour 2004, o.S.). Zwar stimmt<br />
er zu, dass je<strong>de</strong>r Kontakt und je<strong>de</strong> Interaktion mit <strong>einer</strong> Technologie unsere<br />
Handlungsweise beeinflusst und verän<strong>de</strong>rt. Das be<strong>de</strong>ute jedoch nicht, dass dadurch<br />
notwendigerweise eine in <strong>de</strong>m Artefakt verankerte Form <strong>de</strong>r Diskriminierung zum Ausdruck<br />
kommen wür<strong>de</strong>. Vielmehr eröffneten Technologien auch Handlungsmöglichkeiten:<br />
„We are also, thanks to them, ‘allowed’, ‘permitted’, ‘enabled’, ‘authorised’ to do<br />
things. Thus, to say that our ordinary course of action is intermingled with artifacts does<br />
not mean that they have politics” (Latour 2004, o.S.).<br />
Latour betrachtet Artefakte nicht als neutrale Objekte, die von Interessen und<br />
Werten unabhängig sind, son<strong>de</strong>rn als zentrale Knoten von Machtkämpfen. Insofern<br />
versteht er sie durchaus politisch. Er wen<strong>de</strong>t sich jedoch <strong>de</strong>zidiert gegen die<br />
Vorstellung Winners, dass Technologien nach <strong>de</strong>m Motto: “Give me the social<br />
structure, I will give you the shape technology should take” (Latour 2004, o.S.) eine<br />
Form <strong>de</strong>r Unterdrückung verkörperten. Denn dies hieße, dass die Konstruktionen nur<br />
<strong>de</strong>n reinen Effekt <strong>einer</strong> Herrschaftsstruktur in sich trügen, nicht aber selbst aktiv wirken<br />
könnten. Insofern wer<strong>de</strong> die Neutralitätsauffassung, die ehemals Gegenstand <strong>de</strong>r Kritik<br />
war, doch wie<strong>de</strong>r bestätigt.<br />
Für Latour besteht die Politik <strong>de</strong>r Artefakte nicht – wie es Winners Geschichte nahe<br />
legt – darin, dass TechnologiegestalterInnen soziale Ungerechtigkeiten irreversibel und<br />
materiell festschreiben. Im Gegenteil. In Abwandlung und Zuspitzung <strong>de</strong>s bereits angesprochenen<br />
Phänomens <strong>de</strong>r nicht-intendierten Nutzung von Technologien sieht er das<br />
Problem gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r fehlen<strong>de</strong>n Macht und Kontrolle <strong>de</strong>r IngenieurInnen über die späteren<br />
Auswirkungen ihrer Konstruktionen. Als Beispiel dafür führt er das Hausmannsche<br />
Gebäu<strong>de</strong> an, das er in Paris bewohnt. Dessen Architektur wäre zu Zeiten s<strong>einer</strong><br />
Entstehung darauf ausgerichtet gewesen, die alltäglichen Wege <strong>de</strong>r höheren Klasse<br />
und die <strong>de</strong>s Dienstleistungspersonals klar voneinan<strong>de</strong>r abzugrenzen. Heutzutage habe<br />
dies allerdings <strong>de</strong>n Effekt, dass er seine Wohnung im 6. Stock bequem über <strong>de</strong>n Fahrstuhl<br />
erreichen kann, während die Studieren<strong>de</strong>n, die ihn besuchen wollen, die öffentlich<br />
zugänglichen Treppen benutzen müssten. Die sozialen Formungen von Technologien<br />
91 Vgl. hierzu das Gen<strong>de</strong>rskript-Konzept (Rommes 2002) bzw. die Ausführungen dazu im Kapitel 3.7.<br />
38