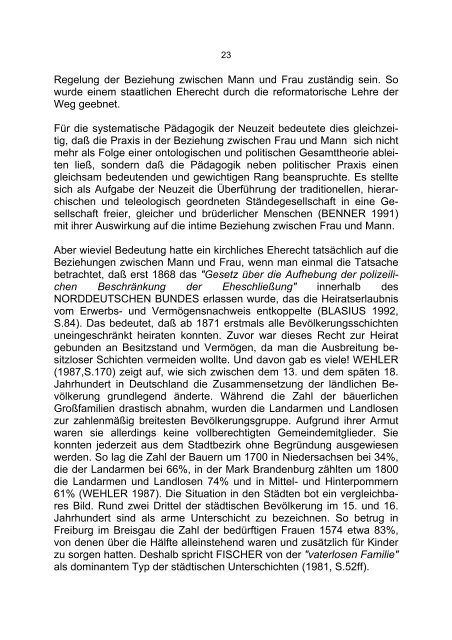- Seite 1 und 2: 1 Integrative Paartherapie, Grundla
- Seite 3 und 4: 3 schen körperlichen Symptomen und
- Seite 5 und 6: 5 6.3) DAS BILD VOM MENSCHEN, DAS B
- Seite 7 und 8: Teil 1: Theorie 1.) Einleitung 7 In
- Seite 9 und 10: 9 Zum anderen gelten als Folgen fü
- Seite 11 und 12: 11 angeheizt und in eine Scheidung
- Seite 13 und 14: 13 geren Sinne auf Erkenntnisse aus
- Seite 15 und 16: 15 In diesem „Sollzustand“ kön
- Seite 17 und 18: 17 „Bonbon“ bezeichnet. Eine Zu
- Seite 19: 19 In Kap.4 werden Gründe aufgezei
- Seite 24 und 25: 24 Angesichts der Massenarmut der v
- Seite 26 und 27: 26 sellschaft" §184 II.1.ALR geseh
- Seite 28 und 29: 28 nur Privatpersonen, sondern der
- Seite 30 und 31: 30 Technik auf einen lebendigen zwi
- Seite 32 und 33: 32 Heute ist es juristisch und i.d.
- Seite 34 und 35: 34 Abbildung Nr. 2.1: Formen famili
- Seite 36 und 37: 36 keit der an einer Beziehung Bete
- Seite 38 und 39: 38 siegt also nicht das „stärker
- Seite 40 und 41: 40 lementierendes und kontrollieren
- Seite 42 und 43: 42 des Menschen, die nicht auf Eins
- Seite 44 und 45: 44 die Ehe sowohl in der nachkonzil
- Seite 46 und 47: 46 3.) Integrative Paartherapie als
- Seite 48 und 49: 48 Und um Verbesserung dieser Praxi
- Seite 50 und 51: 50 Hilfe beim Verstehen des Problem
- Seite 52 und 53: 52 In der Vorgehensweise bedient si
- Seite 54 und 55: 54 Einzelwillens unter den gemeinsa
- Seite 56 und 57: 56 ten Versuchen von Frau und Mann
- Seite 58 und 59: 58 Rollendistanz: Der einzelne Part
- Seite 60: 60 bereits zu Beginn der Therapie e
- Seite 63 und 64: 63 kommt es im Durchschnitt zu eine
- Seite 65 und 66: 65 Die Anlässe wurden differenzier
- Seite 67 und 68: 67 Trennungsängste 21,3% Trennungs
- Seite 69 und 70: 69 Tabelle 4.7 Probleme aus beziehu
- Seite 71 und 72: 71 1/3 bis 50% klagen über Bereich
- Seite 74 und 75:
74 5.) Hilfen auf dem Weg zur Partn
- Seite 76 und 77:
5.3) Ehe- und Partnerschaftstherape
- Seite 78 und 79:
Systemtheoretische Verstehensweisen
- Seite 80:
80 Monaten etwa gleich gut. Völlig
- Seite 83 und 84:
83 (1974) dies in dem metakommunika
- Seite 85 und 86:
85 Kompensation, so schleifen sich
- Seite 87 und 88:
87 Den Sinn der Spannung zwischen O
- Seite 89 und 90:
89 tum“, vor allem aber durch ein
- Seite 91 und 92:
91 zeichnungen oder Beschreibungen
- Seite 93 und 94:
93 gisch-organische sowie verdeckte
- Seite 95 und 96:
95 wahrgenommenen Objektes nichts i
- Seite 97 und 98:
97 spielen. Er begegnete den Klient
- Seite 99 und 100:
99 se spezifische Art der Wahrnehmu
- Seite 101 und 102:
101 Schließen dieser Gestalt, ein
- Seite 103 und 104:
103 Die Bedeutung der Entspannung f
- Seite 105 und 106:
105 Um die innerpsychischen Prozess
- Seite 107 und 108:
107 re spielt die Gruppenarbeit ein
- Seite 109 und 110:
109 ROGERS beschreibt die Erfahrung
- Seite 111 und 112:
111 • Fähigkeit zu großem emoti
- Seite 113 und 114:
113 (Kapitel 8). In den seltensten
- Seite 115 und 116:
115 Im folgenden werden nun neben e
- Seite 117 und 118:
117 sind ansonsten mit ihrem Mitein
- Seite 119 und 120:
119 dung zwischen Selbstbeobachten
- Seite 121 und 122:
121 jene Maßnahmen sind hilfreich.
- Seite 123 und 124:
123 (LAPLANCHE & PONTALIS 1986). C
- Seite 125 und 126:
125 Zum anderen wird zu Beginn eine
- Seite 127 und 128:
127 Mit „Natur“ ist hier eher d
- Seite 129 und 130:
129 Große Beredsamkeit muß wie st
- Seite 131 und 132:
131 Eine auf breiter Basis entwicke
- Seite 133 und 134:
133 7.) Die Praxeologie der Integra
- Seite 135 und 136:
135 In diesem Bild wird die Entwick
- Seite 137 und 138:
137 sondern sie nur vage beschreibe
- Seite 139 und 140:
139 bensstrategie“ seitens des Kl
- Seite 141 und 142:
141 Ist das Bild gestaltet, hat der
- Seite 143 und 144:
143 Zurück zu dem oben aufgeführt
- Seite 145 und 146:
145 gemeinsamen Wachsen, der gemein
- Seite 147 und 148:
147 weil ja nichts anderes zum Repe
- Seite 149 und 150:
149 Nachdem nun aufgezeigt wurde, w
- Seite 151 und 152:
Abbildung Nr.7.2: geistig-seelisch
- Seite 153 und 154:
153 aktiv: kreativ, schöpferisch,
- Seite 155 und 156:
155 schaft wird als „anteilnehmen
- Seite 157 und 158:
157 men aus der Beziehungsforschung
- Seite 159 und 160:
159 bestellt ist. Vielfach haben Kl
- Seite 161 und 162:
161 Das Spüren der Befindlichkeit
- Seite 163 und 164:
163 wenn sie z.B. einen Wunsch äu
- Seite 165 und 166:
165 zweifelsfrei intersubjektive Ve
- Seite 167 und 168:
167 angesehn wird oder im Paarbild
- Seite 169 und 170:
169 In der therapeutischen Gruppe l
- Seite 171 und 172:
171 nahme...stetig" sein; sie "darf
- Seite 173 und 174:
173 Da die Therapeuten im Verlauf d
- Seite 175 und 176:
175 1993) meint Gedächtnisspuren l
- Seite 177 und 178:
177 Hier werden erste Eindrücke, m
- Seite 179 und 180:
8.1.2) Phase 1: Die Paargestalt 179
- Seite 181 und 182:
181 Mit Hilfe einer Zentrierung wer
- Seite 183 und 184:
183 betont VYT: „The human infant
- Seite 185 und 186:
185 stärkt die Individuation im Pa
- Seite 187 und 188:
187 Nachdem nun die Teilnehmer durc
- Seite 189 und 190:
189 Überforderung, der Fähigkeit
- Seite 191 und 192:
191 decken (5 min.). So wird hierdu
- Seite 193 und 194:
193 Ausdruck widerspiegelt. Es ents
- Seite 195 und 196:
195 antwortlich. Durch den Widersta
- Seite 197 und 198:
3.Tag abends 197 Zu Beginn der folg
- Seite 199 und 200:
199 nachwirken läßt, sich dann in
- Seite 201 und 202:
allein weiblich 201 normenorientier
- Seite 203 und 204:
203 ken. Dann kommt jeder innerlich
- Seite 205 und 206:
205 Zum Abschluß des Seminars find
- Seite 207 und 208:
207 durch den geöffneten Mund weit
- Seite 209 und 210:
209 Geschlechtsorgane zentrierte Se
- Seite 211 und 212:
211 durch Anspannen - Entspannen (J
- Seite 213 und 214:
213 zu lassen. Wichtig ist, diese V
- Seite 215 und 216:
215 Kreative Trance: „Der Schmett
- Seite 217 und 218:
217 Und jetzt spüre deine Genitali
- Seite 219 und 220:
219 a) anonymes Ausfüllen des Frag
- Seite 221 und 222:
221 gekommen und zufrieden mit dem
- Seite 223 und 224:
223 Darauf angesprochen, was jetzt
- Seite 225 und 226:
225 Übung“ gemacht. Hierbei stel
- Seite 227 und 228:
227 Gruppenmitgliedern gegenüber,
- Seite 229 und 230:
229 le, wie es geht, gleichberechti
- Seite 231 und 232:
231 theoretischen Modellvorstellung
- Seite 233 und 234:
233 Inhaltlich haben neben anderen
- Seite 235 und 236:
235
- Seite 237 und 238:
237 Das Erfassen dieser Wirklichkei
- Seite 239 und 240:
239 Ein erster systematischer Ansat
- Seite 241 und 242:
241 bereich in verläßlicher Weise
- Seite 243 und 244:
243 Je nach der eigenen Situation u
- Seite 245 und 246:
245 und insbesondere auch für betr
- Seite 247 und 248:
247 Ferner ist zu beachten, daß de
- Seite 249 und 250:
249 • "An den drei Wochenenden du
- Seite 251 und 252:
251 • „Erst bekam ich einen Sch
- Seite 253 und 254:
253 Hinsichtlich der methodischen V
- Seite 255 und 256:
255 blick auf die Besonderheiten de
- Seite 257 und 258:
257 ökonomischen Daten der drei zu
- Seite 259 und 260:
259 in Einzeltherapie befanden. Fer
- Seite 261 und 262:
261 Für die Darstellung und Diskus
- Seite 263 und 264:
263 Männer und Frauen stimmen zwis
- Seite 265 und 266:
265 11. Ich habe in der Beratung An
- Seite 267 und 268:
267 ven Medien, durch die erfahrene
- Seite 269 und 270:
269 so unterscheiden sich beide nic
- Seite 271 und 272:
271 wie der Partner mit Geld umgeht
- Seite 273 und 274:
273 Alternativhypothese: Wenn Partn
- Seite 275 und 276:
275 auch ein in die Untersuchung zu
- Seite 277 und 278:
277 schulabschluß’, ABI: ‘Abit
- Seite 279 und 280:
11.3.2.2) Beschwerdenliste (BL) 279
- Seite 281 und 282:
281 Die untersuchte Stichprobe (IPT
- Seite 283 und 284:
283 Etwa ein Drittel bis die Hälft
- Seite 285 und 286:
285 tungsstellen BF (KLANN & HAHLWE
- Seite 287 und 288:
287 Geschlechtsspezifische Verände
- Seite 289 und 290:
289 Tabelle 11.19 Mittelwertsunters
- Seite 291 und 292:
291 Signifikante Unterschiede zwisc
- Seite 293 und 294:
293 GZ= „Globale Zufriedenheit“
- Seite 295 und 296:
295 wert Problemliste, ADS= Summenw
- Seite 297 und 298:
297 Die Zusammenhänge zwischen den
- Seite 299 und 300:
299 Tabelle 11.25 Effektstärken (E
- Seite 301 und 302:
301 mit Hilfe von guten Prothesen u
- Seite 303 und 304:
303 Evaluation der Fortbildung Auf
- Seite 305 und 306:
10.Ich habe in der Fortbildung konk
- Seite 307 und 308:
307 • „Es fällt mir leichter,
- Seite 309 und 310:
309 mer sind zu 90% - 100% mit der
- Seite 311 und 312:
311 und Hilfe für ihren berufliche
- Seite 313 und 314:
22. Ich konnte in der Fortbildung p
- Seite 315 und 316:
13) Diskussion 315 Zum Schluß soll
- Seite 317 und 318:
317 Ferner fehlen Verhaltensmuster
- Seite 319 und 320:
319 läßt das Wort „action“ al
- Seite 321 und 322:
321 PAPOUSEK 1995). So läßt sich
- Seite 323 und 324:
323 in Richtung einer größeren Ko
- Seite 325 und 326:
325 Noch schwieriger wird es für e
- Seite 327 und 328:
327 men, denn gemäß ihrem sozialp
- Seite 329 und 330:
Zusammenfassung 329 Interaktions- u
- Seite 331 und 332:
331 gegen das Kind möglich, aber a
- Seite 333 und 334:
333
- Seite 335 und 336:
335 BALCK, F., REIMER, C. & JENISCH
- Seite 337 und 338:
337 BROWN, G., PETZOLD, H.G. (Hrsg.
- Seite 339 und 340:
339 DILTHEY, W., System der Ethik,
- Seite 341 und 342:
341 GOLDSTEIN, S. & SONIT, A.J., We
- Seite 343 und 344:
343 JÄGER, R.S., PETERMANN, F., Pe
- Seite 345 und 346:
345 KLANN, N.& HAHLWEG, K., Hrsg.:B
- Seite 347 und 348:
347 LOEWER, H.D., Die sozialpädago
- Seite 349 und 350:
349 MUGDAN, B., (Hrsg.), Die gesamt
- Seite 351 und 352:
351 PETZOLD H., Integrative Therapi
- Seite 353 und 354:
353 ROVEE-COLLIER, C.K., Infants As
- Seite 355 und 356:
355 SINGER, J.,KOLLIGIAN, J., JR.:
- Seite 357 und 358:
357 VOEGELI, W., Funktionswandel de