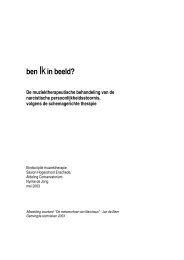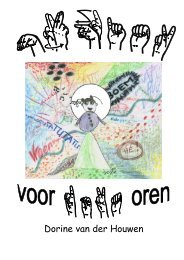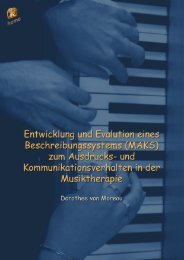Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
KAPITEL 4. MUSIKTHERAPIE UND „SCHREIBABYS“ 49<br />
Tonhöhe, Melodie, Rhythmus, Intensität und P<strong>aus</strong>en bestimmen die<br />
elterlichen Sprechweisen und stimmlichen Äußerungen, wobei zunächst<br />
nicht <strong>der</strong> semantische Inhalt <strong>der</strong> Worte relevant ist. Verstanden werden die<br />
nichtsprachlichen, musikalischen und analogen Anteile <strong>der</strong> verbalen<br />
Sprache.<br />
Mechthild Papousek (1981) beschreibt die Laute eines Neugeborenen als<br />
vokalartige Grundlaute : „eine Gruppe von wohltönenden Lauten mit einer<br />
überwiegend musikalischen Klangstruktur ohne Geräuschbeimengung.“ Sie<br />
klingen wie Zwischenformen von a, e und o und entstehen ohne<br />
artikulatorische Bewegung anfangs als Begleitprodukte <strong>der</strong> Aus- bzw.<br />
<strong>Ein</strong>atmung. Verhaltenszustände des Säuglings beeinflussen den Klang <strong>der</strong><br />
Grundlaute. So sind sie im ruhigen Wachzustand angenehm wohlklingend<br />
und zeigen eine harmonische Klangstruktur, mit zunehmen<strong>der</strong> Unruhe und<br />
Aufregung hingegen ist <strong>der</strong> Ryhthmus <strong>der</strong> Lautfolgen beschleunigt und<br />
Unregelmäßig. Die Lautstärke nimmt zu und die Laute sind häufig<br />
stakkatoartig verkürzt. Im Alter von 8 Wochen entwickeln sich die<br />
anfänglichen Grundlaute zu verlängerten, wohlklingenden Gurrlauten<br />
(„Cooing) die dem Säugling ermöglichen, die Tonhöhe zu modulieren und<br />
die musikalischen Elemente zu variieren. Der Säugling lernt zunehmend, die<br />
Atmung zugunsten <strong>der</strong> Lautbildung zu kontrollieren. Die Laute werden zum<br />
einen als Ausdruck des emotionalen Zustands des Kindes gesehen, zum<br />
an<strong>der</strong>en als wichtige Grundb<strong>aus</strong>teine <strong>der</strong> Kommunikation und <strong>der</strong><br />
kognitiven Entwicklung. (M. Papousek & H. Papousek, 1981 b; H. Papousek<br />
& M. Papousek, 1987).<br />
Bevor <strong>der</strong> Säugling lernt, seine Laute kommunikativ einzusetzen, werden die<br />
Grundlaute von den Eltern als Kommunikationsmittel interpretiert und wie in<br />
einem Gespräch beantwortet und kommentiert. Während das Schreien des<br />
Säuglings häufig durch beruhigendes Zureden o<strong>der</strong> ablehnende<br />
Äußerungen zu stillen versuchen werden die Grundlaute auf vielfältige<br />
Weise stimuliert: Unmittelbares Antworten in Form von Nachahmung, wobei<br />
die Vokalisation des Säuglings intuitiv zu melodischen Modulationen geleitet<br />
wird, Anregungen durch melodische, frageähnliche Intonationsmuster,<br />
variieren <strong>der</strong> bestehenden Melodien und das <strong>Ein</strong>bringen von abwartenden<br />
P<strong>aus</strong>en. Damit legen Eltern den Grundstein für das Abwechseln in ersten<br />
Dialogen. Die Intensität <strong>der</strong> Stimulation passen die Eltern intuitiv an den<br />
Erregungszustand des Säuglings an. Gesang o<strong>der</strong> musikalische Elemente in<br />
<strong>der</strong> Sprache werden den Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Gefühls- und<br />
Verhaltenszustände des Säuglings angepasst. Damit können sowohl die<br />
ruhigen und aktiven Wachzustände des Säuglings aufrechterhalten<br />
werden, als auch <strong>der</strong> Übergang zum Schlaf erleichtert werden.