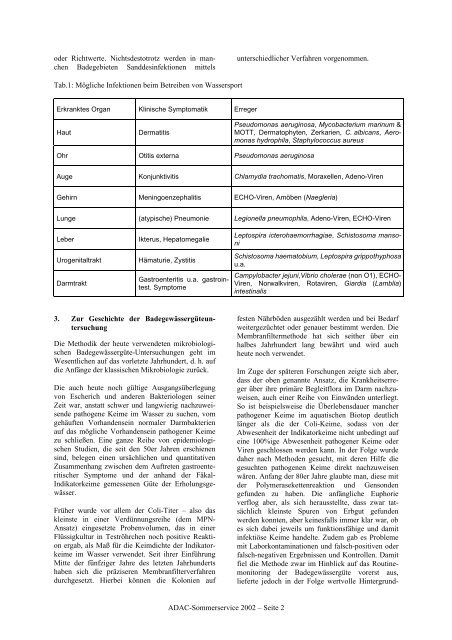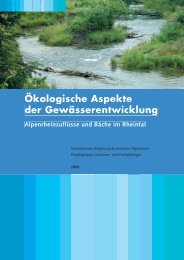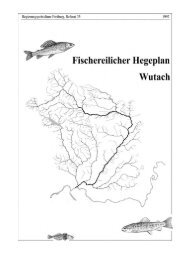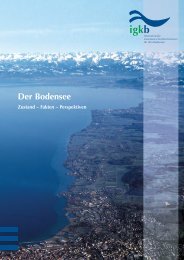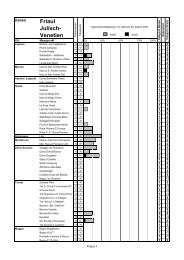Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute
Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute
Bericht über das Informationsprogramm - HYDRA-Institute
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
oder Richtwerte. Nichtsdestotrotz werden in manchen<br />
Badegebieten Sanddesinfektionen mittels<br />
Tab.1: Mögliche Infektionen beim Betreiben von Wassersport<br />
Erkranktes Organ Klinische Symptomatik Erreger<br />
Haut Dermatitis<br />
ADAC-Sommerservice 2002 – Seite 2<br />
unterschiedlicher Verfahren vorgenommen.<br />
Ohr Otitis externa Pseudomonas aeruginosa<br />
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium marinum &<br />
MOTT, Dermatophyten, Zerkarien, C. albicans, Aeromonas<br />
hydrophila, Staphylococcus aureus<br />
Auge Konjunktivitis Chlamydia trachomatis, Moraxellen, Adeno-Viren<br />
Gehirn Meningoenzephalitis ECHO-Viren, Amöben (Naegleria)<br />
Lunge (atypische) Pneumonie Legionella pneumophila, Adeno-Viren, ECHO-Viren<br />
Leber Ikterus, Hepatomegalie<br />
Urogenitaltrakt Hämaturie, Zystitis<br />
Darmtrakt<br />
Gastroenteritis u.a. gastrointest.<br />
Symptome<br />
3. Zur Geschichte der Badegewässergüteuntersuchung<br />
Die Methodik der heute verwendeten mikrobiologischen<br />
Badegewässergüte-Untersuchungen geht im<br />
Wesentlichen auf <strong>das</strong> vorletzte Jahrhundert, d. h. auf<br />
die Anfänge der klassischen Mikrobiologie zurück.<br />
Die auch heute noch gültige Ausgangs<strong>über</strong>legung<br />
von Escherich und anderen Bakteriologen seiner<br />
Zeit war, anstatt schwer und langwierig nachzuweisende<br />
pathogene Keime im Wasser zu suchen, vom<br />
gehäuften Vorhandensein normaler Darmbakterien<br />
auf <strong>das</strong> mögliche Vorhandensein pathogener Keime<br />
zu schließen. Eine ganze Reihe von epidemiologischen<br />
Studien, die seit den 50er Jahren erschienen<br />
sind, belegen einen ursächlichen und quantitativen<br />
Zusammenhang zwischen dem Auftreten gastroenteritischer<br />
Symptome und der anhand der Fäkal-<br />
Indikatorkeime gemessenen Güte der Erholungsgewässer.<br />
Früher wurde vor allem der Coli-Titer – also <strong>das</strong><br />
kleinste in einer Verdünnungsreihe (dem MPN-<br />
Ansatz) eingesetzte Probenvolumen, <strong>das</strong> in einer<br />
Flüssigkultur in Teströhrchen noch positive Reaktion<br />
ergab, als Maß für die Keimdichte der Indikatorkeime<br />
im Wasser verwendet. Seit ihrer Einführung<br />
Mitte der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts<br />
haben sich die präziseren Membranfilterverfahren<br />
durchgesetzt. Hierbei können die Kolonien auf<br />
Leptospira icterohaemorrhagiae, Schistosoma mansoni<br />
Schistosoma haematobium, Leptospira grippothyphosa<br />
u.a.<br />
Campylobacter jejuni,Vibrio cholerae (non O1), ECHO-<br />
Viren, Norwalkviren, Rotaviren, Giardia (Lamblia)<br />
intestinalis<br />
festen Nährböden ausgezählt werden und bei Bedarf<br />
weitergezüchtet oder genauer bestimmt werden. Die<br />
Membranfiltermethode hat sich seither <strong>über</strong> ein<br />
halbes Jahrhundert lang bewährt und wird auch<br />
heute noch verwendet.<br />
Im Zuge der späteren Forschungen zeigte sich aber,<br />
<strong>das</strong>s der oben genannte Ansatz, die Krankheitserreger<br />
<strong>über</strong> ihre primäre Begleitflora im Darm nachzuweisen,<br />
auch einer Reihe von Einwänden unterliegt.<br />
So ist beispielsweise die Überlebensdauer mancher<br />
pathogener Keime im aquatischen Biotop deutlich<br />
länger als die der Coli-Keime, so<strong>das</strong>s von der<br />
Abwesenheit der Indikatorkeime nicht unbedingt auf<br />
eine 100%ige Abwesenheit pathogener Keime oder<br />
Viren geschlossen werden kann. In der Folge wurde<br />
daher nach Methoden gesucht, mit deren Hilfe die<br />
gesuchten pathogenen Keime direkt nachzuweisen<br />
wären. Anfang der 80er Jahre glaubte man, diese mit<br />
der Polymerasekettenreaktion und Gensonden<br />
gefunden zu haben. Die anfängliche Euphorie<br />
verflog aber, als sich herausstellte, <strong>das</strong>s zwar tatsächlich<br />
kleinste Spuren von Erbgut gefunden<br />
werden konnten, aber keinesfalls immer klar war, ob<br />
es sich dabei jeweils um funktionsfähige und damit<br />
infektiöse Keime handelte. Zudem gab es Probleme<br />
mit Laborkontaminationen und falsch-positiven oder<br />
falsch-negativen Ergebnissen und Kontrollen. Damit<br />
fiel die Methode zwar im Hinblick auf <strong>das</strong> Routinemonitoring<br />
der Badegewässergüte vorerst aus,<br />
lieferte jedoch in der Folge wertvolle Hintergrund-