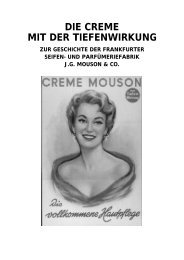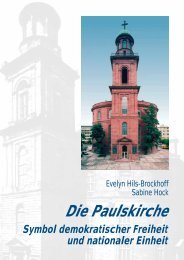GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fritz Eck gehörte. Nach der Geschäftsaufgabe Ecks zog 1891 die Möbelhandlung<br />
Heinrich Hasenpflug in dem Haus ein. Zu den Mietern des<br />
Hauses gehörte seit etwa 1911 auch der Möbel- und Rahmenvergolder<br />
Heinrich Hiebel.<br />
Hiebel, seine Frau Anna Maria und seine beiden Töchter waren um das<br />
Jahr 1909 nach Frankfurt gekommen und hatten sich vor ihrem Umzug<br />
in den Hirschgraben zunächst in der Rotkreuzgasse niedergelassen. Eine<br />
der Töchter Hiebels, Henriette, geboren am 24. Februar 1905 in<br />
Mauer bei Wien, war musisch veranlagt. Sie ließ sich beim Ballett des<br />
Frankfurter Opernhauses ausbilden und trat bereits als achtjährige im<br />
Kinderballett auf. Ihren ersten größeren Erfolg hatte sie in Dresden, dann<br />
wurde sie Revuetänzerin in Paris, Stockholm, London und Berlin. Auch<br />
im Kino war sie präsent. Sie erschien in Stummfilmen wie Der Mann mit<br />
dem Monokel (Schweden, 1925) oder Zwei rote Rosen (Deutschland,<br />
1928). In den 30er Jahren wirkte sie als Tänzerin in acht Tonfilmen mit.<br />
Unter ihrem Künstlernamen La Jana war sie nun in aller Munde. Es entstanden<br />
Filme wie Die Warschauer Zitadelle, Der Tiger von Eschnapur<br />
und Das indische Grabmal. Wenige Tage vor der Uraufführung des Films<br />
Der Stern von Rio ist Henriette Hiebel am 13. März 1940 an den Folgen<br />
einer Lungenentzündung in Berlin gestorben.<br />
Zwischen Goldfedergasse und Schüppengasse, der späteren Bethmannstraße,<br />
folgten die Häuser Großer Hirschgraben 12, 10, 8 und 6.<br />
Die Nummer 14 wurde in der Zählung seit Ende des 19. Jahrhunderts<br />
ausgelassen.<br />
Das Haus Großer Hirschgraben 12, gelegentlich auch Haus Zum Apfel<br />
oder Zum großen goldenen Apfel genannt, gehörte im 18. Jahrhundert<br />
dem Handelsmann Jakob Friedrich du Fay. Dieser verkaufte es 1758 an<br />
den Handelsmann und Bankier Jakob Philipp Leerse. Leerse ließ das<br />
Haus abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Im späten 19. Jahrhundert<br />
gehörte das Haus Zum Apfel der Bank <strong>für</strong> Handel und Industrie,<br />
wurde geteilt und schließlich von dem Möbelfabrikanten Wilhelm Lehr<br />
erworben, dem Besitzer des Nachbarhauses Großer Hirschgraben 10.<br />
Im Großen Hirschgraben 12 erblickte 1911 als jüngster Sohn des<br />
Schneiders Georg Gradel und seiner Ehefrau Margarethe Kurt Gradel<br />
das Licht der Welt. Kurt Gradel spielte bei Richard Weichert am Frankfurter<br />
Schauspielhaus die Kinderrollen, den Sohn des Tell, den Sohn des<br />
Götz und andere Söhne. Ansonsten ergriff er zunächst einmal einen soliden<br />
Handwerksberuf und wurde Dachdecker. Als er einmal während<br />
der Arbeit auf einem Haus in der Taunusstraße das Wolgalied ertönen<br />
ließ, hörte ihn der Produzent einer dort ansässigen Schallplattenfirma<br />
und schickte ihn zum Vorsingen ins Hochsche Konservatorium. Bei K.E.<br />
Jaroschek wurde er dann zum Sänger ausgebildet. Im September 1937<br />
stellte er sich zum ersten Mal dem Publikum vor. Elf Jahre lang sang<br />
Kurt Gradel an den Opernbühnen vieler deutscher Städte die Partien des<br />
31