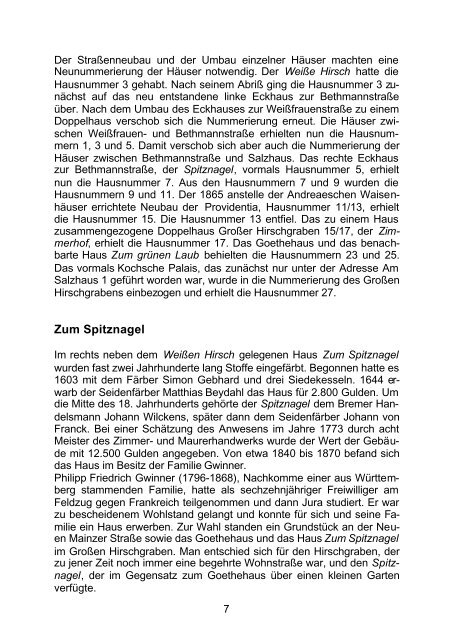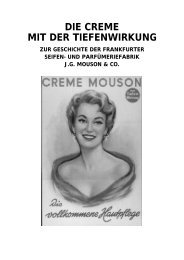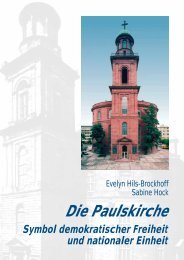GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der Straßenneubau und der Umbau einzelner Häuser machten eine<br />
Neunummerierung der Häuser notwendig. Der Weiße Hirsch hatte die<br />
Hausnummer 3 gehabt. Nach seinem Abriß ging die Hausnummer 3 zunächst<br />
auf das neu entstandene linke Eckhaus zur Bethmannstraße<br />
über. Nach dem Umbau des Eckhauses zur Weißfrauenstraße zu einem<br />
Doppelhaus verschob sich die Nummerierung erneut. Die Häuser zwischen<br />
Weißfrauen- und Bethmannstraße erhielten nun die Hausnummern<br />
1, 3 und 5. Damit verschob sich aber auch die Nummerierung der<br />
Häuser zwischen Bethmannstraße und Salzhaus. Das rechte Eckhaus<br />
zur Bethmannstraße, der Spitznagel, vormals Hausnummer 5, erhielt<br />
nun die Hausnummer 7. Aus den Hausnummern 7 und 9 wurden die<br />
Hausnummern 9 und 11. Der 1865 anstelle der Andreaeschen Waisenhäuser<br />
errichtete Neubau der Providentia, Hausnummer 11/13, erhielt<br />
die Hausnummer 15. Die Hausnummer 13 entfiel. Das zu einem Haus<br />
zusammengezogene Doppelhaus Großer Hirschgraben 15/17, der Zimmerhof,<br />
erhielt die Hausnummer 17. Das Goethehaus und das benachbarte<br />
Haus Zum grünen Laub behielten die Hausnummern 23 und 25.<br />
Das vormals Kochsche Palais, das zunächst nur unter der Adresse Am<br />
Salzhaus 1 geführt worden war, wurde in die Nummerierung des Großen<br />
Hirschgrabens einbezogen und erhielt die Hausnummer 27.<br />
Zum Spitznagel<br />
Im rechts neben dem Weißen Hirsch gelegenen Haus Zum Spitznagel<br />
wurden fast zwei Jahrhunderte lang Stoffe eingefärbt. Begonnen hatte es<br />
1603 mit dem Färber Simon Gebhard und drei Siedekesseln. 1644 erwarb<br />
der Seidenfärber Matthias Beydahl das Haus <strong>für</strong> 2.800 Gulden. Um<br />
die Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte der Spitznagel dem Bremer Handelsmann<br />
Johann Wilckens, später dann dem Seidenfärber Johann von<br />
Franck. Bei einer Schätzung des Anwesens im Jahre 1773 durch acht<br />
Meister des Zimmer- und Maurerhandwerks wurde der Wert der Gebäude<br />
mit 12.500 Gulden angegeben. Von etwa 1840 bis 1870 befand sich<br />
das Haus im Besitz der Familie Gwinner.<br />
Philipp Friedrich Gwinner (1796-1868), Nachkomme einer aus Württemberg<br />
stammenden Familie, hatte als sechzehnjähriger Freiwilliger am<br />
Feldzug gegen Frankreich teilgenommen und dann Jura studiert. Er war<br />
zu bescheidenem Wohlstand gelangt und konnte <strong>für</strong> sich und seine Familie<br />
ein Haus erwerben. Zur Wahl standen ein Grundstück an der Neuen<br />
Mainzer Straße sowie das Goethehaus und das Haus Zum Spitznagel<br />
im Großen Hirschgraben. Man entschied sich <strong>für</strong> den Hirschgraben, der<br />
zu jener Zeit noch immer eine begehrte Wohnstraße war, und den Spitznagel,<br />
der im Gegensatz zum Goethehaus über einen kleinen Garten<br />
verfügte.<br />
7