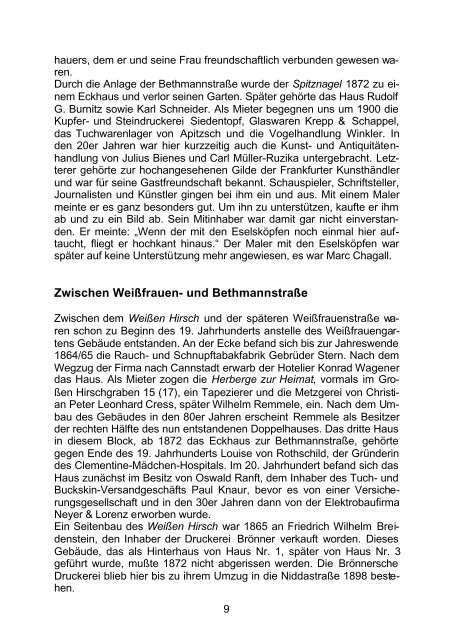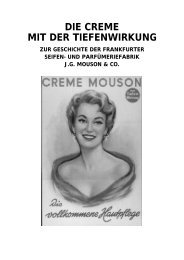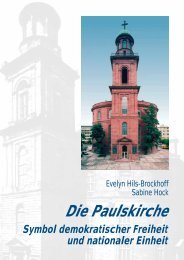GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
GROSSER HIRSCHGRABEN - Institut für Stadtgeschichte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
hauers, dem er und seine Frau freundschaftlich verbunden gewesen waren.<br />
Durch die Anlage der Bethmannstraße wurde der Spitznagel 1872 zu einem<br />
Eckhaus und verlor seinen Garten. Später gehörte das Haus Rudolf<br />
G. Burnitz sowie Karl Schneider. Als Mieter begegnen uns um 1900 die<br />
Kupfer- und Steindruckerei Siedentopf, Glaswaren Krepp & Schappel,<br />
das Tuchwarenlager von Apitzsch und die Vogelhandlung Winkler. In<br />
den 20er Jahren war hier kurzzeitig auch die Kunst- und Antiquitätenhandlung<br />
von Julius Bienes und Carl Müller-Ruzika untergebracht. Letzterer<br />
gehörte zur hochangesehenen Gilde der Frankfurter Kunsthändler<br />
und war <strong>für</strong> seine Gastfreundschaft bekannt. Schauspieler, Schriftsteller,<br />
Journalisten und Künstler gingen bei ihm ein und aus. Mit einem Maler<br />
meinte er es ganz besonders gut. Um ihn zu unterstützen, kaufte er ihm<br />
ab und zu ein Bild ab. Sein Mitinhaber war damit gar nicht einverstanden.<br />
Er meinte: „Wenn der mit den Eselsköpfen noch einmal hier auftaucht,<br />
fliegt er hochkant hinaus.“ Der Maler mit den Eselsköpfen war<br />
später auf keine Unterstützung mehr angewiesen, es war Marc Chagall.<br />
Zwischen Weißfrauen- und Bethmannstraße<br />
Zwischen dem Weißen Hirsch und der späteren Weißfrauenstraße waren<br />
schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts anstelle des Weißfrauengartens<br />
Gebäude entstanden. An der Ecke befand sich bis zur Jahreswende<br />
1864/65 die Rauch- und Schnupftabakfabrik Gebrüder Stern. Nach dem<br />
Wegzug der Firma nach Cannstadt erwarb der Hotelier Konrad Wagener<br />
das Haus. Als Mieter zogen die Herberge zur Heimat, vormals im Großen<br />
Hirschgraben 15 (17), ein Tapezierer und die Metzgerei von Christian<br />
Peter Leonhard Cress, später Wilhelm Remmele, ein. Nach dem Umbau<br />
des Gebäudes in den 80er Jahren erscheint Remmele als Besitzer<br />
der rechten Hälfte des nun entstandenen Doppelhauses. Das dritte Haus<br />
in diesem Block, ab 1872 das Eckhaus zur Bethmannstraße, gehörte<br />
gegen Ende des 19. Jahrhunderts Louise von Rothschild, der Gründerin<br />
des Clementine-Mädchen-Hospitals. Im 20. Jahrhundert befand sich das<br />
Haus zunächst im Besitz von Oswald Ranft, dem Inhaber des Tuch- und<br />
Buckskin-Versandgeschäfts Paul Knaur, bevor es von einer Versicherungsgesellschaft<br />
und in den 30er Jahren dann von der Elektrobaufirma<br />
Neyer & Lorenz erworben wurde.<br />
Ein Seitenbau des Weißen Hirsch war 1865 an Friedrich Wilhelm Breidenstein,<br />
den Inhaber der Druckerei Brönner verkauft worden. Dieses<br />
Gebäude, das als Hinterhaus von Haus Nr. 1, später von Haus Nr. 3<br />
geführt wurde, mußte 1872 nicht abgerissen werden. Die Brönnersche<br />
Druckerei blieb hier bis zu ihrem Umzug in die Niddastraße 1898 bestehen.<br />
9