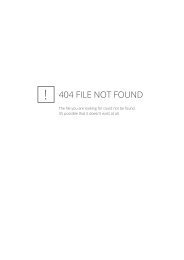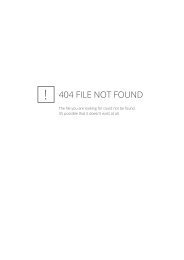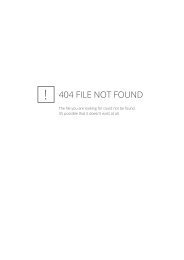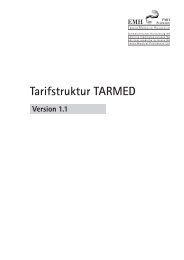Bulletin des médecins suisses 44/2013 - Schweizerische Ärztezeitung
Bulletin des médecins suisses 44/2013 - Schweizerische Ärztezeitung
Bulletin des médecins suisses 44/2013 - Schweizerische Ärztezeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Point de vueTRIBUNESpiritual Care – Modewort, Trendoder echte Notwendigkeit?Die Beschäftigung mit den spirituellen Bedürfnissen der Patienten gehört nichtzum üblichen ärztlichen Aufgabengebiet. Doch dieser Aspekt kann nicht einfachauf die Klinikseelsorge abgeschoben werden. Patienten möchten mit ihrem Arztauch über existentielle und religiöse Fragen sprechen können.René Hefti a ,Stefan Rademacher b ,Hans-Rudolf Pfeifer c ,Rahel Gürber da Chefarzt und Ärztlicher LeiterKlinik SGM Langenthal;Dozent für PsychosozialeMedizin Universität Bernb WissenschaftlicherMitarbeiter Forschungsinstitutfür Spiritualität undGesundheit (www.fisg.ch)c Präsident Arbeitsgemeinschaftder evangelischenÄrztinnen und Ärzteder Schweizd Präsidentin der VereinigungKatholischer Ärzte derSchweizKorrespondenz:Dr. med. René HeftiKlinik SGM LangenthalWeissensteinstrasse 30CH4900 LangenthalTel. 062 919 22 11Fax 062 919 22 00rene.hefti[at]klinik-sgm.chDie <strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> hat in den letztenMonaten mehrere Beiträge über «Medizin und Spiritualität»publiziert. Das Thema gewinnt in der Medizinan Bedeutung und wird kontrovers diskutiert.Soll die Ärztin oder der Arzt sich auch um die spirituellenBedürfnisse der Patienten kümmern, oder istdas alleine Aufgabe der Seelsorge? Beeinflussen Religiositätund Spiritualität den Krankheits und Heilungsverlaufund sind sie <strong>des</strong>halb als Belastung oderRessource in der medizinischen Behandlung zu berücksichtigen?Diesen Fragen wollen dieser Beitragund eine gleichnamige Ärztetagung nachgehen.Spiritual Care – ein neuesBehandlungsmodellDas SpiritualCareKonzept, das sich aus der PalliativeCare heraus entwickelt hat, geht davon aus, dassSpiritualität eine relevante vierte Dimension im biopsychosozialenModell darstellt [1, 2]. Das interdisziplinäreBehandlungsteam hat die Aufgabe, sich umden ganzen Patienten zu kümmern («total patientcare») und damit auch die spirituellen Bedürfnisseund Nöte zu integrieren [3, 4]. Die Klinikseelsorge istTeil <strong>des</strong> interdisziplinären Teams, unterstützt dieses ,ist aber nicht alleine zuständig für die spirituellenund religiösen Belange der Patienten. Sie übernimmtvielmehr die Rolle <strong>des</strong> «religiösen Experten», der wiedie anderen Fachdisziplinen gezielt ihre Kompetenzeneinbringt. Die Ärzte sind im Rahmen <strong>des</strong>SpiritualCare Modells gefordert, auch hinsichtlichder Spiritualität eine aktive Rolle zu übernehmen.Dies gilt insbesondere für das Erheben einer kurzenspirituellen Ana mnese [5]. Dabei geht es um die Klärungder Frage, ob eine religiöse oder spirituelle Orientierungfür den Patienten in der aktuellen Krankheitssituationeine bedeutsame Rolle spielt. Wichtigsind ein pa tientenzentriertes Vorgehen und ein offenerSpiritualitätsbegriff [3, 4].Dieses SpiritualCareModell entspricht nichtdem aktuellen Selbstverständnis von uns Ärztinnenund Ärzten. Vielmehr wurden wir gelehrt, Wissenschaftund Religion strikte zu trennen. Die Beschäftigungmit den spirituellen Bedürfnissen unsererPatienten gehört nicht zu unserem üblichen Leistungskatalog.Vielmehr befürchten wir dabei eineRollenkonfusion, den Verlust unserer professionellenärztlichen Haltung und der damit verbundenenNeutralität. Zudem sind wir für spirituelle Belangenicht ausgebildet, obwohl wir für Patientinnen undPatienten in existentiellen Krankheitskrisen oft dieersten Ansprechpartner sind. Untersuchungen zeigen,dass Patientinnen und Patienten durchaus dasBedürfnis haben, mit ihren Ärztinnen und Ärztenexistentielle und damit auch religiöse Fragenzu besprechen, da sie zu ihnen oft ein langjährigesVertrauensverhältnis aufgebaut haben [6].Einfluss von Religiosität und SpiritualitätAn der Frage, ob Religiosität und Spiritualität aufKrankheits, Bewältigungs und HeilungsprozesseEinfluss haben, entscheidet sich ihre klinische Relevanz.Diese Frage wird im Rahmen der Religion andHealth–Forschung in den USA (seit ca. 1980) und zunehmendauch in Europa empirisch untersucht.Hier einige Hinweise auf den aktuellen Kenntnisstand.Eine 2011 publizierte Metaanalyse [7] fasst<strong>44</strong> systematisch ausgewählte, prospektive Bevölkerungsstudien,welche den Zusammenhang zwischenReligiosität und Mortalität untersuchten, zusammen.Für die Bevölkerungsgruppen mit höherer Religiositätergab sich eine Reduktion der Gesamtmortalitätvon 18 % (HR = 0,82, 95 % CI = 0,76–0,87), waseinem beachtlichen protektiven oder salutogenenEffekt der Religiosität entspricht. Für die kardiovaskuläreMortalität betrug die Risikoreduktion sogar28 % (HR = 0,72, 95 % CI = 0,58–0,89). Interessanterweiseprofitierten die Frauen stärker als die Männer.Bei den Frauen betrug die Reduktion der Gesamtmortalität30%, während sie bei den Männern bei13% lag. Die Autoren erklären den günstigen Effektder Religiosität auf die Mortalität durch besseres Gesundheitsverhalten,weniger Distress und gleichzeitighöhere Stressresistenz, mehr soziale Unterstützung,positive Emotionen und eine günstige Beeinflussungder autonomen Balance.Ein weiterer wichtiger Aspekt von Religiositätund Spiritualität ist, wie eine Vielzahl von Studienzeigt [8], die Unterstützung in der KrankheitsbewälEditores Medicorum Helveticorum<strong>Bulletin</strong> <strong>des</strong> <strong>médecins</strong> <strong>suisses</strong> | <strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bollettino dei medici svizzeri | <strong>2013</strong>;94: <strong>44</strong>1684