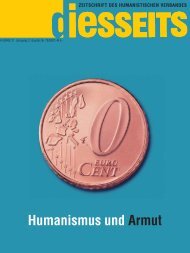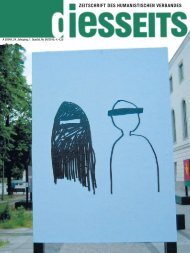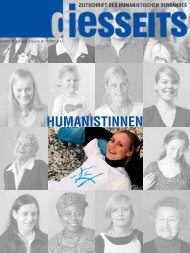der feine Unterschied Der Diesseits - Humanistischer Verband ...
der feine Unterschied Der Diesseits - Humanistischer Verband ...
der feine Unterschied Der Diesseits - Humanistischer Verband ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Michael Bauer /<br />
Alexan<strong>der</strong> Endreß (Hrsg.)<br />
Selbstbestimmung<br />
am Ende des Lebens<br />
208 Seiten, kartoniert, Euro 16.-<br />
Schriftenreihe <strong>der</strong> Humanistischen<br />
Akademie Bayern, Band1<br />
ISBN 3-86569-018-1<br />
<strong>Der</strong> Sammelband nähert sich aus interdisziplinärer<br />
Perspektive <strong>der</strong> Problematik<br />
<strong>der</strong> Selbstbestimmung am<br />
Ende des Lebens. Dabei wird das<br />
komplexe Thema nicht auf die Frage<br />
„(Aktive) Sterbehilfe – ja o<strong>der</strong> nein?“<br />
zugespitzt. Vielmehr loten die Beiträge<br />
grundsätzliche philosophische Fragen<br />
aus, berücksichtigen sozioökonomische<br />
Aspekte und stellen interkulturelle<br />
Vergleiche an.<br />
Mit Beiträgen von Frie<strong>der</strong>-Otto Wolf,<br />
Wolfgang Putz, Norbert Hoerster,<br />
Frank Erbguth, Andreas Frewer, Isabella<br />
Jordan, Reiner Sörries, Klaus<br />
Feldmann, Georg Marckmann, Gita<br />
Neumann, Horst Groschopp, Ursula<br />
Seitz, Ludwig A. Minelli.<br />
Die Humanistische Akademie Bayern<br />
veröffentlicht in ihrer Schriftenreihe<br />
die Beiträge zu den Frühjahrstagungen<br />
sowie weiteren Veranstaltungen<br />
und Arbeitsmaterialien. Als nächster<br />
Band ist die Dokumentation eines<br />
Streitgespräch zwischen Michael<br />
Schmidt-Salomon und Joachim Kahl<br />
vorgesehen.<br />
32<br />
www.alibri.de<br />
4/2007<br />
man den Ernst als Witz verkaufen muss“,<br />
klagte Zille einmal.<br />
Max Liebermann zählte zu denen, die<br />
ihn verstanden. Er packte das in die klugen<br />
Sätze: „Tausende und aber Tausende werden<br />
achtlos und, wenn sie darauf achteten,<br />
sogar mit Abscheu an den Szenen, die Sie<br />
schil<strong>der</strong>n, vorübergehen...Sie dagegen werden<br />
von ihnen tief bewegt. Das große Mitleid<br />
regt sich in Ihnen, aber Sie beeilen sich,<br />
darüber zu lachen, um nicht gezwungen zu<br />
sein, darüber zu weinen. Wir spüren die<br />
Tränen hinter Ihrem Lachen.“ Hinter<br />
scheinbar sachlich-ruhigem Registrieren<br />
von Eindrücken „fühlen wir den warmen<br />
Pulsschlag Ihres Herzens, Ihr Mitleid mit<br />
den Armen und Elenden, mit den Verkommenen<br />
und Deklassierten“.<br />
Wer den wahren Zille erleben will, dem<br />
sei ein Besuch im seit April nach gründlicher<br />
Erneuerung wie<strong>der</strong>eröffneten Zille-Museum<br />
im Nikolaiviertel empfohlen. Dort läuft<br />
auch eine sehenswerte Arbeit <strong>der</strong> bekannten<br />
Berliner Filmemacherin Irmgart von zur<br />
Mühlen, die nicht nur ein lückenloses Bild<br />
von Zilles Leben und Werk bietet, son<strong>der</strong>n<br />
gleichzeitig seine bisher kaum gewürdigten<br />
fotografischen Arbeiten über das Leben und<br />
die Umwelt <strong>der</strong> Ärmsten durch geschickte<br />
Kombination mit dokumentarischem Filmmaterial<br />
„zum Laufen“ bringt.<br />
Das Museum gehört <strong>der</strong> privaten Heinrich-Zille-Gesellschaft.<br />
Ein staatliches o<strong>der</strong><br />
städtisches für den 80. Ehrenbürger Berlins,<br />
den wohl berlinischsten unter den zeitgenössischen<br />
Bildenden Künstlern, existiert<br />
nicht. Dabei hielt schon Tucholsky <strong>der</strong><br />
Stadt vor, „nichts, aber auch gar nicht das<br />
leiseste zu tun“, um Zilles Bil<strong>der</strong>n vom<br />
„großen Stadttheater“ eine Heimstatt zu geben.<br />
Vorbehalte gegen Zilles Kunst und<br />
Persönlichkeit sind nie ganz verschwunden.<br />
Als er eigentlich ganz gegen seine eigenen<br />
Ambitionen zu akademischen Ehren gekommen<br />
war, schrieb – Zille zitierte es<br />
genüsslich – das völkische Blatt „Fri<strong>der</strong>icus“:<br />
„<strong>Der</strong> Berliner Abort- und Schwangerschaftszeichner<br />
Heinrich Zille ist zum Mitglied<br />
<strong>der</strong> Akademie <strong>der</strong> Künste gewählt und<br />
als solcher vom Minister bestätigt worden.<br />
Verhülle, o Muse, dein Haupt.“<br />
„Vata jeht stehl’n – icke soll beten“<br />
So lange sich Zilles Kunst als „kleinbürgerlicher<br />
Firlefanz“ wie Zillebällen, wo sich die<br />
Damen und Herren des Establishments als<br />
Luden und Huren, Bettler und Knastbrü-<br />
<strong>der</strong>, Krüppel und Marktweiber aus dem<br />
„Milljöh“ verkleideten, aber auch in Familienblättern<br />
und Illustrierten gut vermarkten<br />
ließ, versuchte man, ihn dafür gleichzeitig<br />
zu entschärfen und nutzbar zu machen.<br />
Zille durchschaute den Rummel<br />
bald, obwohl man ihm einredete, die Maskenbälle<br />
mit den Zillefiguren seien Wohltätigkeitsveranstaltungen<br />
für die Armen.<br />
„Das sollte ein Volksfest sein. Ein richtiges<br />
Volksfest!“, klagte er. „Sie aber machten<br />
eine Champagnerpropaganda daraus.“<br />
Selbst die Lobesworte des Oberbürgermeisters<br />
zu seinem 70. Geburtstag, er habe mit<br />
seinem humorvollen Wesen das Volk Berlins<br />
in die Kunst eingeführt, nahm Zille<br />
misstrauisch auf: „Sie wollen in mir nur das<br />
Volk streicheln...“<br />
Politisch war Zille stets ein Linker. Ohne<br />
sich an eine Partei zu binden, unterstützte er<br />
die „Rote Hilfe“ und die Kämpfe <strong>der</strong> Arbeiter<br />
um den Achtstundentag, nannte er sich<br />
Kommunist. Er wollte kein politischer Akteur<br />
sein, aber er empfand sich als ein Teil<br />
<strong>der</strong> Klasse, die er malte. Als er gemeinsam<br />
mit Otto Nagel, wie er ein Maler des Berliner<br />
Proletariats, das engagierte Buch „An<br />
alle“ herausgab, in dem „zum ersten Mal <strong>der</strong><br />
unverfälschte, unfrisierte Zille zu Worte“<br />
kommt, meinte er dazu: „Viele werden enttäuscht<br />
sein, sie werden sagen: Also so einer<br />
ist das! Na, – wenn sie es erst jetzt merken!“<br />
Wie in seinen Bil<strong>der</strong>n die soziale Wahrheit,<br />
so war in seinem Leben schonungslose Offenheit<br />
kein Beiwerk, son<strong>der</strong>n selbstverständlich.<br />
Heuchelei war ihm fremd. In einer<br />
Skizze weint ein Mädchen bitterlich.<br />
„Vata jeht stehl’n – icke soll beten“, lautet<br />
<strong>der</strong> Text.<br />
Ja, und noch etwas prägte sein Leben:<br />
ein aus dem tiefsten Inneren kommen<strong>der</strong><br />
Humanismus, immerwährende praktische<br />
Hilfsbereitschaft. An Autogrammjäger<br />
schrieb er: „Wenn Sie an die Frau Soundso<br />
fünf Mark schicken, dann will ich Ihnen<br />
gern meinen Namenszug zukommen lassen.“<br />
Und er kommentierte für seine Leser:<br />
„Ich habe doch immer ’ne ganze Masse armer<br />
Witwen und andre arme Lu<strong>der</strong>s.“ Das<br />
war es, was die von ihm so geliebte Diseuse<br />
Claire Waldoff in einem zum Schlager gewordenen<br />
Lied Willi Kollos vom „guten<br />
Vater Zille“ singen ließ. Er war, mag das<br />
Wort auch neuerdings zu Unrecht in Verruf<br />
geraten sein, nehmt alles nur in allem,<br />
einfach ein guter, verehrenswürdiger<br />
Mensch. ●