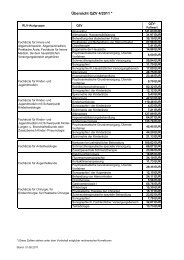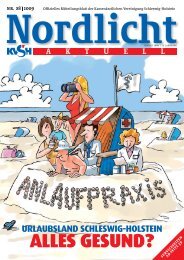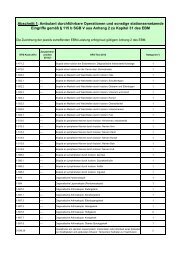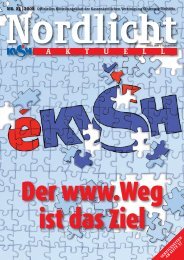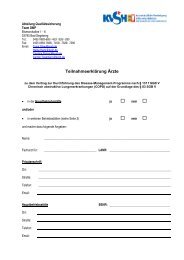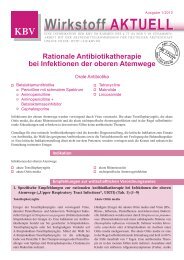Nordlicht_0906.qxp - Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
Nordlicht_0906.qxp - Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
Nordlicht_0906.qxp - Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
BUCHTIPP 37<br />
WACHSTUMSMARKT GESUNDHEIT<br />
Oberender/Hebborn/Zerth: Für Vertragsärzte als Post-Praxislektüre<br />
empfohlen – für Gesundheitspolitiker als Pflichtlektüre verordnet!<br />
PROF. DR. JENS-MARTIN TRÄDER, ALLGEMEINARZT, LÜBECK<br />
Die Bayreuther Wirtschaftswissenschaftler Oberender, Hebborn<br />
und Zerth legen in ihrem Buch eine schonungslose<br />
Analyse unseres Gesundheitswesens vor. Im Gegensatz zu<br />
vielen anderen Autoren, die mit den Entwicklungen in Deutschland<br />
ebenfalls unzufrieden sind, führen sie in ihrem Buch auch Lösungsvorschläge<br />
an, die eine genauere Betrachtung wert sind. Das<br />
Buch ist lesenswert für alle, die sich mit den aktuellen Problemen<br />
unseres Gesundheitssystems beschäftigen.<br />
Einige interessante Darstellungen, die bekannte Zahlen neu und<br />
intelligent zusammenstellen, wodurch andere Interpretationen angeregt<br />
werden, habe ich exzerpiert und hier abgebildet.<br />
KostensteIle 1960 relativ 2004 relativ Steigerung<br />
Gesamtausgaben 4,9 100% 130,18 100% 28,9fach<br />
Verwaltungsausgaben 0,3 6,30% 8,1 5,80% 26,4fach<br />
Leistungsausgaben 4,6 100% 131,16 100% 28,5fach<br />
Heil- und Hilfsmittel 0,1 2,20% 8,18 6,20% 80fach<br />
Krankenhaus 0,8 17,80% 47,59 36,30% 58,2fach<br />
Arzneimittel 0,6 12,20% 21,43 16,30% 38,1fach<br />
zahnärztl. Behandlung 0,4 8,90% 11,26 8,60% 27,5fach<br />
ärztliche Behandlung 1 21,10% 21,43 16,30% 22,1fach<br />
Krankengeld 1,4 30,00% 6,37 4,90% 4,6fach<br />
Bei dieser Tabelle fällt auf, dass sich in den vergangenen 45 Jahren<br />
die Werte für ärztliche und zahnärztliche Behandlung sowie für Verwaltungskosten<br />
etwa in dem Maße gesteigert haben wie die gesamten<br />
Leistungsausgaben. Die Kosten für Arzneimittel, für Behandlung<br />
im Krankenhaus und Ausgaben für Heil- und Hilfsmittel<br />
sind überdurchschnittlich gestiegen. Damit ist die Hauptquelle der<br />
Kostensteigerungen im Gesundheitswesen klar zu identifizieren.<br />
Als Hauptfehler unseres GKV-Systems sehen Oberender und Kollegen<br />
die von ihnen so bezeichnete "Freifahrermentalität" der Versicherten.<br />
Zum einen hängt die Höhe des Beitrages nicht von der<br />
persönlichen Lebensführung ab, gesundheitsschädliches Verhalten<br />
wird nicht durch steigende Versicherungsbeiträge "bestraft". Zum<br />
anderen hätten die Versicherten viele dieser Gesundheitsleistungen<br />
nicht von selbst nachgefragt, wenn sie diese im Einzelfall auch bezahlen<br />
müssten. Die Nachfrage ist von der Tatsache, dass sie diese Leistungen<br />
im Versicherungspaket ohne Mehrkosten wahrnehmen<br />
können, induziert worden. Die Krankenkassen fördern diese Nachfrage<br />
sogar noch durch Sonderprogramme.<br />
Ein weiterer Belastungsfaktor ist durch die steigende Lebenserwartung<br />
bedingt. Die Zahl der Hochbetagten, die Multimorbidität und<br />
die Anzahl der chronischdegenerativen Erkrankungen (und auch<br />
der Pflegefälle) steigen an, wodurch die Ausgabensituation der Krankenkassen<br />
verschlechtert wird. Da die Gesamthonorierung der<br />
niedergelassenen Ärzteschaft jedoch durch die Budgetierung (und<br />
durch die Zahlung einer Kopfpauschale) konstant gehalten wird, ist<br />
die Wirkung auf den Haushalt der Krankenkassen weniger fatal als<br />
die Entwicklung auf dem Sektor der Heil- und Hilfsmittel, der Krankenhauskosten<br />
und der Medikamentenkosten.<br />
Oberender und Kollegen kritisieren im abschließenden Kapitel<br />
folgende Hauptpunkte:<br />
1. Falsche Anreize des Systems an die Versicherten,<br />
möglichst viele Leistungen<br />
in Anspruch zu nehmen, anstatt die<br />
Frage nach einem Eigenbeitrag in Form<br />
einer Veränderung des eigenen Verhaltens<br />
zu stellen,<br />
2. Hemmnisse der Marktmechanismen<br />
durch die Verordnungs- und Regelungsflut,<br />
3. Kostendämpfung im Gesundheitswesen<br />
als Selbstzweck, damit Risiko der<br />
Zerstörung des Wachstumsmarktes Gesundheitswesen.<br />
An Veränderungen, die diesen Namen verdienten, ist zurzeit nichts<br />
in Sicht. Die momentane Reformdebatte kuriert an einigen kleineren<br />
Symptomen, aber nicht an der Krankheitsursache. Beide Modelle,<br />
die von der Regierung zurzeit favorisiert werden (Bürgerversicherung<br />
[SPD] und Gesundheitsprämie [CDU]), versuchen die<br />
Einnahmeseite zu erweitern, anstatt Fehlsteuerungen auf der Ausgabenseite<br />
zu vermeiden.<br />
Als alternatives Versicherungsmodell stellen Oberender und Kollegen<br />
die Überlegung vor, eine kollektive Versicherungspflicht für<br />
eine Basisversorgung einzuführen, ohne in der Versicherung ein immanentes<br />
"Umverteilungsmodul" zu belassen. Zusatzversicherungswünsche<br />
können eigenverantwortlich und in separaten Verträgen<br />
mit den Versicherungen abgeschlossen werden. Demzufolge<br />
müssen die Prämien risikoorientiert sein. Diese Prämien werden alters-<br />
und geschlechtsspezifisch erhoben und nach den Gesetzen<br />
der Versicherungsmathematik vorausberechnet. Hier hätte jeder<br />
Beitragszahler den Anreiz, durch die Minimierung der individuellen<br />
Risiken den Beitrag niedrig zu halten.<br />
Die soziale Komponente erhält man in diesem Modell dadurch,<br />
dass jeder Bürger, der durch hohe Versicherungsbeiträge übermäßig<br />
stark belastet würde, eine Beihilfe bekäme, welche diese Belastung<br />
zumindest teilweise auffangen könnte.<br />
Die Krankenversicherung solle die in der Jugend und jungen Erwachsenenzeit<br />
bezahlten Beiträge kapitalsichernd anlegen und für<br />
die Versorgung im Alter nutzen.<br />
Als Quintessenz kommen Oberender und Kollegen also auf eine<br />
Kombination aus dem Teilkasko-Vollkasko-Modell und dem Kapitalanspar-(<br />
=Vorsorge-)modell einer Lebensversicherung mit einer<br />
sozialen Ausgleichsmechanik. Der größte Hemmschuh scheint der<br />
durch die Folgen des 2. Weltkriegs bedingte Generationenvertrag,<br />
der nicht - oder nur schwer - in ein Beitragsrücklagemodell zurückzuführen<br />
ist. Dieser Generationenvertrag führt dazu, dass zurzeit<br />
nur noch die Beitragszahler unter 30 Jahren Nettozahler in unser<br />
System sind, und dass fast alle anderen Jahrgänge Nettoempfänger<br />
darstellen.<br />
09 | 2006 <strong>Nordlicht</strong> AKTUELL