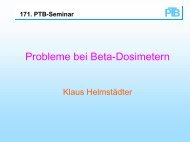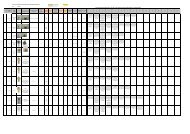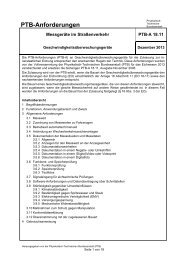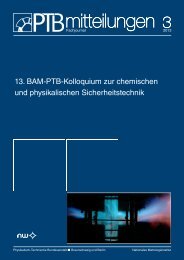PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>PTB</strong>-<strong>Mitteilungen</strong> 122 (<strong>2012</strong>), <strong>Heft</strong> 2<br />
in Berlin diente er als Chirurg und Militärarzt an<br />
der Berliner Charité und in Potsdam. Er promovierte<br />
1842 neben Emil du Bois-Reymond und<br />
Rudolf Virchow beim großen Physiologen Johannes<br />
Müller an der Berliner Universität, schloss sich<br />
1845 wie der Ingenieur Werner Siemens der eben<br />
gegründeten Physikalischen Gesellschaft zu Berlin<br />
an, wo er am 25. Juni 1847 in seinem Vortrag über<br />
die „Erhaltung der Kraft“ die allgemeine Formulierung<br />
des Energiesatzes vorstellte. Nach einer<br />
Lehrstelle für Anatomie an der Berliner Akademie<br />
wurde er als Extraordinarius für Physiologie an die<br />
Königsberger Universität berufen und stieg dort<br />
schon 1850 zum Ordinarius und 1854 zum Dekan<br />
der medizinischen Fakultät auf. Unterstützt von<br />
seiner ersten Frau Olga von Velten, entstanden<br />
dort Pionierarbeiten über die Signalfortpflanzung<br />
bei der Nervenleitung. Außerdem erfand er<br />
den Augenspiegel und das Ophthalmometer zur<br />
Messung der Hornhautkrümmung. 1855 nahm<br />
er einen Lehrstuhl für Physiologie und Anatomie<br />
in Bonn an, zog aber bereits 1858 weiter nach<br />
Heidelberg. Das „Handbuch für physiologische<br />
Optik“ und die „Lehre von den Tonempfindungen“<br />
mit physikalisch-anatomischen Studien über<br />
das menschliche Ohr und das Hören schrieb er<br />
während dieser Zeit. In Heidelberg starb Ende<br />
1859 Olga Helmholtz. Einige Monate später heiratete<br />
Helmholtz seine zweite Frau, Anna von Mohl.<br />
Auf Reisen nach Großbritannien ab Sommer 1853<br />
lernte er berühmte Physiker kennen, namentlich<br />
den Engländer Michael Faraday („den gegenwärtig<br />
ersten Physiker Europas“). 1855 traf er den Schotten<br />
William Thomson in Deutschland, den er auch<br />
später häufig besuchte. 1871 wurde er nach dem<br />
Tode von Gustav Magnus dessen Nachfolger als<br />
Ordinarius für Physik an der Berliner Universität,<br />
nachdem er sich vorher durch wichtige Arbeiten<br />
über die Hydrodynamik und die Elektrodynamik<br />
als Physiker eingeführt hatte. Mit seinem Freund<br />
du Bois-Reymond baute er zwei benachbarte Institute<br />
für Physik bzw. Physiologie auf und richtete sie<br />
ein. Helmholtz begann nun eine erfolgreiche Laufbahn<br />
als Physiker in Zusammenarbeit mit Gästen<br />
wie Ludwig Boltzmann und Albert Abraham<br />
Michelson und Schülern wie Heinrich Hertz.<br />
Dem Förderer Siemens wurde gelegentlich<br />
vorgeworfen, dass er die geplante Physikalisch-<br />
Technische Reichsanstalt vollständig auf seinen<br />
Freund Hermann von Helmholtz zugeschnitten<br />
habe. Bereits im Mai 1889 konnte von den auf<br />
dem Siemens-Gelände errichteten Gebäuden<br />
das Wohnhaus der Familie Helmholtz bezogen<br />
werden. Es entwickelte sich bald zum Mittelpunkt<br />
einer illustren Gesellschaft, die vom Kronprinzenpaar<br />
über viele Kollegen und Künstler bis zu den<br />
leitenden Mitarbeitern der Reichsanstalt reichte.<br />
Unter letzteren seien Otto Lummer und Friedrich<br />
Kurlbaum besonders erwähnt, die dem Optischen<br />
Helmholtz und die Gründerjahre �<br />
Laboratorium der PTR vorstanden, sowie ihr Assistent und Helmholtz-<br />
Schüler Wilhelm (Willy) Wien.<br />
Zu Helmholtz’ Zeiten beschäftigte die Reichsanstalt 65 Personen,<br />
darunter mehr als ein Dutzend Physiker, und hatte ein Budget von<br />
263 000 Mark. Der Präsident bezog ein Gehalt von 24 000 Mark, für<br />
das ihn der Staat allerdings auch verpflichtete, Vorlesungen von ein-<br />
bis dreistündiger Dauer über theoretische Physik an der Universität<br />
zu halten. In seiner Gedächtnisrede auf den alten Freund im Juli 1895<br />
in der Berliner Akademie kommentierte Emil du Bois-Reymond die<br />
hohe Gehaltseinstufung mit den Worten, „dass der Präsident eines so<br />
umfangreichen, vielfach gegliederten, zum Teil den Charakter einer<br />
Unterrichtsanstalt, zum Teil den einer Fabrik tragenden Institutes mit<br />
einem Personal von 50 Beamten, eine gewaltige Menge von täglich sich<br />
erneuernden Verwaltungsgeschäften zu erledigen hat, welche … durch<br />
ihre Neuheit und Fremdartigkeit ihn vielmehr erst recht belasteten.“<br />
1897 konnte sein Nachfolger Friedrich Kohlrausch endlich auch die<br />
weiteren geplanten Gebäude der PTR in Betrieb nehmen: für die Physikalische<br />
Abteilung neben dem bereits existierenden Präsidentenwohnhaus<br />
das Observatorium, einen Verwaltungsbau und das Magnethaus<br />
und für die Technische Abteilung deren Hauptgebäude, ein Laboratoriumsgebäude,<br />
das Maschinenhaus, das Kesselhaus, das Lufthäuschen und<br />
das Wohnhaus des Direktors.<br />
Da Hermann von Helmholtz 1894 kurz nach seinem 73. Geburtstag<br />
starb, konnte er die großen wissenschaftlichen Erfolge seiner Anstalt, für<br />
die er mit seinen Vorstellungen die Grundlagen gelegt hatte, nicht mehr<br />
erleben.<br />
Der Ostpreuße Willy Wien trat nach mathematischen Studien an den<br />
Universitäten Göttingen und Berlin im Wintersemester 1883/84 ins<br />
Laboratorium von Hermann von Helmholtz an der Berliner Universität<br />
ein, in das er nach einem Auswärtssemester in Heidelberg zurückkehrte.<br />
Dort promovierte er 1886 mit einer optischen Arbeit. 1890 wurde er<br />
Mitarbeiter der PTR und wandte sich mit thermodynamischen und<br />
elektrodynamischen Methoden dem Gebiet der Wärmestrahlung zu. Mit<br />
Otto Lummer schlug er 1895 die Realisierung eines Schwarzen Strahlers<br />
in Form eines auf konstante Temperatur geheizten Hohlraums vor. Die<br />
Messungen Lummers mit den Helmholtz-Schülern Ernst Pringsheim,<br />
Ferdinand Kurlbaum und Heinrich Rubens führten schließlich ein Jahr<br />
später zum Wien’schen Strahlungsgesetz, das Max Planck, Ordinarius<br />
für Theoretische Physik an der Berliner Universität, 1899 herleiten<br />
konnte. Anschließend gefundene Abweichungen, die Rubens und<br />
Kurlbaum in Messungen bei hohen Temperaturen und großen Wellenlängen<br />
feststellten, führten Planck schließlich zu einer Verbesserung<br />
der Wien’schen Gleichung durch Einführung von Strahlungsquanten.<br />
Sein Vortrag darüber am 14. Dezember 1900 in der Versammlung der<br />
Deutschen Physikalischen Gesellschaft gilt gemeinhin als Aufbruch in<br />
eine neue Ära der Physik. �<br />
9