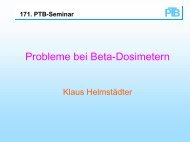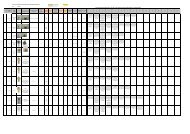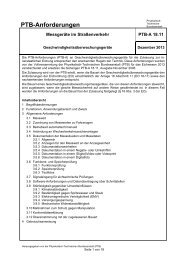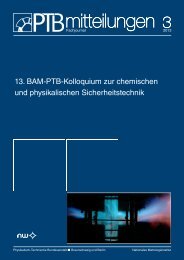PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>PTB</strong>-<strong>Mitteilungen</strong> 122 (<strong>2012</strong>), <strong>Heft</strong> 2<br />
1925 – Meißner gelingt die<br />
Verflüssigung von Helium<br />
Walther Meißner gelingt es, in der PTR<br />
den von ihm konzipierten weltweit<br />
dritten Heliumverflüssiger erfolgreich<br />
in Betrieb zu nehmen und zum ersten<br />
Mal in Deutschland 200 cm 3 flüssiges<br />
Helium (Siedetemperatur 4,2 K)<br />
herzustellen. Aufgrund der Unterstützung<br />
durch die Notgemeinschaft<br />
der Deutschen Wissenschaft wird das<br />
Kältelaboratorium der PTR so etwas<br />
wie ein nationales Kältelaboratorium<br />
des Deutschen Reichs.<br />
der Spektrallinien im<br />
starken Magnetfeld.<br />
Man kann ihn als<br />
den bedeutendsten<br />
Spektroskopiker seiner<br />
Zeit bezeichnen, der<br />
die zuverlässige exakte<br />
Messung über alles<br />
schätzt. Paschen wird<br />
1924 Präsident der<br />
PTR und 1933 durch<br />
die Nationalsozialisten<br />
in den Ruhestand<br />
versetzt. Danach lehrt<br />
er an der Berliner<br />
Universität.<br />
1925 − Max von Laue<br />
wird „nebenamtlicher“ Berater<br />
der PTR<br />
Max von Laue hat schon während seines<br />
Studiums Kontakt zur PTR über Otto<br />
Lummer und später zu Walther Meißner.<br />
Präsident Nernst betreibt mit Unterstützung<br />
des Kuratoriums die Einstellung<br />
eines theoretischen Physikers zur<br />
Stärkung der wissenschaftlichen Arbeiten<br />
der PTR. Max von Laue, seit 1919<br />
Ordinarius für Physik an der Berliner<br />
Universität, übernimmt diese Aufgabe<br />
nebenamtlich und ist einen Tag pro<br />
Woche in der PTR.<br />
1926 – Leuchtresonatoren zur<br />
Frequenzkontrolle<br />
Erich Giebe und Adolf Scheibe entwickeln<br />
„Leuchtresonatoren“, bei denen<br />
die mechanische Resonanz in Quarzschwingern<br />
durch Hochfrequenz angeregt<br />
und über die dabei entstehende<br />
Leuchterscheinung in einer Neonatmosphäre<br />
detektiert wird. Mit einer<br />
Reproduzierbarkeit von 10 −6 werden<br />
die Resonatoren zur Frequenzkontrolle<br />
abstimmbarer Sender eingesetzt.<br />
1926 – Kösters-Komparator<br />
1925 – Ida Tacke<br />
und Walther Noddack<br />
Chronik �<br />
Ein neuartiger Interferenzkomparator<br />
wird zur Längenmessung an Endmaßen<br />
bis 1 m eingesetzt. Ein von Wilhelm<br />
Kösters patentiertes Doppelprisma<br />
erlaubt eine kompakte und luftdichte<br />
Bauweise. Mittels einer Vakuumkammer<br />
kann die Brechzahl der Luft und damit<br />
die Wellenlänge des Lichts deutlich<br />
genauer als zuvor bestimmt werden.<br />
1927 – Neue Temperaturskala<br />
mit Goldfixpunkt<br />
Die langjährigen Bemühungen der<br />
PTR, des britischen National Physical<br />
Laboratory (NPL) und des amerikanischen<br />
National Bureau of Standards<br />
(NBS) werden mit der Verabschiedung<br />
der ersten, über einen weiten Temperaturbereich<br />
gültigen Internationalen<br />
Temperaturskala von Erfolg gekrönt.<br />
Für hohe Temperaturen wird das optische<br />
Pyrometer als Normalinstrument<br />
definiert mit dem Erstarrungspunkt von<br />
Gold als Referenzfixpunkt.<br />
1927<br />
Ida Noddack, geb. Tacke (1896–1978)<br />
studiert als eine der ersten Frauen Chemie<br />
an der TH Charlottenburg und wird ab<br />
1924 Gastwissenschaftlerin an der PTR.<br />
Walther Noddack (1893 – 1960) studiert<br />
an der Berliner Universität Chemie,<br />
Physik und Mathematik und kommt mit<br />
Walter Nernst in die PTR. Dort leitet er<br />
später das Chemische und ab 1927 das<br />
Photochemische Laboratorium. Die Forschungen der Noddacks richten sich auf die Entdeckung<br />
von unbekannten Elementen, damals ein Prestigeprojekt der PTR, aber auch auf Experimente<br />
in der Photo- und Geochemie u. a. zur Zusammensetzung von Meteoriten. Ida Noddack vermutet<br />
bereits 1934, dass man Urankerne durch Neutronenbeschuss spalten könne. Ab 1935 lehrt<br />
Walther Noddack in Freiburg, Straßburg und Bamberg, wohin ihm seine Frau folgt.<br />
25