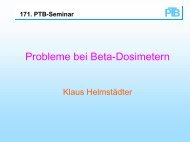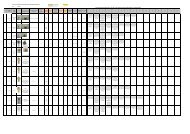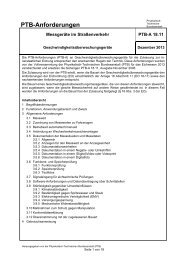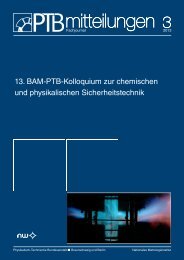PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
PTB-Mitteilungen 2012 Heft 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>PTB</strong>-<strong>Mitteilungen</strong> 122 (<strong>2012</strong>), <strong>Heft</strong> 2<br />
nur außerhalb von öffentlichen Haushalten<br />
gesucht werden. Dies gelang 1912 anlässlich des<br />
25-jährigen Bestehens der PTR durch die Einrichtung<br />
des „Helmholtz-Fonds für wissenschaftliche<br />
Forschung“, den große und kleine Firmen<br />
sowie Privatpersonen mit Kapitaleinlagen von<br />
260 000 Mark speisten. Das jährliche Zinseinkommen<br />
von 10 000 Mark sollte zur Finanzierung<br />
ausgezeichneter Wissenschaftler, für Studien- und<br />
Konferenzreisen und zur Beschaffung teurer<br />
Geräte verwendet werden. Ein Jahr danach richteten<br />
Emil Rathenau und der Aufsichtsrat der AEG<br />
die „Emil-Rathenau-Stiftung“ mit einem Vermögen<br />
von 100 000 Mark an AEG-Wertpapieren mit<br />
den gleichen Zielen ein, allerdings eingeschränkt<br />
auf die Gebiete Elektrizität und Magnetismus.<br />
Neben den knappen Haushaltsmitteln konnten<br />
diese neuartigen Geldquellen genutzt werden, um<br />
sich verstärkt an neue Forschungsgebiete aus der<br />
so genannten Neuen Physik zu wagen. Dazu zählte<br />
man u. a. die neu entdeckten Röntgenstrahlen, die<br />
neuen Vorstellungen vom Atombau nach Rutherford<br />
und Bohr, Einsteins Spezielle Relativitätstheorie,<br />
die Quantenphysik ausgehend vom Schwarzen<br />
Strahler und die Eigenschaften des Elektrons.<br />
Die Erneuerung der Forschungsinhalte der PTR<br />
und damit ihre Rückkehr an die Spitze der Grundlagenforschung<br />
gelangen durch zwei herausragende<br />
Forscherpersönlichkeiten: Hans Geiger und<br />
Walther Meißner.<br />
Radioaktivität war das neue Werkzeug, um den<br />
Atombau und erste Eigenschaften des Atomkerns<br />
zu studieren. Frankreich und England waren<br />
die Hochburgen in dieser Disziplin, mit denen<br />
Deutschland gleichziehen wollte. So war es ein<br />
glücklicher Umstand, dass Hans Geiger, der seit<br />
1907 bei Rutherford in Manchester zahlreiche<br />
Detektoren für die Zählung von α-Teilchen entwickelt<br />
hatte, wieder nach Deutschland zurück wollte.<br />
Warburg schaffte es, dem Pfälzer die Universität<br />
Tübingen auszureden und von den besseren<br />
Möglichkeiten an der PTR zu überzeugen. So baute<br />
Geiger ab 1912 innerhalb des optischen Laboratoriums<br />
der Physikalischen Abteilung in kurzer Zeit<br />
ein Laboratorium für Radioaktivität auf. Maßeinheiten<br />
für radioaktive Strahlung zu definieren und<br />
entsprechende Standards herzustellen war dringend<br />
erforderlich für die rasant zunehmende Anwendung<br />
von strahlenden Präparaten in der Medizin und<br />
somit Geigers Hauptaufgabe. In der verbleibenden<br />
Zeit durfte er eigenen Forschungen nachgehen, die<br />
u. a. den Geigerzähler hervorbrachten und in die<br />
Entwicklung der Koinzidenz-Methode zusammen<br />
mit Walther Bothe mündeten, für die dieser 1954<br />
den Nobelpreis bekam. Mit seinem Team, zu dem<br />
zeitweise auch Walther Meißner und als Gast James<br />
Chadwick, der spätere Entdecker des Neutrons,<br />
gehörten, hatte Geiger in sehr kurzer Zeit ein wissenschaftliches<br />
Zentrum von Weltniveau aufgebaut.<br />
Neue Physik und neue Struktur �<br />
Das Tieftemperaturverhalten von Gasen war seit der Verflüssigung<br />
von Helium durch Kammerlingh Onnes 1908 in Leiden ein wichtiges<br />
Untersuchungsobjekt, um u. a. die Eigenschaften des Gasthermometers,<br />
das die thermodynamische Temperatur anzeigen sollte, besser<br />
zu verstehen. Bei Festkörpern war 1911 ebenfalls in Leiden ein neuer<br />
Zustand der Materie, die Supraleitung, gefunden worden. Thermometrie<br />
und Grundlagenphysik sprachen also gleichermaßen dafür, dass sich<br />
die Reichsanstalt dieses Themas annehmen sollte. Walther Meißner,<br />
der 1907 bei Max Planck an der Berliner Universität promoviert hatte,<br />
gehörte ebenfalls zu der jungen Garde, mit der Warburg in hochaktuelle<br />
Physik einsteigen wollte. Er wurde 1908 in das Wärmelaboratorium<br />
eingestellt und erwies sich bald als einer der führenden Forscher in<br />
der Tieftemperaturphysik. 1913 betraute ihn Warburg mit dem Aufbau<br />
einer Tieftemperaturanlage, die die Untersuchung der Eigenschaften<br />
von flüssigem Wasserstoff ermöglichen sollte. Zu den von Meißner neu<br />
begonnenen Arbeiten gehörten Untersuchungen der elektrischen und<br />
der thermischen Leitfähigkeit von Metallen zwischen 20 K und 373 K.<br />
Der Erste Weltkrieg machte einen Strich durch viele dieser Forschungsvorhaben.<br />
So konnte Meißner erst viel später seine großen wissenschaftlichen<br />
Erfolge feiern wie die Verflüssigung von Helium 1925, die<br />
Entdeckung der Supraleitfähigkeit einer Reihe von Metallen, darunter<br />
um 1928 von Niob, dem „Arbeitspferd“ für supraleitende Schaltungen<br />
bis heute, und 1933 den nach ihm benannten fundamentalen Effekt der<br />
Verdrängung des Magnetfelds aus dem Inneren eines Supraleiters.<br />
Neben der hier nur beispielhaft dargestellten Hinwendung zur Neuen<br />
Physik musste sich Warburg einem weiteren Problem stellen, das bis heute<br />
der <strong>PTB</strong> bewegt, nämlich dem Binnenverhältnis zwischen Grundlagenforschung<br />
und Weitergabe der physikalischen Einheiten an Industrie,<br />
Wissenschaft und Gesellschaft durch Kalibrierungen und Gerätezulassungen.<br />
Es hatten sich in beiden Abteilungen der PTR Parallel-Laboratorien<br />
entwickelt, so z. B. je ein Laboratorium für Elektrizität, je eines für Wärme<br />
und je eines für Optik.<br />
Ernst Hagen, der Direktor der Technischen Abteilung, wies auf ein<br />
durch die ausschließliche Prüftätigkeit in seiner Abteilung verursachtes<br />
Rekrutierungsproblem hin: „Ohne Beigabe der wissenschaftlichen Arbeit<br />
würde es für die Abteilung II unmöglich sein, geeignete Beamte an sich zu<br />
fesseln.“ Hier klingt ein unterschwellig gefühlter Prestigeverlust gegenüber<br />
den forschenden Kollegen an.<br />
Warburg löste daher nach mehrjährigen Diskussionen im Kuratorium<br />
die beiden bisherigen Abteilungen auf und gliederte die PTR in<br />
einer neuen Struktur in fachlich unterschiedene Abteilungen für Optik,<br />
Elektrizität und Wärme, die jede eine rein wissenschaftliche und eine für<br />
Prüfungen zuständige Unterabteilung erhielten. Jede Abteilung bekam<br />
ihren eigenen Direktor, der für die Verbindung von Wissenschaft und<br />
Technik zu sorgen hatte. Der Präsident behielt die übergeordnete Autorität<br />
über alle Abteilungen und die direkte Zuständigkeit für das Präzisionsmechanische<br />
Laboratorium, das Chemische Laboratorium, die Werkstatt<br />
und das störungsfreie Magnetische Laboratorium in Potsdam.Wäre diese<br />
Struktur nicht zwei Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges in<br />
Kraft gesetzt worden, sie hätte sich sofort positiv auswirken können. Ihr<br />
Prinzip bewirkt bis heute einen fairen Ausgleichs zwischen Forschern und<br />
Prüfern in derselben Einheit und erleichtert den sinnvollen Aufgaben-<br />
und Erfahrungsaustausch. Die <strong>PTB</strong> hat dieses Prinzip für die internationale<br />
Evaluation von 2002 in den Terms of Reference festgeschrieben.<br />
Der erneute Aufbruch an die metrologische Spitze nach der ersten<br />
Etablierungsphase war gelungen durch neue Geldquellen, neue relevante<br />
physikalische Themen, neue hervorragende Mitarbeiter, neue zukunftsweisende<br />
Strukturen – und durch den neuen, richtig ausgewählten<br />
Präsidenten. �<br />
21