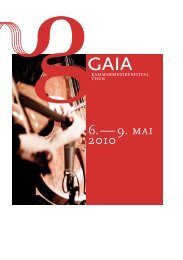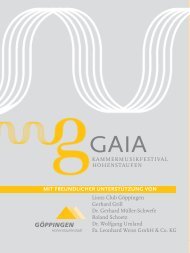f - Gaia Festival
f - Gaia Festival
f - Gaia Festival
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
„Es ist rätselhaft,<br />
und es ist<br />
vollendet“<br />
18<br />
Ganz im Sinne Debussys schrieb der Musikwissenschaftler<br />
Armand Machabey zu Ravels Quartett: „Was an diesem<br />
Werk besticht, ist nicht die Originalität der Form, sondern<br />
die vollendete Ausführung: da stört keine Banalität, da gibt<br />
es keinen Leerlauf; vielmehr herrscht überall Phantasie und<br />
Ideenreichtum, vollendete Ausgewogenheit der Proportionen<br />
und dazu eine solche reine und transparente Klanglichkeit,<br />
die Ravel nur mehr in seinem Klavierwerk Jeux d’eau<br />
erreicht hat.“<br />
Schuberts Streichquintett<br />
Es ist sein einziges Streichquintett und sein letztes Kammermusikwerk...<br />
Was haben wir bei Franz Schubert nicht alles<br />
schon gehört und gelesen von „Reife“ und „Vollendung“ unter<br />
den Rubriken „Spätwerk“ und „Todesahnung“ – was bei<br />
einem gerade Dreißigjährigen ohnehin fragwürdig erscheint.<br />
Hätte er denn danach nichts mehr geschrieben, aber vor<br />
allem: mit welchen Begriffen würden wir sein Werk neu zu<br />
kategorisieren suchen? Letztlich sind wir es, die diese<br />
ebenso bedeutungsschweren wie selten der Musik selbst<br />
innewohnenden Stigmata offenbar benötigen, um halbwegs<br />
sicher durch die Musik aus längst vergangenen Zeiten zu<br />
navigieren. Schuberts Quintett ist ein Solitär insofern, als<br />
man ihm beinahe die Rolle eines ästhetischen Experiments<br />
zuschreiben möchte, bei dem Schubert die Entwicklungslinien<br />
seiner Kammermusik gebündelt und weitergeführt hat.<br />
Besonders auffällig erscheint der bereits im Kopfsatz auftretende<br />
„Schlüsselakkord“, ein aus der Tonika hervortretender<br />
und wieder in sie „zusammenfallender“ verminderter<br />
Septakkord, dem man auch im Streichquartett d-Moll und in<br />
zwei Heine-Vertonungen Schuberts etwa aus derselben Zeit<br />
wiederbegegnet.<br />
Die vier Sätze des Quintetts „verjüngen“ sich nach hinten<br />
in ihrer Dauer; das abschließende Allegretto ist der<br />
kürzeste Satz und wirkt – etwa im Vergleich zum erschüttern<br />
den Ausbruch des halbtönig verschobenen Adagio-Mittelteils<br />
– zunächst unproblematisch und heiter. Doch in<br />
diesem Satz, der in einer „leeren“ Oktave ausklingt, wird<br />
nochmals die ganze Fülle der zuvor verwendeten Ausdrucksmöglichkeiten<br />
konzentriert und reflektiert, zwar im Gewand<br />
eines „normalen“ Rondos, aber nicht als unbekümmertfröhlicher<br />
Kehraus. Andererseits können wir uns aber getrost<br />
an der heiteren Anmutung des Werkes, am Tänzeri -<br />
schen, an den Melodien erfreuen, ohne sogleich an die<br />
posthum verliehene Etikette „Todesahnungen“ erinnert werden<br />
zu müssen – oder doch nicht?<br />
Mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit entstand das Werk<br />
im September 1828 in Wien. Dem Kunsthändler „Probst<br />
Wohlgeboren in Leipzig“ kündigt er das Quintett neben an-<br />
19<br />
Schubert als<br />
Zuhörer bei einer<br />
Quartettaufführung<br />
im Musiksalon<br />
von Johann<br />
Steiger von<br />
Arnstein,<br />
Bleistiftskizze<br />
von Friedrich<br />
Gauermann<br />
(Linz, Oberösterr.<br />
Landesmusem)