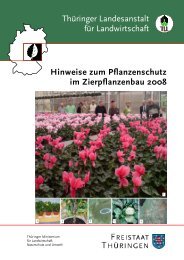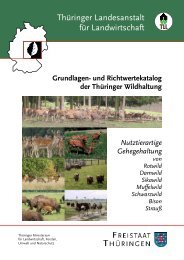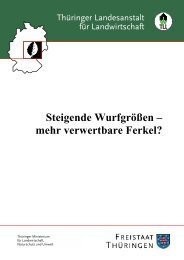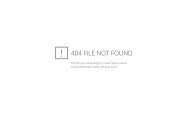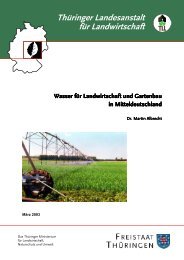Jahresbericht 2004 - TLL
Jahresbericht 2004 - TLL
Jahresbericht 2004 - TLL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tung von Empfehlungen, unter welchen Bedingungen eine optimale Tiergesundheit,<br />
Fruchtbarkeit, Nutzungsdauer und Lebensleistung erzielt werden kann. Zur Untersuchung<br />
kamen:<br />
• Stoffwechselkennwerte im Blut und Harn zur Überwachung der Fütterung,<br />
• Bakteriologische Milchuntersuchungen und Zellgehalte,<br />
• Mikrobiologische Futterqualität,<br />
• Zusätzliche Milchqualitätsparameter,<br />
• Tierärztliche Behandlungen,<br />
• Einfluss von Haltungsformen und Standorten auf die Lebensleistung,<br />
• Optimierung von Lebensleistung und Nutzungsdauer.<br />
Fütterung von Milchkühen in Hochleistungsherden<br />
S. Dunkel, H.-J. Löhnert, W. I. Ochrimenko, G. Früh<br />
Praxisübliche Futterrationen enthalten häufig einen Anteil an unabgebautem Futterrohprotein<br />
(UDP) von 25 % in der Trockenmasse. In der Literatur wird beschrieben,<br />
dass zur Deckung des Proteinbedarfs der Hochleistungskuh die Futterration einen<br />
UDP-Anteil von 30 bis 40 % enthalten muss. Davon ausgehend war in einem<br />
Praxisexperiment zu prüfen, wie Hochleistungskühe auf unterschiedliche UDP-Anteile<br />
in der Futterration reagieren. Es kamen somit zwei Futterrationen zur Testung, die<br />
hinsichtlich der Gehalte an Energie und Rohprotein weitgehend identisch waren und<br />
den Empfehlungen der GfE (2001) entsprachen. Die Variation an unabgebautem<br />
Futterrohprotein erfolgte durch den Einsatz verschiedener geschützter<br />
Extraktionsschrote. Die Ergebnisse des Praxisexperiments mit 70 Milchkühen der<br />
Rasse Holstein, Schwarzbunt belegen, dass unter den geprüften Bedingungen kein<br />
gesicherter Einfluss der unterschiedlichen UDP-Anteile auf die Milchleistungskennzahlen<br />
besteht. Die untersuchten Stoffwechselparameter zeigten keine Belastung<br />
des Leberstoffwechsels an. In der Versuchsgruppe konnte ein höherer Anteil an<br />
Fruchtbarkeitsstörungen festgestellt werden.<br />
Untersuchungen zum optimalen Einsatz von Mischrationen (TMR) in der Kälberaufzucht<br />
H.-J. Löhnert, W. I. Ochrimenko, K. Bremer und O. Jahn<br />
An insgesamt 167 schwarzbunten Kälbern wurden die Futter- und Nährstoffaufnahme,<br />
die täglichen Lebendmassezunahmen sowie die durchgeführten Behandlungen in einem<br />
vorgegebenen Aufzuchtregime unter Praxisbedingungen analysiert. Im Mittel der<br />
Untersuchungen betrug die tägliche Trockenmasseaufnahme der Kälber 2,58 kg.<br />
Mit 416 g Rohprotein und 32,6 MJ umsetzbarer Energie/Tier und Tag nahmen die Kälber<br />
die von der GfE empfohlenen Nährstoffmengen auf.<br />
Die Kälber erreichten im untersuchten Lebendmasseabschnitt zwischen 44 kg bis zu<br />
138 kg eine mittlere tägliche Lebendmassezunahme von 919 g. Dabei traten Schwankungen<br />
von 726 bis 1 073 g/Tier und Tag zwischen den Gruppen auf. Tiere, die in diesem<br />
Zeitraum eine wesentlich geringere Zuwachsleistung aufwiesen, konnten den entstandenen<br />
Lebendmasserückstand auch bis zu einem Alter von einem Jahr nicht kompensieren.<br />
In den Untersuchungen wurden alle Kälber ca. 11-mal je Tier behandelt (einschließlich<br />
oral verabreichter Medikamente), wobei erhebliche Unterschiede zwischen den Gruppen<br />
bestanden. Mit 58 % nahmen die Atemwegserkrankungen den größten Anteil ein.<br />
70 % aller Behandlungen entfielen auf die ersten vier Wochen der Untersuchung.<br />
Schriftenreihe der <strong>TLL</strong> 24 2/2005