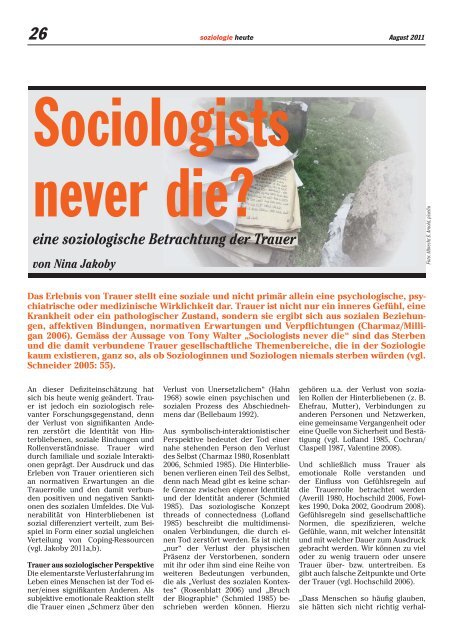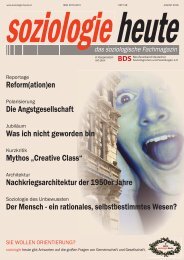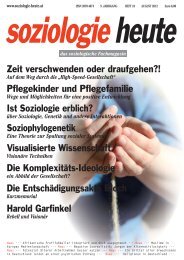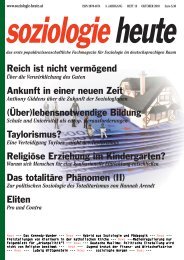soziologie heute August 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
26 <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> <strong>August</strong> <strong>2011</strong><br />
Sociologists<br />
never die?<br />
eine soziologische Betrachtung der Trauer<br />
von Nina Jakoby<br />
Foto: Albrecht E. Arnold, pixelio<br />
Das Erlebnis von Trauer stellt eine soziale und nicht primär allein eine psychologische, psychiatrische<br />
oder medizinische Wirklichkeit dar. Trauer ist nicht nur ein inneres Gefühl, eine<br />
Krankheit oder ein pathologischer Zustand, sondern sie ergibt sich aus sozialen Beziehungen,<br />
affektiven Bindungen, normativen Erwartungen und Verpflichtungen (Charmaz/Milligan<br />
2006). Gemäss der Aussage von Tony Walter „Sociologists never die“ sind das Sterben<br />
und die damit verbundene Trauer gesellschaftliche Themenbereiche, die in der Soziologie<br />
kaum existieren, ganz so, als ob Soziologinnen und Soziologen niemals sterben würden (vgl.<br />
Schneider 2005: 55).<br />
An dieser Defiziteinschätzung hat<br />
sich bis <strong>heute</strong> wenig geändert. Trauer<br />
ist jedoch ein soziologisch relevanter<br />
Forschungsgegenstand, denn<br />
der Verlust von signifikanten Anderen<br />
zerstört die Identität von Hinterbliebenen,<br />
soziale Bindungen und<br />
Rollenverständnisse. Trauer wird<br />
durch familiale und soziale Interaktionen<br />
geprägt. Der Ausdruck und das<br />
Erleben von Trauer orientieren sich<br />
an normativen Erwartungen an die<br />
Trauerrolle und den damit verbunden<br />
positiven und negativen Sanktionen<br />
des sozialen Umfeldes. Die Vulnerabilität<br />
von Hinterbliebenen ist<br />
sozial differenziert verteilt, zum Beispiel<br />
in Form einer sozial ungleichen<br />
Verteilung von Coping-Ressourcen<br />
(vgl. Jakoby <strong>2011</strong>a,b).<br />
Trauer aus soziologischer Perspektive<br />
Die elementarste Verlusterfahrung im<br />
Leben eines Menschen ist der Tod einer/eines<br />
signifikanten Anderen. Als<br />
subjektive emotionale Reaktion stellt<br />
die Trauer einen „Schmerz über den<br />
Verlust von Unersetzlichem“ (Hahn<br />
1968) sowie einen psychischen und<br />
sozialen Prozess des Abschiednehmens<br />
dar (Bellebaum 1992).<br />
Aus symbolisch-interaktionistischer<br />
Perspektive bedeutet der Tod einer<br />
nahe stehenden Person den Verlust<br />
des Selbst (Charmaz 1980, Rosenblatt<br />
2006, Schmied 1985). Die Hinterbliebenen<br />
verlieren einen Teil des Selbst,<br />
denn nach Mead gibt es keine scharfe<br />
Grenze zwischen eigener Identität<br />
und der Identität anderer (Schmied<br />
1985). Das soziologische Konzept<br />
threads of connectedness (Lofland<br />
1985) beschreibt die multidimensionalen<br />
Verbindungen, die durch einen<br />
Tod zerstört werden. Es ist nicht<br />
„nur“ der Verlust der physischen<br />
Präsenz der Verstorbenen, sondern<br />
mit ihr oder ihm sind eine Reihe von<br />
weiteren Bedeutungen verbunden,<br />
die als „Verlust des sozialen Kontextes“<br />
(Rosenblatt 2006) und „Bruch<br />
der Biographie“ (Schmied 1985) beschrieben<br />
werden können. Hierzu<br />
gehören u.a. der Verlust von sozialen<br />
Rollen der Hinterbliebenen (z. B.<br />
Ehefrau, Mutter), Verbindungen zu<br />
anderen Personen und Netzwerken,<br />
eine gemeinsame Vergangenheit oder<br />
eine Quelle von Sicherheit und Bestätigung<br />
(vgl. Lofland 1985, Cochran/<br />
Claspell 1987, Valentine 2008).<br />
Und schließlich muss Trauer als<br />
emotionale Rolle verstanden und<br />
der Einfluss von Gefühlsregeln auf<br />
die Trauerrolle betrachtet werden<br />
(Averill 1980, Hochschild 2006, Fowlkes<br />
1990, Doka 2002, Goodrum 2008).<br />
Gefühlsregeln sind gesellschaftliche<br />
Normen, die spezifizieren, welche<br />
Gefühle, wann, mit welcher Intensität<br />
und mit welcher Dauer zum Ausdruck<br />
gebracht werden. Wir können zu viel<br />
oder zu wenig trauern oder unsere<br />
Trauer über- bzw. untertreiben. Es<br />
gibt auch falsche Zeitpunkte und Orte<br />
der Trauer (vgl. Hochschild 2006).<br />
„Dass Menschen so häufig glauben,<br />
sie hätten sich nicht richtig verhal-