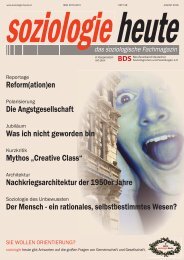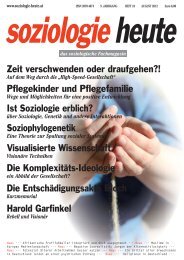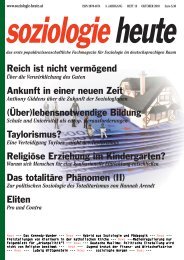soziologie heute August 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>August</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 7<br />
Man tut immer so, als ginge es bei der Allgemeinbildung darum, die Geburtsdaten von<br />
Kaiserin Maria Theresia, die Symphonien von Goethe oder die Dramen von Mozart (oder<br />
so ähnlich) aufzählen zu können. In Wahrheit geht es um etwas völlig anderes, und das<br />
sei kurz am Beispiel des Verständnisses für eine demokratische Ordnung, das wir möglicherweise<br />
konsensuell als relevante Befähigung erachten könnten, erläutert.<br />
Manfred Prisching<br />
Universitätsprofessor an der<br />
Karl-Franzens-Universität Graz/<br />
Sowi-Fakultät/Institut f. Soziologie<br />
Man wird das Wesen, die Gefährdungen und die Funktionsfähigkeit einer Demokratie,<br />
auch „unserer“ Demokratie, nicht verstehen, wenn man nicht die griechischen Ursprünge<br />
des Systems betrachtet (was waren die populistischen Gefahren, warum hatte das<br />
Modell einen elitären Charakter?); wenn man nicht die große römische Leistung analysiert,<br />
Elite und Volk in zwei gleichberechtigten Versammlungen zu institutionalisieren<br />
(warum gibt es in fast allen Verfassungen zwei Kammern, und warum heißt in den<br />
USA eine davon „Senat“?); wenn man nicht die große Leistung der Aufklärungsphilosophen<br />
nachvollziehen kann, institutionelle Vorkehrungen gegen den Machtmissbrauch<br />
zu schaffen (wie bastelt man eine Verfassung, die einerseits der Regierung Schlagkraft<br />
sichert, andererseits ihre Entartung zuverlässig durch Gegenmächte und Bremsmechanismen<br />
verhindert?); wenn man nicht die außerordentliche europäische Errungenschaft<br />
würdigen kann, Kirche und Staat (nach enormen Opfern) säuberlich voneinander zu<br />
trennen (warum war diese Trennung, die uns <strong>heute</strong> selbstverständlich dünkt, im Verständnis<br />
von Zeitgenossen so sensationell?); wenn man sich nicht in die Diskussion der<br />
Zwischenkriegszeit hineindenken kann, wer konstitutionell als „Hüter der Verfassung“<br />
aufzutreten hätte.<br />
Man kann freilich sagen, die Demokratie sei ohnehin gesichert, Wahlen seien nicht erklärungsbedürftig,<br />
über Populismus wüssten wir Bescheid, Boulevardzeitungen genügten,<br />
man müsse die Machtverhältnisse einer Demokratie oder die unterschiedliche politische<br />
Logik anderer Kulturkreise nicht verstehen… Aber Demokratie ohne Allgemeinbildung<br />
ist ein Leichtsinn oder eine Dummheit. Fallstudien dieser Art lassen sich auch für<br />
andere Lebensbereiche erzählen.<br />
Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand <strong>heute</strong> einen Beruf erlernt, den er in gleicher Weise<br />
noch kurz vor der Rente ausübt, wird aufgrund der sich immer schneller verändernden<br />
gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Anforderungen immer geringer.<br />
Selbst traditionelle handwerkliche Berufe erleben die Einflüsse durch Globalisierung<br />
und Informationstechnologie im Arbeitsalltag. Spezial- und Faktenwissen veraltet in immer<br />
kürzerer Zeit. Allgemeinwissen dagegen basiert oft auf Jahrhunderte alten Erkenntnissen,<br />
deren Gesetzmäßigkeiten noch <strong>heute</strong> gültig sind.<br />
Allgemeinbildung?<br />
Bereits <strong>heute</strong> zeigt sich, dass sich die Lebensläufe der zukünftigen Generationen durch<br />
vielfältige Berufsstationen und Aufgaben auszeichnen werden. Allein deshalb würde<br />
eine reine Spezialisierung in eine persönliche und gesellschaftliche Sackgasse führen. Je<br />
mehr Wissen dem Einzelnen, nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite zur Verfügung<br />
steht, desto kreativer können Lösungen erarbeitet und desto schneller können<br />
neue Aufgaben bewältigt werden.<br />
Wer beurteilen möchte, ob seine angedachten Lösungen hilfreich für seine jeweilige<br />
Fragestellung sind, muss Vergleiche anstellen können. Dies erfordert übergeordnete<br />
Kenntnisse, um das Wissen in Gesamtzusammenhänge einordnen und in sinnvolles oder<br />
sinnloses, relevantes oder belangloses Wissen einteilen zu können. Wer über eine gute<br />
Allgemeinbildung verfügt, besitzt dieses Wissen. Er kann sich aufgrund dieser Tatsache<br />
schnell in Spezialthemen einarbeiten. Umgekehrt funktioniert dies nicht.<br />
Bernd Vonhoff<br />
Vorsitzender des Berufsverbandes<br />
Deutscher SoziologInnen,<br />
Geschäftsführer der FSV-Netzwerk<br />
GmbH, Autor von „Erfolgsfaktor<br />
Sinn”<br />
Wer im Fazit über sein Spezialwissen hinaus über eine große Allgemeinbildung verfügt,<br />
kann in komplexen Situationen leicht erkennen, wann das Spezialwissen allein für eine<br />
Problemstellung nicht mehr ausreicht. In diesen Fällen wird derjenige auf Spezialisten<br />
anderer Fachgebiete zugreifen. Über diesen Weg werden Synergieeffekte erzeugt, die<br />
neue Lösungen und neue Wege des Handelns eröffnen.