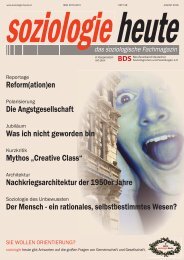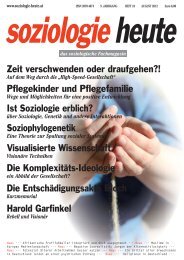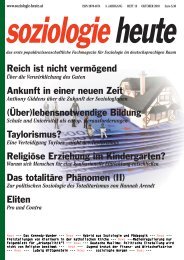soziologie heute August 2011
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum. Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Das erste und einzige illustrierte soziologische Fachmagazin im deutschsprachigen Raum.
Wollen Sie mehr über Soziologie erfahren? www.soziologie-heute.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>August</strong> <strong>2011</strong> <strong>soziologie</strong> <strong>heute</strong> 35<br />
y<br />
Robert K. Merton (ursprünglich<br />
Mayer Robert Schkolnick) kam am<br />
4. Juli 1910 in Philadelphia (USA)<br />
als Sohn russisch-jüdischer Einwanderer<br />
zur Welt. Der Name Robert K.<br />
Merton rührt eigentlich aus seinen<br />
Zaubervorstellungen, für welche er<br />
zunächst den Künstlernamen „Merlin“<br />
und später - in Erinnerung an<br />
den französischen Zauberer Robert<br />
Houdin - seinen Namen auf Robert<br />
King Merton änderte.<br />
1927 begann er seine soziologische<br />
Karriere als Forschungsassistent bei<br />
George E. Simpson in Philadelphia<br />
und wechselte 1931 nach Harvard<br />
zu Pitirim Sorokin. 1934 heiratete er<br />
seine erste Frau, Suzanne Carhart.<br />
Aus dieser Ehe entstammen neben<br />
zwei Töchtern auch der spätere<br />
Wirtschafts-Nobelpreisträger Robert<br />
C. Merton.<br />
Bereits in frühen Jahren war Merton<br />
ein begeisterter Schüler Talcott<br />
Parsons, bei welchem er nicht nur<br />
Seminare besuchte, sondern auch<br />
Teilnehmer dessen informeller Soziologierunde<br />
war, die sich regelmäßig<br />
in Adams House traf. In seiner<br />
Doktorarbeit zeigte Merton auf, wie<br />
groß der Einfluss des Zeitgeistes auf<br />
die verschiedensten Wissenschaftsrichtungen<br />
ist.<br />
1938 wurde er Professor und leitete<br />
die Abteilung Soziologie an der Tulane<br />
University und drei Jahre später<br />
Giddings Professor für Soziologie.<br />
Ab 1941 war Merton dann Mitglied<br />
des Sociology Departments der Columbia<br />
University. Gemeinsam mit<br />
Paul Lazarsfeld leitete er das Bureau<br />
of Applied Social Research.<br />
Das 1949 erstmals<br />
erschienene<br />
Werk „Social<br />
Theory and Social<br />
Structure“<br />
erreichte bis zu<br />
Mertons Tod 29<br />
Auflagen.<br />
U.a. führte Merton gemeinsam mit<br />
Lazarsfeld, zahlreichen Kollegen und<br />
Studenten Studien zur Propaganda<br />
und Massenkommunikation während<br />
des 2. Weltkrieges durch und<br />
schrieb den Klassiker Mass Persuasion<br />
(1946). Obwohl Lazarsfeld der<br />
eigentliche Methodiker war, ließ es<br />
sich Merton nicht nehmen, innovative<br />
Forschungsmethoden einzuführen.<br />
So entwickelte er gemeinsam<br />
mit Marjorie Fiske und Patricia Kendall<br />
das sog. „Fokusgruppen-Interview“,<br />
welches aus der <strong>heute</strong> üblichen<br />
Markt- und Meinungsforschung<br />
nicht mehr wegzudenken ist. Später<br />
meinte Merton einmal, dass die Fokusgruppen<br />
zwar kein Ersatz für repräsentative<br />
Umfragen seien, doch<br />
wenn er für jeden Einsatz dieser Methode<br />
eine kleine Gebühr erhalten<br />
hätte, wäre er reich wie ein König.<br />
1974 wurde Merton schließlich Universitätsprofessor<br />
und im Jahr 1979<br />
wechselte er offiziell in den Ruhestand,<br />
was allerdings nicht bedeutete,<br />
dass er der Soziologie den Rücken<br />
kehrte. Erst 1984 zog er sich<br />
aus der Lehre zurück. 1993 heiratete<br />
er die Soziologin Harriet Zuckerman.<br />
Am 23. Februar 2003 starb Robert K.<br />
Merton in New York.<br />
So bedeutend Robert K. Merton<br />
auch als Forscher war, noch größer<br />
war seine Wirkung als Mentor und<br />
Motivator auf eine ganze Reihe bedeutender<br />
Soziologen wie z. B. Peter<br />
Blau, Lewis Coser, James Coleman,<br />
Seymour Martin Lipset, Alvin Gouldner<br />
usf. Neben zahlreichen leitenden<br />
wissenschaftlichen Funktionen war<br />
Merton auch mehr als 20facher Ehrendoktor,<br />
und der erste Soziologe,<br />
der die US-Wissenschaftsmedaille<br />
erhielt. Zwischen 1970 und 1977 war<br />
er der mit Abstand am häufigsten<br />
zitierte Soziologe, wobei lediglich<br />
rund 40 Prozent der Verweise aus<br />
soziologischen Schriften stammten.<br />
Sein 1949 erstmals erschienenes<br />
Werk Social Theory and Social Structure 1<br />
erreichte bis zu seinem Tod 29 Auflagen.<br />
Zahlreiche wissenschaftliche Begriffe<br />
gehen auf Robert K. Merton zurück.<br />
So prägte er u. a. die Begriffe<br />
Focus Group, selbsterfüllende Prophezeiung,<br />
Matthäuseffekt, Serendipity, learned incapacity<br />
oder anticipatory socialization.<br />
Self-fulfilling prophecy<br />
(sich selbst erfüllende Prophezeiung) 2<br />
In Anlehnung an den amerikanischen<br />
Soziologen William I. Thomas (“If<br />
men define situations as real, they<br />
are real in their consequences.”) 3<br />
prägte Merton 1948 die Begriffe<br />
self-fulfi lling prophecy und self-destroying<br />
prophecy, mit welchen er die Auswirkungen<br />
bestimmter Einstellungen<br />
und Handlungsweisen analysierte.<br />
Bei der sich selbst erfüllenden Prophezeiung<br />
handelt es sich um eine<br />
Vorhersage, welche sich – gerade<br />
deswegen – erfüllt, weil man an diese<br />
Prophezeiung glaubt und sich dementsprechend<br />
verhält. So könnte<br />
etwa das Gerücht, dass die Bank XY<br />
nicht liquide sei, durch die darauf<br />
einsetzende, panikartige Ablösung<br />
von Konten seitens der Kunden zu<br />
ihrem tatsächlichen Zusammenbruch<br />
führen. Und im Falle einer selfdestroying<br />
prophecy verhalten sich die<br />
Betreffenden eben so, dass diese<br />
Vorhersage nicht in Erfüllung geht.<br />
Untersuchungen brachten zutage,<br />
dass die Schulbildung ungeachtet<br />
der Begabungen von den Erwartungen<br />
der Lehrer und dem Selbstwertgefühl<br />
der Schüler beeinflusst wird.<br />
Im damaligen Amerika waren die<br />
Schulklassen noch größtenteils nach<br />
Hautfarbe sortiert. Kenneth Clark,<br />
ein Anhänger Mertons, zeigte auf,<br />
dass gerade diese Trennung bei Lehrern<br />
und auch Schülern zu schlechteren<br />
Leistungen bei den Farbigen<br />
führte. Unter Berufung auf die selffulfilling<br />
prophecy fällte das Oberste<br />
Gericht eine Entscheidung, welche<br />
letztlich zur Beseitigung der Rassentrennung<br />
im Schulunterricht führte.<br />
Serendipity<br />
Merton, Robert<br />
K./Barber, Elinor:<br />
THE TRAVELS AND<br />
ADVENTURES OF<br />
SERENDIPITY: A<br />
Study in Sociological<br />
Semantics and<br />
the Sociology of<br />
Science. Princeton<br />
University Press,<br />
2006.