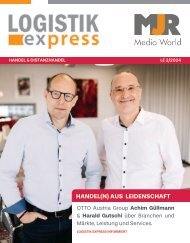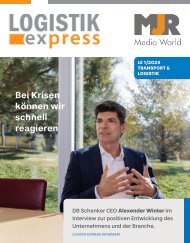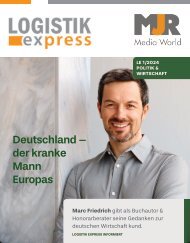UmweltJournal Ausgabe 2018-01
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Jänner <strong>2<strong>01</strong>8</strong>/ <strong>UmweltJournal</strong> ... UND PERSPEKTIVEN<br />
3<br />
Theaterboden<br />
Vorhang auf<br />
Bretter, die die Welt bedeuten … Schwarzkiefern<br />
der Bundesforste lieferten die Bretter für den neuen<br />
Bühnenboden im Theater in der Josefstadt, einem der<br />
traditionsreichsten Theater Europas.<br />
Prominente Verwendung<br />
fanden 20 Schwarzkiefern<br />
(Pinus nigra), die die<br />
Österreichischen Bundesforste<br />
(ÖBf) in ihren Wäldern im Wienerwald<br />
südlich von Wien zu Jahresbeginn<br />
ernteten und das Holz<br />
für den neuen Bühnenboden<br />
des renommierten Theaters in<br />
der Josefstadt in Wien lieferten.<br />
Die Neuverlegung des Bühnenbodens<br />
auf einer Gesamtfläche<br />
von circa 170 Quadratmetern<br />
inklusive der Herstellung aller<br />
notwendigen Einbauten wie<br />
Drehscheibenausschnitt, zehn<br />
Versenkungsdeckel und 15 Versatzklappen<br />
für Licht und<br />
Tontechnik, erfolgte im Juli in<br />
vier Wochen geschäftiger Bauzeit<br />
hinter den Kulissen während<br />
der Sommerpause.<br />
Pünktlich Anfang September<br />
startete die „Josefstadt“ mit einer<br />
„doppelten“ Uraufführung fulminant<br />
in die neue Saison: Mit der<br />
Erstaufführung von „Der Engel mit<br />
der Posaune“ mit Maria Köstlinger,<br />
Michael Dangl und Alma Hasun in<br />
den Hauptrollen und der „Feuertaufe“<br />
des neuen Bühnenbodens,<br />
der eine im wörtlichen Sinne tragende<br />
Rolle am gelungenen Saisonauftakt<br />
übernommen hat.<br />
Harzanteil<br />
verhindert Knarren<br />
„Das Holz der Schwarzkiefer<br />
wird traditionell gerne für Theaterböden<br />
verwendet. Sein besonders<br />
hoher Harzanteil verhindert<br />
nämlich das unerwünschte<br />
Knarren der Holzdielen“, weiß<br />
Rudolf Freidhager, Vorstand der<br />
Bundesforste, die das Holz für<br />
den neuen Bühnenboden in der<br />
Josefstadt zur Verfügung stellten.<br />
„Alleine in dieser Saison<br />
stehen 333 Vorstellungen am<br />
Spielplan der „Josefstadt“, der<br />
Boden wird also sehr belastet<br />
und wenn er knarrte, wäre das<br />
schrecklich. Das Holz muss viel<br />
aushalten, aber dennoch elastisch<br />
genug sein für täglich neues Befestigen<br />
von Dekorationsteilen<br />
mittels Schrauben, Nägeln und<br />
sogenannten Bühnenbohrern“,<br />
ergänzt Josefstadtdirektor Kammerschauspieler<br />
Herbert Föttinger.<br />
„Außerdem darf so ein Bühnenboden<br />
weder glänzen noch<br />
spiegeln und muss den täglichen<br />
Auf- und Abbau der Bühnenbild-<br />
Dekoration und den Transport<br />
schwerer Teile mit Dekorationswägen<br />
problemlos schaffen.“<br />
Schwarzkiefer-Giganten aus<br />
dem Wienerwald<br />
Das Holz für den neuen Bühnenboden<br />
stammt aus der Region –<br />
aus dem Wienerwald, dem Bundesforste-Revier-Hinterbrühl<br />
bei Wien. Dort hatten sich Förster<br />
der Bundesforste bereits letzten<br />
Winter auf die Suche nach<br />
geeigneten Schwarzkiefern gemacht.<br />
„Für den Bühnenboden<br />
wurden schließlich 20 stattliche<br />
Schwarzkiefern mit einer Höhe<br />
von bis zu 30 Metern und einem<br />
Durchmesser von mehr als 60<br />
Zentimetern ausgewählt“, erklärt<br />
Rudolf Freidhager. „Die Bäume<br />
waren regelrechte Giganten und<br />
einige Exemplare bis zu 130 Jahre<br />
alt.“ Zum idealen Erntezeitpunkt<br />
– im Winter - wurden die<br />
Bäume noch geerntet. „Gerade<br />
in tiefen Lagen gilt der Winter als<br />
gute Zeit für die Holzernte. Die<br />
Bäume stehen in sogenannter<br />
Saftruhe, der gefrorene Boden ist<br />
gut befahrbar und im besten Fall<br />
schützt eine Schneedecke Jungbäume<br />
und Waldboden“, erklärt<br />
Rudolf Freidhager.<br />
Nach der Ernte wurde die<br />
gewaltigen Stämme in ein niederösterreichisches<br />
Sägewerk gebracht,<br />
wo sie eingeschnitten und<br />
zu Brettern verarbeitet wurden.<br />
Anschließend kamen die Bretter<br />
Drehscheibe des Bühnenbodens neu verlegt.<br />
noch für drei Wochen in die Trockenkammer,<br />
bevor sie für den<br />
Bühnenboden weiterverarbeitet<br />
werden konnten.<br />
Vielseitige Schwarzkiefer<br />
„Die Schwarzkiefer ist ein ganz<br />
besonderer Baum, der vorwiegend<br />
im Osten Österreichs<br />
vorkommt. Früher wurde die<br />
Schwarzkiefer auch als „Pinus<br />
nigra austriaca“ bezeichnet“,<br />
führt Freidhager aus.<br />
Die größten Schwarzkiefer-<br />
Vorkommen sind im südlichen<br />
Wienerwald zu finden, wo sie die<br />
häufigste Nadelbaumart stellen.<br />
In Zeiten des Klimawandels ist<br />
die Schwarzkiefer wertvoller Bestandteil<br />
artenreicher Wälder. Sie<br />
kommt sehr gut mit Trockenheit<br />
zurecht und gedeiht auch auf<br />
nährstoffarmen Böden prächtig.<br />
Das stark harzhaltige Holz gilt<br />
zwar in der Verarbeitung als aufwändig,<br />
dennoch findet es vielseitige<br />
Verwendung: als Bühnen-,<br />
Bau- und Konstruktionsholz,<br />
Möbelholz sowie als Industrieholz<br />
etwa für Plattenwerkstoffe.<br />
Das Harz der Schwarzkiefer wird<br />
unter anderem für Naturkosmetik<br />
oder als Bogenharz für Streichinstrumente<br />
eingesetzt.<br />
Theater in der Josefstadt<br />
Foto: ÖBf-Archiv/W. Simlinger, K.Kemp Foto: ÖBf-Archiv/ C. Fürthner<br />
ÖBf-Vorstand Rudolf<br />
Freidhager und Josefstadt-<br />
Direktor Herbert Föttinger auf<br />
dem neuen Bühnenboden im<br />
„Josefstadt“.<br />
Das 1788 gegründete Theater in<br />
der Josefstadt ist heute die älteste<br />
durchgehend bespielte Bühne<br />
des deutschsprachigen Raums<br />
und birgt ein Stück Theatergeschichte,<br />
das aus der Tradition<br />
und Historie Wiens nicht mehr<br />
wegzudenken ist. Mit mehr als<br />
350.000 Besuchern und über<br />
700 Vorstellungen pro Spielzeit<br />
gilt das Theater in der Josefstadt<br />
als eine der erfolgreichsten<br />
Bühnen der deutschsprachigen<br />
Theaterlandschaft. Größen wie<br />
Ferdinand Raimund oder Johann<br />
Nestroy spielten bereits auf<br />
der Josefstadtbühne, Ludwig van<br />
Beethoven dirigierte. In der Ära<br />
von Max Reinhardt erhielt das<br />
Theater seine heutige architektonische<br />
Gestalt. Heute arbeitet<br />
unter Direktor Herbert Föttinger<br />
ein dem Gegenwartstheater<br />
verpflichtetes Team an Ur- und<br />
Erstaufführungen und zeitgenössischen<br />
Interpretationen.<br />
Naturstromspeicher Gaildorf<br />
Wind- und<br />
Wasserkraft kombiniert<br />
Max Bögl Wind AG: Flexible Wasserbatterie und<br />
modernste Hybridturmtechnik für Windkraftanlagen<br />
können zusammenspielen.<br />
Die Max Bögl Wind AG<br />
setzt neue Maßstäbe:<br />
Mit Nabenhöhen von<br />
bis zu 178 Metern werden vier<br />
Hybridtürme mit je 3,4 Megawatt<br />
(MW) Leistung bei einem<br />
Pilotprojekt in Gaildorf (D)<br />
ab Oktober 2<strong>01</strong>7 einen neuen<br />
Weltrekord aufstellen. Kombiniert<br />
wird der Windpark mit<br />
einem Pumpspeicherkraftwerk.<br />
Damit entsteht ein natürlicher<br />
Stromspeicher, der auf Wasser<br />
baut – die sogenannte Wasserbatterie.<br />
Sie dient als Kurzzeitspeicher<br />
und trägt dazu bei, das<br />
Stromnetz in Zukunft stabil zu<br />
halten.<br />
Wasser liefert Strom<br />
Die Idee hinter der Kombination<br />
aus zwei erneuerbaren<br />
Energien in Gaildorf (Baden-<br />
Württemberg): Dort, wo große<br />
Betonfundamente auf einem<br />
Berg errichtet werden, lassen<br />
sich diese auch zu Wasserbecken<br />
ausbauen. Durch die<br />
Wasserspeicher im Turmfundament<br />
werden zusätzliche Meter<br />
Nabenhöhe gewonnen und<br />
damit mehr Windausbeute erzielt.<br />
PE-Druckrohrleitungen<br />
verbinden diese Oberbecken<br />
mit einem Wasserkraftwerk<br />
und dem dazugehörigen Unterbecken<br />
200 Meter tiefer im Tal.<br />
Die Wasserbatterie senkt den<br />
Bedarf an chemischen Großspeichern<br />
und stellt eine natürliche<br />
Alternative dar. Aufwendige<br />
Genehmigungsverfahren, wie<br />
sie bei konventionellen Pumpspeicherkraftwerken<br />
vorhanden<br />
sind, entfallen, da bei der Wasserbatterie<br />
massive Einschnitte<br />
in die Natur nicht nötig sind.<br />
Hinter dem Projekt steht<br />
das Unternehmen Max Bögl<br />
Foto: Max Bögl Wind AG<br />
Der Naturstromspeicher Gaildorf<br />
(D) ist ein in Bau befindliches<br />
Energieprojekt bei Gaildorf,<br />
bei dem ein Windpark mit<br />
einem Pumpspeicherkraftwerk<br />
kombiniert wird. Das Projekt<br />
wurde im September 2<strong>01</strong>1 der<br />
Öffentlichkeit vorgestellt; der<br />
Spatenstich erfolgte im April<br />
2<strong>01</strong>6. Die Windkraftanlagen,<br />
in deren Turmfuß Wasser gespeichert<br />
wird, sollen bis Ende<br />
2<strong>01</strong>7 in Betrieb genommen<br />
werden, das Pumpspeicherwerk<br />
ein Jahr später.<br />
Wind AG, eine Tochtergesellschaft<br />
von Max Bögl. <br />
Huber: Klärschlammverwertungsanlage in Medellin<br />
Täglich 400 Tonnen Klärschlamm<br />
In der kolumbianischen Großstadt Medellin wird die neue Kläranlage Bello für 2,75 Millionen Einwohnergleichwerte<br />
mit einer Kapazität von 6,5 Kubikmetern pro Sekunde gebaut. Zur Behandlung des dabei entstehenden Klärschlamms<br />
installiert Huber seinen bewährten Huber Bandtrockner BT und realisiert damit ein internationales Megaprojekt.<br />
Andreas Babler, Bürgermeister Traiskirchen (l.) und Wien Energie<br />
Geschäftsführer Karl Gruber (r.) bei der Eröffnung des Bürgersolarkraftwerks<br />
in Traiskirchen.<br />
TECHNISCHE DATEN<br />
Standort: ............................. Kläranlage Traiskirchen<br />
Leistung: ............................. 175 Kilowattpeak (kWp)<br />
Jährliche Produktion: ....... 183.000 Kilowattstunden pro Jahr<br />
Versorgung: ........................ Eigenversorgung, umgerechnet rd.<br />
73 Haushalte<br />
Anzahl Paneele: ................. rd. 674 Stück<br />
CO2-Einsparung: .............. ca. 63 Tonnen CO 2<br />
jährlich<br />
Foto: Wien Energie/FOTObyHOFER<br />
Ganze 400 Tonnen entwässerter<br />
Klärschlamm fallen täglich in der<br />
Kläranlage Bello (gesprochen Bejo)<br />
in Medellin an. Davon produziert die Kläranlage<br />
selbst circa 310 Tonnen, weitere 90<br />
Tonnen stammen aus einer zweiten Kläranlage<br />
San Fernando, die sich in der Innenstadt<br />
der kolumbianischen Großstadt befindet.<br />
Die Schlämme aus San Fernando werden per<br />
LKW nach Bello gebracht. Entsprechende<br />
Transport-, Annahme- und Lagereinrichtungen<br />
werden vorgesehen.<br />
Der Betreiber der Anlage, Empresas Publicas<br />
de Medellin (EPM), wollte nun eine<br />
nachhaltige und wirtschaftliche Entsorgung<br />
des entstehenden Klärschlammes erreichen.<br />
Daher wurden verschiedenste Lösungen<br />
geprüft. Das gewählte Konzept sah nun die<br />
Kombination einer Kraftwärmekopplung<br />
mit Klärschlammtrocknung vor. Nach der<br />
Evaluation der eingegangen Angebote erhielt<br />
Grafik: Huber<br />
Systemdarstellung des Huber Bandtrockners<br />
BT, der derzeit in der Kläranlage Bello in<br />
Medellin installiert wird.<br />
vor etwa einem Jahr ein Konsortium unter<br />
der Führung von Huber den Zuschlag. Der<br />
Auftragswert für die Gesamtleistung beträgt<br />
über 50 Millionen US Dollar. Die Bauzeit beträgt<br />
22 Monate.<br />
Zum Betrieb dieser Kläranlage erzeugen<br />
vom Konsortium gelieferte lastabhängig<br />
gesteuerte Gasturbinen Strom. Die dabei<br />
anfallende Abwärme wird nun gleichzeitig<br />
zur Klärschlammtrocknung in der Huber<br />
Bandtrocknungsanlage verwendet. Dadurch<br />
wird ein weiterer Schritt in Richtung<br />
energieoptimierten Betrieb der Gesamtkläranlage<br />
ermöglicht. Überschüssige<br />
elektrische Energie wird an das öffentliche<br />
Stromversorgungsnetz abgegeben. Das<br />
hier umgesetzte Konzept zur Klärschlammverwertung<br />
ist nicht nur wegweisend für<br />
Lateinamerika, sondern kann auch hier in<br />
Europa als innovative Lösung mit anschließender<br />
thermischer Verwertung und Phosphorrückgewinnung<br />
(etwa im Rahmen der<br />
Novelle der Klärschlammverordnung in<br />
Deutschland) dienen.