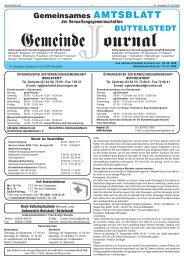farbigen Anzeige - Thalborn Immer einen Klick wert
farbigen Anzeige - Thalborn Immer einen Klick wert
farbigen Anzeige - Thalborn Immer einen Klick wert
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Gemeindejournal - VG Berlstedt / VG Buttelstedt -<br />
- 13 -<br />
K L E I N O B R I N G E N<br />
04. Ausgabe, 29. April 2010<br />
Bürgermeister: Gerhard Schauerhammer Gemeindeanschrift: Verwaltungsgemeinschaft Buttelstedt Telefon: (03643) 42 06 90<br />
Beigeordnete: Daniela Becker Markt 2, 99439 Buttelstedt Sprechzeit: Donnerstags 16 - 18 Uhr<br />
Amtliches<br />
Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses<br />
der Gemeinde Kleinobringen<br />
Am 4. Mai 2010 fi ndet um 19.00 Uhr im Bürgerhaus, Weimarische Str. 35 in<br />
Kleinobringen die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Kleinobringen<br />
statt.<br />
Der Wahlausschuß der Gemeinde Kleinobringen tritt an diesem Tag zusammen<br />
und beschließt in seiner Sitzung, ob die eingereichten Wahlvorschläge für die<br />
Wahl zum Bürgermeister den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und<br />
der Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen<br />
und als gültig zugelassen werden können.<br />
Dies gilt auch für Listenverbindungen.<br />
Diese Sitzung ist öffentlich. Der Zutritt ist jedermann gestattet.<br />
Der Wahlausschuß der Gemeinde Kleinobringen ist bei Anwesenheit des<br />
Wahlleiters ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlußfähig.<br />
Der Beschluß erfolgt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet<br />
die Stimme des Wahlleiters der Gemeinde Kleinobringen.<br />
Dr. Karin Hünniger<br />
Wahlleiter der Gemeinde Kleinobringen<br />
Nichtamtliches<br />
Die Gemeinde Kleinobringen verkauft preis<strong>wert</strong> und provisionsfrei<br />
voll erschlossene Grundstücke im Wohngebiet „Im Hirseborn“.<br />
Interessenten melden sich beim Bürgermeister Tel. 03643/420690<br />
oder in der Verwaltungsgemeinschaft Buttelstedt – Bauverwaltungsamt<br />
Tel. 036451/7280-44<br />
Die Anfänge der Thüringer Dorfschulen und deren Entwicklung<br />
(Fortsetzung des Artikels in der letzten Ausgabe des Journales)<br />
Im Fürstentum Weimar wurde im Jahre 1619 ein „Schulmethodus“ herausgegeben,<br />
der dem Schulmeister eine methodische Handhabe für s<strong>einen</strong><br />
Unterricht bot.<br />
Es war sehr schwierig, die Bauernkinder zum Schulbesuch anzuhalten. Die<br />
Bauern widersetzten sich hartnäckig dem Schulzwang. Die meisten von ihnen<br />
empfanden nicht das geringste Bildungsbedürfnis. Dazu kam, dass sie die<br />
Unkosten zu tragen hatten. Es war sowohl Schulgeld als auch Naturalien<br />
an den Schulmeister zu entrichten. Ein dritter Grund war, dass die Kinder<br />
währen der Schulzeit als Arbeitskräfte fehlten. Dem wurde teilweise Rechnung<br />
getragen und Konzessionen gemacht in der Form, dass in vielen Gegenden,<br />
insbesondere für die älteren Schülern nur winters über Schule hielt.<br />
Während der Schulmethodus von 1619 die Schulzeit noch für alle Kinder<br />
das ganze Jahr festlegte, wurden im Anhang von 1620 nur noch die<br />
„ABC-Schützen“ und die „Buchstabierenden“ (also die Kl<strong>einen</strong>) zum vollen<br />
Schulbesuch verpfl ichtet. Für die Größeren, „die schon etlichermaßen lesen<br />
können, wollte man zufrieden sein, wenn sie im Sommer täglich nur eine<br />
Stunde, bisweilen etliche Wochen gar nicht zur Schule kämen“.<br />
Ursprünglich erfolgte die Einschulung kontinuierlich über das ganze Jahr.<br />
Erst 1629 wurde die Einschulung einheitlich zum Gregori-Fest, dem 12. März,<br />
festgelegt. Der 12. März war der Namenstag des Papstes Gregor.<br />
Damit erfolgte auch der Übergang vom Einzel – zum Klassenunterricht.<br />
Lehrmethode und Schulzucht waren in der Dorfschule in ihren Anfängen<br />
unproblematisch. Jeder Schulmeister gestaltete den Unterricht nach eigenem<br />
Ermessen. Bezüglich der Zucht und auch der Methode war dabei der Stock<br />
das Universalmittel. Im Fürstentum Weimar wurde in dem bereits erwähnten<br />
Schulmethodus eine Anleitung für die Unterrichtsarbeit gegeben. Wenn die<br />
Anzahl der Kinder zu groß war, wird ein Abteilungsunterricht gefordert. Die<br />
Schüler wurden in drei Gruppen (Häufl ein) eingeteilt, in die „Abc-daries“<br />
(-lernenden), die „Buchstabierenden“ und die „Lesenden“. Währen der<br />
Schulmeister mit der <strong>einen</strong> Gruppe arbeitete, wurden die anderen Gruppen<br />
„Stillbeschäftigung“ angehalten. Die Gruppen konnten auch einzeln in die<br />
Schule bestellt werden.<br />
Im nun folgenden 30-jährigen Krieg, bei dem ein Drittel der hiesigen<br />
Bevölkerung, insbesondere durch Hunger infolge von Plünderungen und<br />
Seuchen zu Tode kam, lag das Schulwesen erstmal wieder am Boden.<br />
In Sachsen-Weimar war es die große Kirchen- und Schulvisitation von 1650,<br />
durch die unter anderem die Dorfschulverhältnisse wieder normalisiert wurden.<br />
Fast jedes Kirchdorf und auch zahlreiche Filialkirchdörfer hatten wieder eine<br />
eigene Schule mit Schulmeister. In den meisten Dörfern wurde täglich sechs<br />
Stunden, drei vormittags und drei nachmittags, unterrichtet, in manchen<br />
nur vier oder auch weniger. Nach jeder Stunde soll zwecks Erholung und<br />
Aufl ockerung eine „Erquickungsstunde“ von etwa einer viertel Stunde Dauer<br />
eingeschoben werden.<br />
Das Ziel der alten Dorfschule mit dem Erlernen des Lesens und des Schreibens,<br />
das als Letztes gelehrt wurde, im eigentlichen Sinne nur eine Gedächtnisstütze<br />
für den Religionsunterricht. Katechismus- und Bibelkenntnisse waren das<br />
eigentliche Bildungsgut und die religiöse Erziehung das eigentlich bezweckte<br />
Erziehungsziel. Die Trennung von Kirche und Schule erfolgte erst viel später.<br />
Wenn auch die Allgemeinbildung nicht das eigentliche Ziel beim Beginn<br />
der Dorfschulen war, sondern lediglich ein Mittel zur religiösen Erziehung<br />
darstellte, war sie trotzdem ein Fortschritt in der Entwicklung des deutschen<br />
Schulwesens.<br />
Egon Sundhaus<br />
In KLEINOBRINGEN wird ein Lehrer erstmals 1580 erwähnt. Die Lehrer sind<br />
namentlich seit 1670 bekannt. Noch Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Bürger<br />
Schulgeld zu bezahlen. Aus den Unterlagen zur Gemeindekasse des Jahres 1883<br />
von Kleinobringen ist die Höhe des Schulgeldes ersichtlich. Es betrug pro Jahr für<br />
ein Kind fünf Mark, für zwei Kinder acht Mark und für drei Kinder zehn Mark. Darüber<br />
hinaus war die Schulheizung kostenpfl ichtig, die Jahresgebühr betrug für ein Kind<br />
75 Pfennig, für zwei Kinder 1,50 Mark und für drei Kinder 2,25 Mark.<br />
Den älteren Kleinobringer Ureinwohnern ist noch der Albin Jautzer bekannt (die<br />
Ältesten wurden noch von ihm unterrichtet), der von 1911 bis 1945 Dorfschullehrer<br />
war. Bis zur Mitte der 1940er Jahre diente zum Lernen des Schreibens und<br />
Rechnens noch die Schiefertafel. Geschieben wurde mit einem Schieferstift (Griffel).<br />
Die Methode hatte den Vorteil, dass falsch Geschriebenes leicht weggewischt<br />
werden konnte. Dazu dienten ein nasser Schwamm und ein trockener Lappen,<br />
die mit Bindfäden an der Tafel angebunden waren. An diese Zeit erinnert das<br />
Foto von Gudrun Mähler, Sonja Erlhof und Lotte Großkopf mit Schiefertafel und<br />
Griffelkasten.<br />
Die Kleinobringer Schule war bis Ende der 1940er Jahre einklassig, d. h. dass alle<br />
acht Jahrgänge in einem Klassenraum unterrichtet wurden. Manchmal wurden<br />
die einzelnen Klassen zeitlich gestaffelt. Trotzdem war es eine organisatorische<br />
Meisterleistung, um das ordentlich zu gestalten. Das war nur durch strenge Disziplin<br />
möglich. Zu deren Einhaltung diente bis Kriegsende und teilweise noch danach<br />
der Rohrstock. Danach wurde begonnen, die Klassen zu splitten. Zunächst ist im<br />
Lehrerwohnhaus ein zweites Klassenzimmer eingerichtet worden. Danach erfolgte<br />
die Trennung Dörfer übergreifend. Der erste Schulverbund entstand zwischen<br />
Kleinobringen und Heichelheim. Die Kinder der Unterstufe wurden zunächst in<br />
Heichelheim und die oberen Klassen in Kleinobringen unterrichtet. Im Jahre 1953<br />
erfolgte die Umkehrung. Im gleichen Jahr kam Jürgen Pilz in die fünfte Klasse, so<br />
dass er das Pech hatte, alle acht Jahre nach Heichelheim wandern zu müssen.<br />
Noch erfolgte der Schulabschluss nach acht Schuljahren. Erst mit dem Anschluss<br />
der umliegenden Dörfer an die Zentralschule Berlstedt und deren Umbildung zur<br />
10klassigen Allgemeinbildenden Oberschule im Jahr 1958 begann die Umstellung<br />
auf die zehnjährige Schulpfl icht.<br />
Egon Sundhaus<br />
Wichtige Termine<br />
Gelber Sack: Freitag, den 07.05.2010 und 21.05.2010<br />
Hausmüll: Mittwoch, den 05.05.2010 und 19.05.2010<br />
Altpapier: Montag, den 31.05.2010<br />
Fahrbibliothek: entfällt wegen Feiertag in diesem Monat<br />
Steuerwissen<br />
ist Geld!<br />
Unser Beratungsstellenleiterin<br />
Annette Kaufmann ist gerne für Sie da!<br />
Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil ein und erstellen Ihre<br />
Einkommensteuererklärung<br />
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbständiger Arbeit, Renten und Versorgungsbezügen.<br />
Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.<br />
Ihre Beratungsstelle - zertifiziert nach DIN 77700<br />
Leiterin: Annette Kaufmann<br />
Ramslaer Str. 35, 99439 Schwerstedt<br />
Tel./Fax: 036452 / 7 01 09, E-Mail: Annette.Kaufmann@vlh.de<br />
SPRECHZEITEN<br />
Mo - Di 15.30 - 18.30 Uhr<br />
und nach Vereinbarung<br />
Kostenloses Info-Tel.: 08 00-1 81 76 16, E-Mail: info@vlh.de, Internet: www.vlh.de