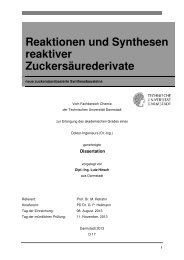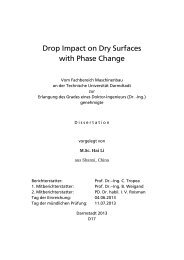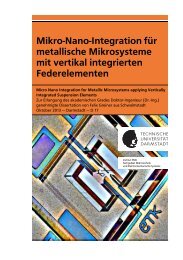Zukunftsprojekt Mitbestimmung? - tuprints - Technische Universität ...
Zukunftsprojekt Mitbestimmung? - tuprints - Technische Universität ...
Zukunftsprojekt Mitbestimmung? - tuprints - Technische Universität ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
weitgehend geteilt. Gerade in der Auseinandersetzung um die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes<br />
wurde die IT-Industrie daher von den Gegnern dieser Neufassung als<br />
„Beweis“ gegen die Notwendigkeit einer Erweiterung und Modernisierung von <strong>Mitbestimmung</strong>srechten<br />
angeführt.<br />
Diesen Aussagen liegt bezüglich der IT-Industrie wenig fundiertes empirisches Material zugrunde.<br />
Die Aussage von Bispinck und Trautwein-Kalms (1997), daß gerade in dieser Branche<br />
die „Tariflandkarte“ mehr „weiße Flecken“ aufweise als in anderen Branchen (ebd.,<br />
S. 232), ist zwar plausibel, läßt sich aber aufgrund der ungenauen wirtschaftsstatistischen<br />
Abgrenzung des Wirtschaftssegments anhand der vorliegenden Zahlen nicht belegen. 4<br />
Selbst wenn davon ausgegangen werden kann, daß Tarifverträge und Betriebsräte unterdurchschnittlich<br />
verbreitet sind, bestehen in wichtigen Unternehmen dennoch Organe der<br />
verfaßten <strong>Mitbestimmung</strong> und auch Tarifverträge. Somit handelt es sich bei der IT-Industrie<br />
nicht um eine „tarifvertrags- und mitbestimmungsfreie Zone“ (Wagner, Schild 1999).<br />
Die vermeintlich geringe Verbreitung der dualen Struktur (Schmidt, Trinczek 1999) der deutschen<br />
Arbeitsbeziehungen wird von Heidenreich und Töpsch (1998) sowie von Töpsch u.a.<br />
(2001) auf die besonderen Formen der Arbeitsregulation in der IT-Industrie zurückgeführt<br />
und als Ausdruck eines generellen Veränderungstrends interpretiert, der auch andere Branchen<br />
der Wirtschaft erfasse. Die Autoren gehen von der Argumentationsfigur des derzeit sich<br />
vollziehenden Übergangs von der „Industriegesellschaft“ zur „Wissens- und Kommunikationsgesellschaft“<br />
5 aus und fragen nach dem darin liegenden Veränderungspotential für das<br />
„industriegesellschaftliche Institutionenset“, bestehend aus industriellen Beziehungen, Berufsausbildung<br />
und Sozialversicherungssystemen. Ihre These ist, daß „die bestehenden Regulationsstrukturen<br />
sich (...) als nicht mehr adäquat für die Beschäftigungsbedingungen der<br />
Wissens- und Kommunikationsgesellschaft (erweisen)“ (Heidenreich, Töpsch 1998). Bezogen<br />
auf die IT-Industrie vermuten sie, daß sich gerade hier verstärkt ein „neuer Typus der<br />
Arbeitsregulation“ ausbreitet, der gänzlich ohne tarifvertragliche Regelungen auskommt. Im<br />
4 Exakte Zahlen zur Tarifbindung der IT-Industrie sind nicht verfügbar. Dies ist nicht zuletzt dem<br />
Umstand geschuldet, daß über die Zuordnung von Betrieben zu dieser sich gegenwärtig neu konstituierenden<br />
Branche keine Einigkeit herrscht (Seufert 2000). Die Vermutung von Bispinck und<br />
Trautwein-Kalms, wonach die tarifliche Bindung unterdurchschnittlich ist, ist aufgrund meiner Erfahrungen<br />
aus den diversen Expertengesprächen durchaus realistisch. Eine tarifliche Bindung, wie<br />
sie Kohaut und Bellmann für die westdeutschen Unternehmen insgesamt errechnen, ist hier nicht<br />
zu erwarten. (In Auswertung der Daten aus dem Betriebspanel des IAB kommen Kohaut und<br />
Bellmann (1997) zu dem Ergebnis, daß im Jahre 1995 62 % der Betriebe und 83 % der Beschäftigten<br />
in Westdeutschland unter eine Tarifbindung fielen.) Dies mag auch darauf zurückzuführen<br />
sein, daß die IT-Industrie in der Breite klein- und kleinstbetrieblich strukturiert ist. Da die Tarifbindung<br />
mit abnehmender Betriebsgröße deutlich sinkt (ebd.), erscheint es durchaus plausibel, daß<br />
die IT-Industrie mit ihren vielen kleinen und mittleren Unternehmen eine unterdurchschnittliche Tarifbindung<br />
aufweist, die allerdings – würde man die Betriebsgrößenklassenstruktur der IT-Industrie<br />
mit der der gesamten Wirtschaft vergleichen – u.U. gar nicht so weit unter den Durchschnittswerten<br />
liegt.<br />
5 Dieser, für die Argumentation grundlegende Begriff wird von den Autoren nicht theoretisch bestimmt,<br />
sondern mit dem Verweis auf bestimmte Erscheinungen plausibel gemacht. Daher erhält<br />
ihre Argumentation stets eine gewisse Beliebigkeit und die vorgetragenen Argumente könnten<br />
ebenso gut unter einem anderen begrifflichen „Label“ thematisiert werden.<br />
Seite 10 von 287 Andreas Boes: <strong>Zukunftsprojekt</strong> <strong>Mitbestimmung</strong>?