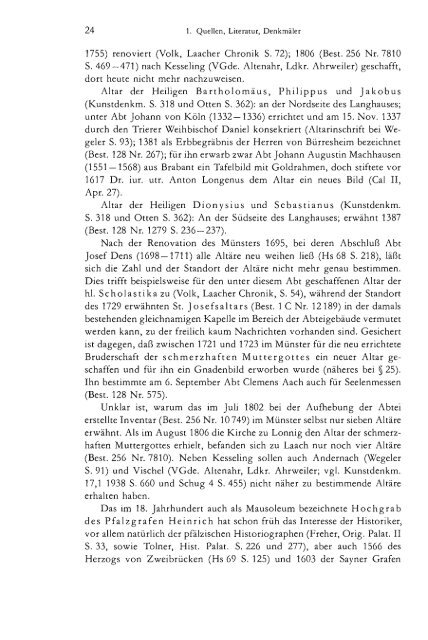- Seite 1 und 2: G ERMANIA SACRA HISTORISCH -STATIST
- Seite 5: VORWORT Die hier vorgelegte Geschic
- Seite 8 und 9: VIII Inhaltsverzeichnis 2. Der Prio
- Seite 11 und 12: ABKÜRZUNGEN Für Abkürzungen wird
- Seite 13 und 14: 1. QUELLEN, LITERATUR, DENKMÄLER
- Seite 15 und 16: § 1. Quellen 3 in den Nekrologen d
- Seite 17 und 18: § 1. Quellen 5 Klosternekrologen z
- Seite 19 und 20: § 1. Quellen 7 aufgezeichnet, der
- Seite 21 und 22: § 1. Quellen 9 2. Gedruckte Quelle
- Seite 23 und 24: § 1. Quellen 11 Mabillon Johannes,
- Seite 25 und 26: § 2. Literatur 13 B r ü 11 Felix,
- Seite 27 und 28: § 2. Literatur 15 Lamprecht Karl,
- Seite 29 und 30: § 3. Denkmäler 17 in damaliger Ze
- Seite 31 und 32: § 3. Denkmäler 19 gefunden hatte
- Seite 33 und 34: § 3. Denkmäler 21 ließen. Im 16.
- Seite 35: § 3. Denkmäler 23 unter Abt Cleme
- Seite 39 und 40: § 3. Denkmäler 27 der romanischen
- Seite 41 und 42: § 3. Denkmäler 29 1m 18. Jahrhund
- Seite 43 und 44: § 3. Denkmäler 31 kationstag der
- Seite 45 und 46: § 3. Denkmäler 33 versucht 1). Hi
- Seite 47 und 48: § 3. Denkmäler 35 der Klosteranla
- Seite 49 und 50: § 3. Denkmäler 37 (so Lohmeyer).
- Seite 51 und 52: § 3. Denkmäler 39 (vgl. § 32: Th
- Seite 53 und 54: § 3. Denkmäler 41 6. Liturgische
- Seite 55 und 56: § 4. Archiv 43 legien gleich ander
- Seite 57 und 58: § 4. Archiv 45 deutschen Kaiser un
- Seite 59 und 60: § 4. Archiv 47 Nr. 11455). Unsiche
- Seite 61 und 62: § 4. Archiv 49 erhaltenen Stücke
- Seite 63 und 64: § 5. Bibliothek 51 schwerpunkt bil
- Seite 65 und 66: § 5. Bibliothek 53 (Hs 65 fol. 58v
- Seite 67 und 68: § 5. Bibliothek 55 Handschriften,
- Seite 69 und 70: § 5. Bibliothek 57 Handschriften z
- Seite 71 und 72: § 5. Bibliothek 59 Handschriften d
- Seite 73 und 74: § 5. Bibliothek 61 der ersten Häl
- Seite 75 und 76: § 5. Bibliothek 63 Zum Inhalt Rose
- Seite 77 und 78: § 5. Bibliothek 65 17. Hugo von St
- Seite 79 und 80: § 5. Bibliothek 27. (Gregor, bzw.
- Seite 81 und 82: § 5. Bibliothek 69 Zum Inhalt Rose
- Seite 83: § 5. Bibliothek 71 Inhalt: S. 1 (s
- Seite 86:
74 2. Archiv und Bibliothek Inhalt:
- Seite 89 und 90:
§ 5. Bibliothek 77 60. Hroswitha,
- Seite 91 und 92:
§ 5. Bibliothek 79 sium (fol. 113v
- Seite 93 und 94:
§ 5. Bibliothek 81 69. (Thomas Kup
- Seite 95 und 96:
§ 5. Bibliothek 3. Augustinus, Exp
- Seite 97 und 98:
§ 5. Bibliothek 22. Boetius, De co
- Seite 99 und 100:
§ 5. Bibliothek 87 38. Tilmann von
- Seite 101 und 102:
§ 5. Bibliothek 89 Abtei im 12. Jh
- Seite 103 und 104:
§ 6. Lage, Patrozinium und Name 91
- Seite 105 und 106:
§ 7. Gründung und Entwicklung bis
- Seite 107 und 108:
§ 7. Gründung und Entwicklung bis
- Seite 109 und 110:
§ 7. Gründung und E ntwicklung bi
- Seite 111 und 112:
§ 7. Gründung und Entwicklung bis
- Seite 113 und 114:
§ 8. Das Kloster im Spätmittelalt
- Seite 115 und 116:
§ 8. Das Kloster im Spätmittelalt
- Seite 117 und 118:
§ 8. Das Kloster im Spätmittelalt
- Seite 119 und 120:
§ 8. Das Kloster im Spätmittelalt
- Seite 121 und 122:
§ 9. Vom Humanismus zur Aufklärun
- Seite 123 und 124:
§ 9. Vom Humanismus zur Aufklärun
- Seite 125 und 126:
§ 9. Vom Humanismus zur Aufklärun
- Seite 127 und 128:
§ 9. Vom Humanismus zur Aufklärun
- Seite 129 und 130:
§ 9. Vom Humanismus zur Aufklärun
- Seite 131 und 132:
§ 10. Die letzten Jahrzehnte der A
- Seite 133 und 134:
§ 10. Die letzten Jahrzehnte der A
- Seite 135 und 136:
§ 10. Die letzten Jahrzehnte der A
- Seite 137 und 138:
§ 10. Die letzten Jahrzehnte der A
- Seite 139 und 140:
4. VERFASSUNG § 11. Regel und Cons
- Seite 141 und 142:
§ 12. Die Klosterämter 129 hunder
- Seite 143 und 144:
§ 12. Die Klosterämter 131 Außer
- Seite 145 und 146:
§ 12. Die Klosterämter 133 beauft
- Seite 147 und 148:
§ 12. Die Klosterämter 135 nahmen
- Seite 149 und 150:
§ 12. Die Klosterämter 137 diesem
- Seite 151 und 152:
§ 12. Die Klosterämter 139 künft
- Seite 153 und 154:
§ 13. Der Konvent . 141 Nr. 828) i
- Seite 155 und 156:
§ 13. Der Konvent 143 verfassung b
- Seite 157 und 158:
§ 13. Der Konvent 145 setzung der
- Seite 159 und 160:
§ 13. Der Konvent 147 der Reform z
- Seite 161 und 162:
§ 13. Der Konvent 149 Damit war di
- Seite 163 und 164:
§ 14. Konversen und Präbendare 15
- Seite 165 und 166:
§ 14. Konversen und Präbendare 15
- Seite 167 und 168:
§ 15. Die weitere Klosterfamilie 1
- Seite 169 und 170:
§ 15. Die weitere Klosterfamilie 1
- Seite 171 und 172:
§ 15. Die weitere Klosterfamilie 1
- Seite 173 und 174:
§ 16. Die Propsteien 161 Jahr 1309
- Seite 175 und 176:
§ 17. Verhältnis zum Reich 163 Di
- Seite 177 und 178:
§ 18. Verhältnis zur römischen K
- Seite 179 und 180:
§ 19. Verhältnis zum Trierer Ordi
- Seite 181 und 182:
§ 19. Verhältnis zum Trierer Ordi
- Seite 183 und 184:
§ 19. Verhältnis zum Trierer Ordi
- Seite 185 und 186:
§ 20. Verhältnis zum Kölner Erzs
- Seite 187 und 188:
§ 20. Verhältnis zum Kölner Erzs
- Seite 189 und 190:
§ 20. Verhältnis zum Kölner Erzs
- Seite 191 und 192:
§ 21. Verhältnis zur Bursfelder K
- Seite 193 und 194:
§ 21. Verhältnis zur Bursfelder K
- Seite 195 und 196:
§ 22. Siegel und Wappen 183 Nachfo
- Seite 197 und 198:
§ 22. Siegel und Wappen 185 RIE IN
- Seite 199 und 200:
§ 22. Siegel und Wappen 187 Gold e
- Seite 201 und 202:
§ 23. Liturgie 189 (Hs 9 fol. 170v
- Seite 203 und 204:
§ 23. Liturgie 191 Bereiche neu or
- Seite 205 und 206:
§ 23. Liturgie 193 Vesper alle Glo
- Seite 207 und 208:
§ 23. Liturgie 195 falls man zu so
- Seite 209 und 210:
§ 23. Liturgie 197 auch zu Brauwei
- Seite 211 und 212:
§ 24. Reliquien 199 leicht ausgeno
- Seite 213 und 214:
§ 24. Reliquien 201 Friedrich (ges
- Seite 215 und 216:
§ 25. Ablässe und Bruderschaften
- Seite 217 und 218:
§ 25. Ablässe und Bruderschaften
- Seite 219 und 220:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 221 und 222:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 223 und 224:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 225 und 226:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 227 und 228:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 229 und 230:
§ 26. Askese, Disziplin, klösterl
- Seite 231 und 232:
§ 27. Scriptorium, Bildung und lit
- Seite 233 und 234:
§ 27. Scriptorium, Bildung und lit
- Seite 235 und 236:
§ 27. Scriptorium, Bildung und lit
- Seite 237 und 238:
§ 27. Scriptorium, Bildung und lit
- Seite 239 und 240:
§ 27. Scriptorium, Bildung und lit
- Seite 241 und 242:
§ 28. Geistliche Aufgaben der Abte
- Seite 243 und 244:
§ 28. Geistliche Aufgaben der Abte
- Seite 245 und 246:
§ 28. Geistliche Aufgaben der Abte
- Seite 248 und 249:
236 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 250 und 251:
238 5. Religiöses und geistiges Le
- Seite 252 und 253:
240 6. Der Besitz Infolge Siegfried
- Seite 254 und 255:
242 6. Der Besitz Lay. Die Verschul
- Seite 256 und 257:
244 6. Der Besitz Kölner Bürgern
- Seite 258 und 259:
246 6. Der Besitz Gebäudewert der
- Seite 260 und 261:
248 6. Der Besitz rungsprotokollen
- Seite 262 und 263:
250 6. Der Besitz Die Schaffung ein
- Seite 264 und 265:
252 6. Der Besitz Aus der Schicht d
- Seite 266 und 267:
254 6. Der Besitz Allerdings finden
- Seite 268 und 269:
256 6. Der Besitz Hingegen zog Laac
- Seite 270 und 271:
258 6. Der Besitz gehen konnte, ver
- Seite 272 und 273:
260 6. Der Besitz rung von Milch, K
- Seite 274 und 275:
262 6. Der Besitz und Flachs, durch
- Seite 276:
264 6. Der Besitz Jahreseinkünfte
- Seite 279 und 280:
§ 29. Grundbesitz und Vermögen 26
- Seite 281 und 282:
§ 29. Grundbesitz und Vermögen 26
- Seite 283 und 284:
§ 30. Listen der Klostergüter 271
- Seite 285 und 286:
§ 30. Listen der Klostergüter 273
- Seite 287 und 288:
§ 30. Listen der Klostergüter 275
- Seite 289 und 290:
§ 30. Listen der Klostergüter 277
- Seite 291 und 292:
§ 30. Listen der Klostergüter 279
- Seite 293 und 294:
§ 30. Listen der Klostergüter 281
- Seite 295 und 296:
§ 30. Listen der Klostergüter 283
- Seite 297 und 298:
§ 30. Listen der Klosterg üter Bu
- Seite 299 und 300:
§ 30. Listen der Klostergüter 287
- Seite 301:
§ 30. Listen der Klostergüter 289
- Seite 304 und 305:
292 6. Der Besitz Gondorf VGde. Unt
- Seite 306 und 307:
294 6. Der Besitz bewirkt. Über da
- Seite 308 und 309:
296 6. Der Besitz Zum Besitz Laachs
- Seite 310 und 311:
298 6. Der Besitz fehlen, und die j
- Seite 312 und 313:
300 6. Der Besitz Koblenzer Wirtsch
- Seite 314 und 315:
302 6. Der Besitz sein Anniversar u
- Seite 316:
304 6. Der Besitz Abtei abtragen li
- Seite 319 und 320:
§ 30. Listen der Klostergüter 307
- Seite 321 und 322:
§ 30. Listen der Klostergüter 309
- Seite 323 und 324:
§ 30. Listen der Klostergüter 311
- Seite 325 und 326:
§ 30. Listen der Klostergüter 313
- Seite 327 und 328:
§ 30. Listen der Klostergüter 315
- Seite 329 und 330:
§ 30. Listen der Klostergüter 317
- Seite 331 und 332:
§ 30. Listen der Klostergüter 319
- Seite 333:
§ 30. Listen der Klostergüter 321
- Seite 336 und 337:
324 6. Der Besitz hatte Laach kaum
- Seite 338 und 339:
326 6. Der Besitz Akten: Best. 128
- Seite 340 und 341:
328 6. Der Besitz Weitere Weinberge
- Seite 342 und 343:
330 6. Der Besitz Quellen: MUB 3 Nr
- Seite 344 und 345:
332 6. Der Besitz *Pommern a. d. Mo
- Seite 346 und 347:
334 6. Der Besitz Zinse und Geldein
- Seite 348 und 349:
336 6. Der Besitz *Wadenheim heute
- Seite 350 und 351:
338 6. Der Besitz von Köln 1146 ni
- Seite 352 und 353:
340 6. Der Besitz Hinzu kamen die v
- Seite 354 und 355:
342 6. Der Besitz ihrer Verwaltung
- Seite 356 und 357:
344 6. Der Besitz ANDERNACH: Ein Lu
- Seite 358 und 359:
346 6. Der Besitz (Best. 128 Nr. 64
- Seite 360 und 361:
348 7. Personallisten Überlieferun
- Seite 362 und 363:
350 7. Personallisten riums (Hs 65
- Seite 364 und 365:
352 7. Personallisten betreffen aus
- Seite 366 und 367:
354 7. Personallisten die Vogteifre
- Seite 368 und 369:
356 7. Personallisten Dietrich 1235
- Seite 370 und 371:
358 7. Personallisten Walter 1252 (
- Seite 372 und 373:
360 7. Personallisten gestatteten M
- Seite 374 und 375:
362 7. Personallisten (vgl. Einleit
- Seite 376 und 377:
364 7. Personallisten Identität de
- Seite 378 und 379:
366 7. Personal listen Abt Wilhelm
- Seite 380 und 381:
368 7. Personallisten Obwohl Abt Wi
- Seite 382 und 383:
370 7. Personallisten 20. April 145
- Seite 384 und 385:
372 7. Personallisten und 874 sowie
- Seite 386 und 387:
374 7. Personallisten Zum Abt gewä
- Seite 388 und 389:
376 7. Personallisten maßen ergän
- Seite 390 und 391:
378 7. Personallisten Reformmöncht
- Seite 392 und 393:
380 7. Personallisten er zwar zum M
- Seite 394:
382 7. Personallisten 1537, da dama
- Seite 397:
§ 31. Äbte 385 StadtarchKöln 43.
- Seite 401 und 402:
§ 31. Äbte Kaspar Bolen 1618-1619
- Seite 403 und 404:
§ 31. Äbte 391 Heinrich 1624 erst
- Seite 405 und 406:
§ 31. Äbte 393 datum auch XVIII g
- Seite 407 und 408:
§ 31. Äbte 395 befindet sich im K
- Seite 409 und 410:
§ 31. Äbte 397 Volk, Laacher Chro
- Seite 411 und 412:
§ 31. Äbte 399 beide Familien ste
- Seite 413 und 414:
§ 31. Äbte 401 Sein Taufname laut
- Seite 415 und 416:
§ 31. Äbte 403 Obwohl Vorgänge b
- Seite 417 und 418:
§ 31. Äbte 405 (absehr. Notiz aus
- Seite 420 und 421:
408 7. Personallisten S. 169). Zur
- Seite 422 und 423:
410 7. Personallisten Trier Wp.). V
- Seite 424 und 425:
412 7. Personallisten stücke gelan
- Seite 426 und 427:
414 7. Personallisten Lambert von L
- Seite 428 und 429:
416 7. Personallisten Nr. 311 und 1
- Seite 430 und 431:
418 7. Personallisten er durch dess
- Seite 432 und 433:
420 7. Personallisten später als d
- Seite 434 und 435:
422 7. Personallisten Drunck erwäh
- Seite 437 und 438:
§ 32. Prioren 425 STO DILECTUS PAT
- Seite 439 und 440:
§ 32. Prioren 427 Nikolaus Ruber (
- Seite 441 und 442:
§ 32. Prioren 429 die Anregung zur
- Seite 443 und 444:
§ 33. Subprioren 431 hebung der Ab
- Seite 445 und 446:
§ 34. Pröpste 433 Dezember 1713 (
- Seite 447 und 448:
§ 34. Pröpste 435 ausgehändigt h
- Seite 449 und 450:
§ 34. Pröpste 437 dings erst seit
- Seite 451 und 452:
§ 35. Kellerare und Kämmerer 439
- Seite 453 und 454:
§ 35. Kellerare und Kämmerer 441
- Seite 455 und 456:
§ 35. Kellerare und Kämmerer 443
- Seite 457 und 458:
§ 35. Kellerare und Kämmerer 445
- Seite 459 und 460:
§ 36. Kustoden und Sakristane 447
- Seite 461 und 462:
§ 37. Hospitalare und Gastmeister
- Seite 463 und 464:
§ 37. Hospitalare und Gastmeister
- Seite 465 und 466:
§ 38. Lektoren 453 (Best. 441 Nr.
- Seite 467 und 468:
§ 38. Lektoren 455 1791 (Best. 128
- Seite 469 und 470:
§ 39. Novizenmeister 457 J ohann B
- Seite 471 und 472:
§ 40. Konventsmitglieder 459 Todes
- Seite 473 und 474:
§ 40. Konventsmitglieder Erluinus:
- Seite 475 und 476:
§ 40. Konventsmitglieder Reinardus
- Seite 477 und 478:
§ 40. Konventsmitglieder 465 Rorin
- Seite 479 und 480:
§ 40. Konventsmitglieder 467 Schoe
- Seite 481 und 482:
§ 40. Konventsmitglieder 469 dem s
- Seite 483 und 484:
§ 40. Konventsmitglieder 471 Wezel
- Seite 485 und 486:
§ 40. Konventsmitglieder Wal ter v
- Seite 487 und 488:
§ 40. Konventsmitglieder 475 zahl
- Seite 489 und 490:
§ 40. Konventsmitglieder 477 Werne
- Seite 491 und 492:
§ 40. Konventsmitglieder 479 Spiri
- Seite 493 und 494:
§ 40. Konventsmitglieder 481 zu de
- Seite 495 und 496:
§ 40. Konventsmitglieder 483 kann
- Seite 497 und 498:
§ 40. Konventsmitglieder 485 (vgl.
- Seite 499 und 500:
§ 40. Konventsmitglieder 487 J oha
- Seite 501 und 502:
§ 40. Konventsmitglieder 489 Gottf
- Seite 503 und 504:
§ 40. Konventsmitglieder 491 J oha
- Seite 505 und 506:
§ 40. Konventsmitglieder 493 Kolla
- Seite 507 und 508:
§ 40. Konventsmitglieder 495 ionsp
- Seite 509:
§ 40. Konventsmitglieder 497 Schre
- Seite 512 und 513:
500 7. Personallisten Jako b Boom (
- Seite 514 und 515:
502 7. Personallisten zu Fraukirch
- Seite 516 und 517:
504 7. Personallisten gleichfalls i
- Seite 518 und 519:
506 7, Personallisten Geholle gehö
- Seite 520 und 521:
508 7. Personallisten 1769, zum Pri
- Seite 522 und 523:
510 7. Personallisten mit einer kle
- Seite 524 und 525:
512 7. Personallisten Hilfsseelsorg
- Seite 526 und 527:
514 7. Personal listen zu Trier von
- Seite 528 und 529:
516 7. Personallisten Otto Brewer,
- Seite 530 und 531:
A Aach -, Anna, geb. Hackenbroch, M
- Seite 532 und 533:
520 Register - v. Geisbusch MzL (13
- Seite 535 und 536:
136, 148, 150, 167-168, 169, 171, 1
- Seite 537 und 538:
- von Kesselstatt 289, 342, 344 - v
- Seite 539 und 540:
-, Hof 115, 245, 287, 289 - Lehen 3
- Seite 541 und 542:
- Johann, Prior (1630) 425 Gobelin
- Seite 543 und 544:
Snitz von Kempenich, Prior (1391, 1
- Seite 545 und 546:
Jaques, Gaststubendiener und Bader
- Seite 547 und 548:
LBesitz 239, 244, 285, 296-297, 320
- Seite 549 und 550:
-, Dekan von Münstermaifeld 476 -,
- Seite 551:
Kanal (Fulbertstollen) 18, 91, 240,
- Seite 554 und 555:
542 Register Kellerar 34, 58, 79, 1
- Seite 556 und 557:
544 Register Ostern 195 St. Placidu
- Seite 558 und 559:
546 Register Linz a. Rh. 147,364,39
- Seite 560 und 561:
548 Register Meyrot, Ott s. Ott Mic
- Seite 562 und 563:
550 Register - Pfarrei 288, 447 - -
- Seite 564 und 565:
552 Register Reiner von Westerburg,
- Seite 566 und 567:
554 Register Schoeffer, Johann, Pri
- Seite 568 und 569:
556 Register -, Schreiber (ca. 1185
- Seite 570 und 571:
558 Register Wallraf, Ferdinand Fra
- Seite 572:
560 Register Wolmarus MzL (1093-150