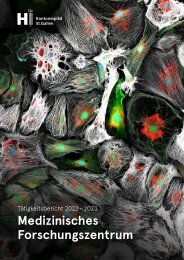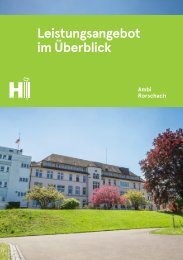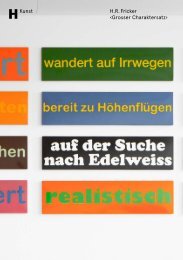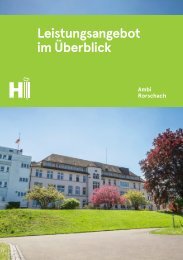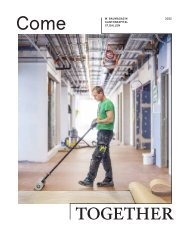KSSG_Magazin_150Jahre
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ROCKET SCIENCE*<br />
Spitzenforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie in wissenschaftlichen<br />
Publikationen veröffentlicht wird und sich in einem harten Wettbewerb<br />
um Forschungsgelder durchsetzt. Hier stellen wir fünf Highlights aus dem<br />
Medizinischen Forschungszentrum des Kantonsspitals St.Gallen vor.<br />
Experimentelle Dermatologie<br />
Dr. Fiamma Berner und Dr. David Bomze, Medizinisches Forschungszentrum<br />
Dr. Fiamma Berner und Dr. David Bomze aus der Forschungsgruppe<br />
von Prof. Dr. Lukas Flatz haben 2020 den Pfizer Forschungspreis in der<br />
Kategorie Onkologie erhalten. In ihrem Forschungsprojekt haben die<br />
jungen Forschenden autoimmune Nebenwirkungen identifiziert, die<br />
bei der Behandlung von Lungenkrebserkrankungen auftreten können.<br />
Die Ausgangslage: Zwar kann man die «Bremsen des Immunsystems»<br />
heute durch sogenannte Inhibitoren lösen – ein medizinscher Durchbruch,<br />
der 2018 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Allerdings<br />
wird dadurch nicht nur der Tumor zurückgedrängt, sondern es steigt<br />
auch das Risiko für unerwünschte Autoimmunreaktionen in anderen<br />
Körperorganen wie der Haut. Genau das zeigt die Studie des St.Galler<br />
Forschungsteams erstmals umfassend, sodass das Risiko für Nebenwirkungen<br />
in Zukunft besser abgeschätzt werden kann.<br />
* «Rocket Science»: something that is very difficult to learn or understand<br />
(The Brittanica Dictionary; dt.: etwas, das sehr schwer zu lernen oder zu verstehen ist)<br />
Coronaviren im Verdauungstrakt<br />
Dr. Natalia Pikor, Medizinisches Forschungszentrum<br />
Das Kantonsspital St.Gallen (<strong>KSSG</strong>) hat Forschungsprofessorinnen<br />
und -professoren, nur dürfen sich<br />
diese nicht so nennen, da das <strong>KSSG</strong> kein universitäres<br />
Spital ist. Eine aufstrebende <strong>KSSG</strong>-Wissenschaftlerin<br />
von professoralem Format ist die 36-jährige<br />
Dr. Natalia Pikor, die für ihr Projekt «Antivirale<br />
Immunität gegen Coronaviren im Gastrointestinaltrakt»<br />
mit der renommierten Peter Hans Hofschneider<br />
Stiftungsprofessur ausgezeichnet wurde. Und darum<br />
geht es: Während die Folgen einer Coronainfektion<br />
für die Lunge und die Atemwege gut dokumentiert<br />
sind, erforscht Dr. Pikor die möglichen Auswirkungen<br />
auf den menschlichen Verdauungstrakt,<br />
insbesondere auf Magen, Darm und Leber. Die<br />
Entschlüsselung dieser Mechanismen soll dazu<br />
beitragen, Risikopatientinnen und -patienten mit<br />
Multiorganerkrankungen bei einer Coronainfektion<br />
besser therapieren zu können.<br />
Immunorgane im Darm, die sogenannten Peyerschen Platten.<br />
Die rot markierten Zellen sind vom Coronavirus infiziert.<br />
HELICAL: Mit Big Data zu gesunden Blutgefässen<br />
Projektleitung Prof. Dr. Alfred Mahr und Solange<br />
Gonzalez Chiappe, Klinik für Rheumatologie<br />
Big Data sind in aller Munde. Auch in der Medizin<br />
soll die Verarbeitung und Analyse riesiger Datenmengen<br />
zu neuen Erkenntnissen und letztlich besseren<br />
Therapien führen. Das EU-Projekt HELICAL<br />
steht für «HEalth data LInkage for ClinicAL benefit».<br />
In diesem interdisziplinären Projekt spannen<br />
17 akademische Partner aus acht europäischen Ländern,<br />
darunter die Klinik für Rheumatologie des<br />
<strong>KSSG</strong>, und neun industrielle Partner zusammen,<br />
um grosse klinische Datensätze unter Berücksichtigung<br />
des Datenschutzes und mithilfe gigantischer<br />
Computer auszuwerten. Als Fallbeispiel dient die<br />
chronische Vaskulitis, die entzündliche Erkrankung<br />
der Blutgefässe. Konkret bietet HELICAL 15 jungen<br />
Forschenden, darunter Solange Gonzalez Chiappe<br />
vom <strong>KSSG</strong>, die Möglichkeit, während 36 Monaten<br />
einen PhD (Philosophical Doctorate) in hochmoderner<br />
Datenanalyse zu erlangen. Ziel ist es, über Big<br />
Data die umweltbedingten Auslöser und komplexen<br />
Wirkungsmechanismen chronischer Krankheiten<br />
zu verstehen.<br />
Das Medizinische Forschungszentrum (MFZ)<br />
Das MFZ schafft für seine über 60 Mitarbeitenden<br />
eine attraktive Forschungsumgebung, um die<br />
akademische Lehre, Forschungskompetenz und<br />
Innovationskräfte am Kantonsspital St.Gallen zu<br />
stärken. Es besteht aus<br />
· dem Institut für Immunbiologie mit den<br />
Forschungsgruppen Immunbiologie, Dermatologie,<br />
Neuroimmunologie und Neurochirurgie<br />
· der Clinical Trials Unit (CTU) zur Koordination<br />
der klinischen Forschungstätigkeit mit anderen<br />
Spitälern und Industriepartnern<br />
· mehreren angegliederten Forschungsgruppen<br />
von den <strong>KSSG</strong>-Kliniken für Onkologie, Infektiologie<br />
und Urologie.<br />
Mit dem MFZ entspricht das <strong>KSSG</strong> dem Leistungsauftrag<br />
des Kantons St.Gallen «für den Betrieb von<br />
anwendungsorientierter Forschung (...) zur Gewinnung<br />
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur Verbesserung<br />
der Prävention, Diagnostik und Behandlung<br />
von Krankheiten».<br />
i<br />
Blutdruck und postoperative Komplikationen<br />
Projektleitung Prof. Dr. Miodrag Filipovic, Stv. Chefarzt, Klinik für<br />
Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin<br />
Eine Kernaufgabe der Anästhesie ist es, während Operationen Vitalzeichen<br />
wie den Blutdruck zu kontrollieren und zu regulieren. Dabei<br />
ist bekannt, dass ein zu tiefer Blutdruck bei der Operation statistisch<br />
gesehen postoperative Komplikationen und Todesfälle begünstigt.<br />
Doch was passiert, wenn der Blutdruck während der Operation medikamentös<br />
etwas erhöht wird? Liessen sich dadurch postoperative<br />
Komplikationen reduzieren? Auf diese Fragen will die BBB-Studie (Biomarker,<br />
Blutdruck, BIS) Antworten finden. Nach dem Zufallsprinzip<br />
werden Patientinnen und Patienten in zwei Gruppen unterteilt: eine<br />
Kontrollgruppe mit dem heute üblichen Zielblutdruck sowie eine<br />
Gruppe mit einem erhöhten intraoperativen Zielblutdruck. Danach<br />
werden beide während zwölf Monaten bezüglich Komplikationen<br />
verglichen. Die Studie ist von hohem klinischem Interesse, und die<br />
Durchführung wurde vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.<br />
Ein «Flugsimulator» für Chirurginnen und Chirurgen<br />
Projektleitung Prof. Dr. Bruno Schmied, Chefarzt Klinik für Allgemein-,<br />
Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie<br />
Wovon Pilotinnen und Piloten längst profitieren, soll auch in der<br />
Chirurgie Fuss fassen: das Training am Simulator. Initiiert wird der<br />
Paradigmenwechsel – Training am Monitor statt am Menschen – durch<br />
das Projekt PROFICIENCY. Dessen Leiter, Prof. Dr. Bruno Schmied,<br />
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie<br />
im <strong>KSSG</strong>, freut sich: «Das innovative Weiterbildungsangebot<br />
wird die chirurgische Weiterbildung in der offenen<br />
und minimalinvasiven Chirurgie entscheidend verbessern.» Auch<br />
Innosuisse ist begeistert: Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung<br />
des Bundes unterstützt das Projekt PROFICIENCY mit<br />
zwölf Millionen Franken.<br />
12<br />
13