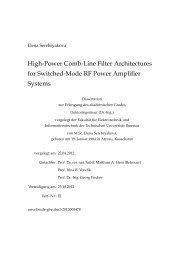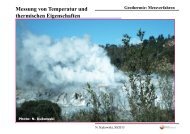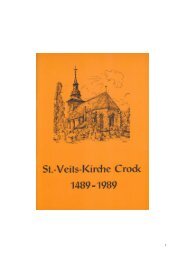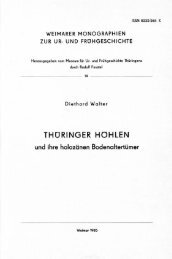Diskussionsbeitrag_17_Technikkommunikation bei ...
Diskussionsbeitrag_17_Technikkommunikation bei ...
Diskussionsbeitrag_17_Technikkommunikation bei ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Grundsätzliches zur <strong>Technikkommunikation</strong> und zur Inhaltsanalyse<br />
Unter dem Gütekriterium Validität wird allgemein die Gültigkeit der Messung, Erhebung<br />
usw. bezeichnet. Es ist zuzustimmen, dass es sich hier<strong>bei</strong> um das wichtigste Testgütekrite-<br />
rium handelt. 104 Problematisch ist die Handhabung dieses Gütekriteriums in der Inhalts-<br />
analyse allerdings deshalb, weil keine numerische Bestimmung von Validitätswerten mög-<br />
lich ist. Vielmehr läuft die Bewertung der inhaltlichen Validität einer Inhaltsanalyse mehr<br />
auf Plausibilität, Augenscheinlichkeit, Einhalten von Konventionen und<br />
Maßstabsverabredungen, Eintreffen erwarteter Ergebnisse usw. hinaus.<br />
Die Konstruktvalidität als weitere Form der Validität gibt Auskunft darüber, inwieweit<br />
„aus dem zu messenden Zielkonstrukt Hypothesen ableitbar sind, die anhand der Testwerte<br />
bestätigt werden können“ 105 . Die Beobachtung, dass Testwerte mit den aus Theorie und<br />
Empirie abgeleiteten Hypothesen übereinstimmen, wird als Indiz für die Konstruktvalidität<br />
der Tests oder der Inhaltsanalyse gewertet. Diese Vorgehensweise unterliegt der Gefahr<br />
eines semantischen Zirkelschlusses, d. h. es werden Hypothesen aufgrund vorhandenen<br />
Wissens vorgegeben und dann auch unter Einwirkung dieses Wissens bestätigt. Krippen-<br />
dorf formuliert seine Kritik wie folgt: „Wenn der Inhaltsanalytiker kein direktes Wissen<br />
über seinen Gegenstand besitzt, dann kann er tatsächlich nichts über die Validität seiner<br />
Ergebnisse aussagen. Wenn er einiges Wissen über den Kontext des Materials besitzt und<br />
er dies zur Entwicklung seiner analytischen Konstrukte benutzt, dann ist dieses Wissen<br />
nicht länger unabhängig von der Untersuchung und kann nicht zur Validierung der Ergebnisse<br />
benutzt werden“ 106 .<br />
Die Quantifizierung der Konstruktvalidität mittels Korrelationskoeffizienten kann auch<br />
nicht als unumstritten angesehen werden, da die Güte der Validität an die Größe des Korrelationskoeffizienten<br />
geknüpft wird. Dafür mögen Erfahrungswerte zugrunde liegen, im<br />
strengen Sinne wissenschaftlich ist diese Vorgehensweise jedoch kaum. Auch wird oftmals<br />
übersehen, dass Korrelation eigentlich nur den Zusammenhang von zwei Merkmalen bedeutet<br />
und keine Kausalität. Auch die auf unterschiedlichste Art berechneten Korrelations-<br />
104 Bortz, J.; Döring, N. (2002), S. 199. Für Naturwissenschaftler ist diese Feststellung nahezu selbstverständlich.<br />
Ganze Generationen von Physikstudenten haben am Anfang des physikalischen Praktikums umfangreiche<br />
Betrachtungen anstellen müssen, ob man mit dem Messverfahren überhaupt das misst, was man<br />
messen möchte (und mit welchen Fehlern). Es ist mitunter schon verwunderlich, wie schwerfällig in anderen<br />
Wissenschaften erworbenes Grundwissen und Wissenschaftsverständnis in den Sozialwissenschaften Eingang<br />
findet.<br />
105 Bortz, J.; Döring, N. (2002), S. 201-202.<br />
106 Krippendorf, K. (1980), zitiert nach Mayring, P. (2003), S. 110-111.<br />
35