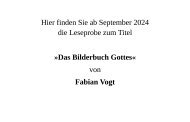Daniel Wegner: Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche (Leseprobe)
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Wie können Kooperationen zwischen Diakonie und Kirche gelingen? Neben zahlreichen Gemeinsamkeiten und Verknüpfungen weisen beide sehr unterschiedliche Systemlogiken auf. Aus theologischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive werden organisationale und interaktionale Aspekte von Diakonie und Kirche analysiert und die Gemeinwesendiakonie als kooperativer Kontext betrachtet. In zwei empirischen Studien werden anschließend die Kirchenkreissozialarbeit und ein gemeinwesendiakonisches Förderprojekt untersucht. Dabei werden unterschiedliche Typen gelingender Kooperationen herausgearbeitet. Es wird deutlich: Wo Diakonie und Kirche zusammenarbeiten, werden sie zu wichtigen Gestalterinnen in der Zivilgesellschaft.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
30<br />
1 Einleitung<br />
(1) Zum einen ist es Ziel dieser Arbeit, Wege aufzuzeigen, wie sich organisierte<br />
<strong>Diakonie</strong> in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche durch ein gemeinwesendiakonisches<br />
Profil zukünftig ausrichten kann.<br />
(2) Verfasste <strong>Kirche</strong>, insbesondere in ihrer Form als Parochialgemeinde, hat<br />
den Auftrag, Verantwortung für ihr Umfeld <strong>und</strong> die Gesellschaft zu übernehmen.<br />
Daran schließt diese Arbeit unmittelbar an. Sie kann somit einen Beitrag zu Diskussion<br />
über das diakonische Profil <strong>und</strong> den Gemeinwesenbezug von verfasster<br />
<strong>Kirche</strong> <strong>und</strong> <strong>Kirche</strong>ngemeinden.<br />
(3) In Bezug auf kirchlich-diakonische <strong>Kooperationen</strong> sollen vorliegende wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse durch ihre Überprüfung im Kontext der Gemeinwesendiakonie<br />
für den wissenschaftlichen Diskurs der Kooperationsforschung aktualisiert,<br />
gegebenenfalls revidiert <strong>und</strong> so fruchtbar gemacht werden. Ziel ist es die<br />
wissenschaftliche Diskussion der Gemeinwesendiakonie an einer relevanten<br />
Stelle --- dem Prinzip der Kooperation --- zu vertiefen.<br />
(4) Zuletzt wird mit der Arbeit ein Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs<br />
der Armutsforschung geleistet, indem die Verantwortung von organisierter <strong>Diakonie</strong><br />
<strong>und</strong> verfasster <strong>Kirche</strong> als wichtige Stakeholder sozialpolitischen Handelns<br />
in der Gemeinwesendiakonie für die Lage von Armutsbetroffenen <strong>und</strong> den Umgang<br />
mit Armut in Deutschland in den Blick genommen wird.<br />
Somit werden die Akteur*innen gemeinwesendiakonischer Praxis (»Welt 1«)<br />
zu Forschungsobjekten der wissenschaftlichen Untersuchung (»Welt 2«).<br />
Auf der Ebene der Meta-Wissenschaft (»Welt 3«)<br />
Auf dieser Ebene fragt die Forschung danach, inwieweit das Vorgehen einer wissenschaftlichen<br />
Untersuchung sinnvoll ist, um in anderen Kontexten eine vergleichbare<br />
Untersuchung durchzuführen, die ebenfalls zu verlässlichen Ergebnissen<br />
kommt, ob also die Intersubjektivität der Ergebnisse gewährleistet ist. Es geht<br />
somit um die Reflexion über die genutzten wissenschaftlichen Methoden<br />
(»Welt 2«). Das Ziel ist es, festzustellen, ob die qualitative Forschung sinnvoll ist,<br />
um verlässliche Ergebnisse zu erhalten, die letztlich für die konkrete Praxis<br />
(»Welt 1«) fruchtbar gemacht werden sollen. Was muss am wissenschaftlichen<br />
Vorgehen der Untersuchung bedacht <strong>und</strong> geändert werden <strong>und</strong> welche Faktoren<br />
<strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>annahmen werden gewählt bzw. sind schlussendlich haltbar oder zu<br />
verwerfen, um verlässliche Ergebnisse zu erhalten? Zusammenfassend lässt sich<br />
für die »Welt 3« hinsichtlich der Absichten für die »Welt 2« das Ziel formulieren,<br />
inwieweit es sinnvoll ist, das Erfahrungswissen der Akteure aus der Praxis der<br />
Gemeinwesendiakonie als Forschungsobjekte in Bezug auf Forschungsziel, Forschungsfragen<br />
<strong>und</strong> Relevanz des Themas zu untersuchen <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong>lage welchen<br />
wissenschaftlichen Ansatzes Methoden <strong>und</strong> Datenanalyse gewählt werden<br />
sollten. Die Arbeit möchte auf der Meta-Ebene einen Beitrag zu der Frage leisten,<br />
inwieweit die Instrumente der qualitativen Sozialforschung im Rahmen der <strong>Diakonie</strong>wissenschaft<br />
sich sowohl als hilfreich als auch als berechtigt erweisen, um<br />
das oben beschriebene Phänomen zu erforschen (vgl. Eidt & Eurich 2016: 359).